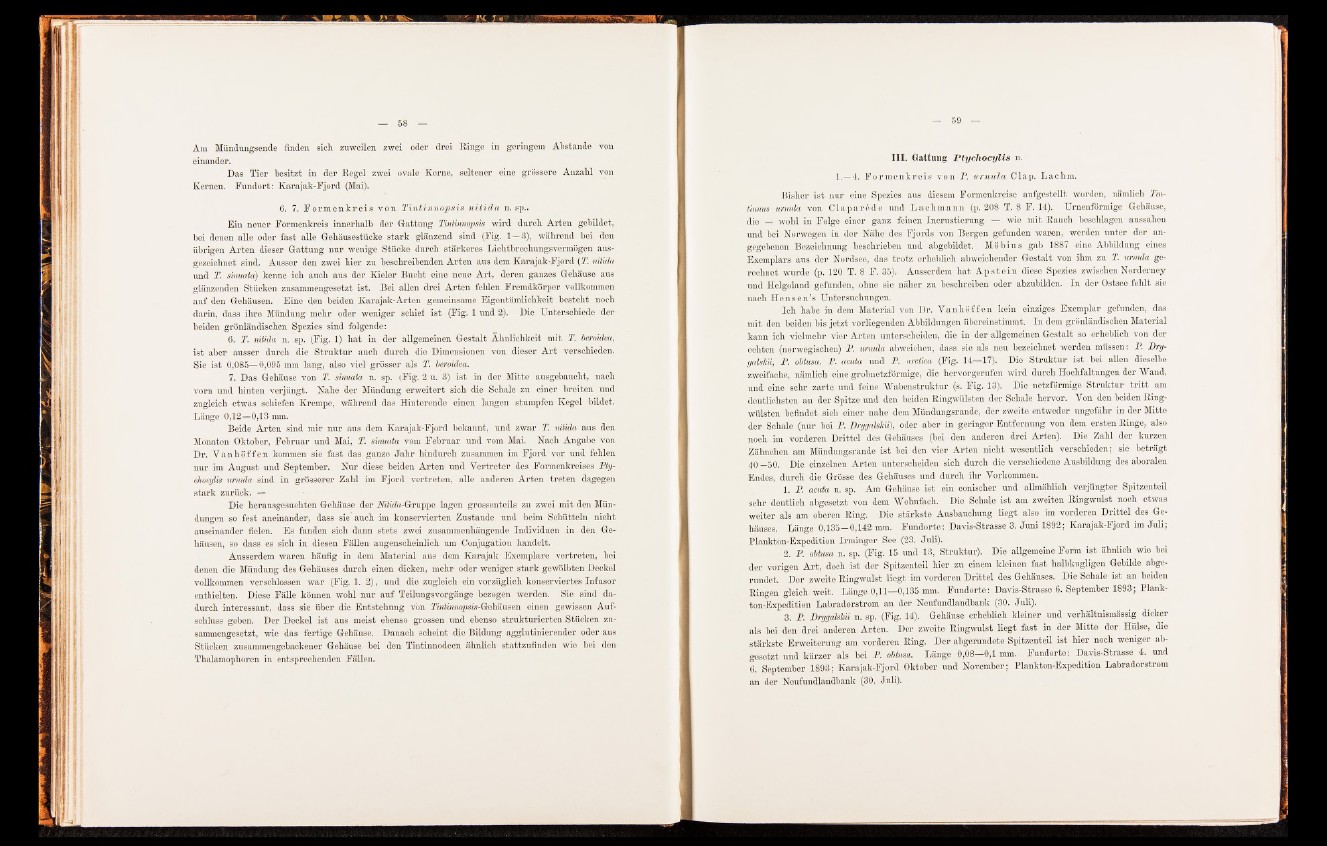
Am Mündungsende finden sich zuweilen zwei oder drei Ringe in geringem Abstande von
einander.D
as Tier besitzt in der Regel zwei ovale Kerne, seltener eine grössere Anzahl von
Kernen. Fundort: Karajak-Fjord (Mai).
6. 7. F o rm e n k r e i s v o n T in t in n o p s i s n i t i d a n. sp..
Ein neuer Formenkreis innerhalb der Gattung Tintinnopsis wird durch Arten gebildet,
bei denen alle oder fa st alle Gehäusestücke s tark glänzend sind (Fig. 1 — 3), während bei den
übrigen Arten dieser Gattung nur wenige Stücke durch stärkeres Lichtbrechungsvermögen ausgezeichnet
sind. Ausser den zwei hier zu beschreibenden Arten aus dem Karajak-Fjord (T. nitida
und T. sirnata) kenne ich auch aus der Kieler Bucht eine neue A rt, deren ganzes Gehäuse aus
glänzenden Stücken zusammengesetzt ist. Bei allen drei Arten fehlen Fremdkörper vollkommen
auf den Gehäusen. Eine den beiden Karajak-Arten gemeinsame Eigentümlichkeit besteht noch
darin, dass ihre Mündung mehr oder weniger schief is t (Fig. 1 und 2). Die Unterschiede der
beiden grönländischen Spezies sind folgende:
6. T. nitida n. sp. (Fig. 1) h a t in der allgemeinen Gestalt Ähnlichkeit mit T. beroidea,
is t aber ausser durch die S tru k tu r auch durch die Dimensionen von dieser A rt verschieden.
Sie is t 0,085—0,095 mm lang, also viel grösser als T. beroidea.
7. Das Gehäuse von T. sirnata n. sp. (Fig. 2 u. 3) is t in der Mitte ausgebaucht, nach
vorn und hinten verjüngt. Nahe der Mündung erweitert sich die Schale zu einer breiten und
zugleich etwas schiefen Krempe, während das Hinterende einen langen stumpfen Kegel bildet.
Länge 0,12—0,13 mm.
Beide Arten sind mir nur aus dem Karajak-Fjord bekannt, und zwar T. nitida aus den
Monaten Oktober, Februar und Mai, T. sinuata vom Februar und vom Mai. Nach Angabe von
Dr. Y a n h ö f f e n kommen sie fa st das ganze J a h r hindurch zusammen im Fjord vor und fehlen
nur im August und September. Nur diese beiden Arten und V e rtre te r des Formenkreises Pty-
chocylis urmda sind in grösserer Zahl im Fjord vertreten, alle anderen Arten tre te n dagegen
sta rk zurück.
Die herausgesuchten Gehäuse der NiÄt-Gruppe lagen grossenteils zu zwei mit den Mündungen
so fest aneinander, dass sie auch im konservierten Zustande und beim Schütteln nicht
auseinander fielen. Es fanden sich dann stets zwei zusammenhängende Individuen in den Gehäusen,
so dass es sich in diesen Fällen augenscheinlich um Conjugation handelt.
Ausserdem waren häufig in dem Material aus dem Karajak Exemplare vertreten, bei
denen die Mündung des Gehäuses durch einen dicken, mehr oder weniger s ta rk gewölbten Deckel
vollkommen verschlossen war (Fig. 1. 2), und die zugleich ein vorzüglich konserviertes Infusor
enthielten. Diese Fälle können wohl n u r auf Teilungsvorgänge bezogen werden. Sie sind dadurch
interessant, dass sie über die Entstehung von Tintinnopsis-Gehäusen einen gewissen Aufschluss
geben. Der Deckel is t aus meist ebenso grossen und ebenso s tru k tu rierten Stücken zusammengesetzt,
wie das fertige Gehäuse. Danach scheint die Bildung agglutinierender oder aus
Stücken zusammengebackener Gehäuse- bei den Tintinnodeen ähnlich stattzufinden wie bei den
Thalamophoren in entsprechenden Fällen.
III. Gattung P t y c h o c y li s n.
1 . — 4. F o rm e n k r e i s v o n P. u r n u la C la p . L a c hm .
Bisher is t nur eine Spezies aus diesem Formenkreise aufgestellt worden, nämlich Tin-
tinnns urnula von C l a p a r e d e und L a c h m a n n (p. 208 T. 8 F. 14). Urnenförmige Gehäuse,
die — wohl in Folge einer ganz feinen Incrustierung — wie mit Rauch beschlagen aussahen
und bei Norwegen in der Nähe des Fjords von Bergen gefunden waren, werden unter der angegebenen
Bezeichnung beschrieben und abgebildet. M ö b iu s gab 1887 eine Abbildung eines
Exemplars aus der Nordsee, das tro tz erheblich abweichender Gestalt von ihm zu T. urnula gerechnet
wurde (p. 120 T. 8 F. 35). Ausserdem h a t A p s t e i n diese Spezies zwischen Norderney
und Helgoland gefunden, ohne sie näher zu beschreiben oder abzubilden. In der Ostsee fehlt sie
nach H e n s e n ’s Untersuchungen.
Ich habe in dem Material von Dr. V a n h o f f e n kein einziges Exemplar gefunden, das
mit den beiden bis je tz t vorliegenden Abbildungen übereinstimmt. In dem grönländischen M aterial
kann ich vielmehr vier Arten unterscheiden, die in der allgemeinen Gestalt so erheblich von der
echten (norwegischen) P. urnula abweichen, dass sie als neu bezeichnet werden müssen: P. Dry-
galslcii, P. obtusa, P. aouta und P. arctica (Fig. 14—17). Die S tru k tu r is t bei allen dieselbe
zweifache, nämlich eine grobnetzförmige, die hervorgerufen wird durch Hochfaltungen der Wand,
und eine sehr z arte und feine Wabenstruktur (s. Fig. 13). Die netzförmige S tru k tu r t r i t t am
deutlichsten an der Spitze und den beiden Ringwülsten der Schale hervor. Von den beiden Ring-
wiilsten befindet sich einer nahe dem Mündungsrande, der zweite entweder ungefähr in der Mitte
der Schale (nur bei P. DrygalsTcii), oder aber in geringer Entfernung von dem ersten Ringe, also
noch im vorderen D rittel des Gehäuses (bei den anderen drei Arten). Die Zahl der kurzen
Zähnchen am Mündungsrande is t bei den vier Arten nicht wesentlich verschieden; sie beträgt
40 - 5 0 . Die einzelnen Arten unterscheiden sich durch die verschiedene Ausbildung des aboralen
Endes, durch die Grösse des Gehäuses und durch ih r Vorkommen.
1. P. acuta n. sp. Am Gehäuse ist ein conischer und allmählich verjüngter Spitzenteil
sehr deutlich abgesetzt von dem Wohnfach. Die Schale is t am zweiten Ringwulst noch etwas
weiter als am oberen Ring. Die stärkste Ausbauchung liegt also im vorderen D rittel des Gehäuses.
Länge 0,135—0,142 mm. Fundorte: Davis-Strasse 3. Ju n i 1892; Karajak-Fjord im Juli;
Plankton-Expedition Irminger See (23. Juli).
2. P. obtusa n. sp. (Fig. 15 und 13, Struktur). Die allgemeine Form is t ähnlich wie bei
der vorigen A rt, doch is t der Spitzenteil hier zu einem kleinen fast halbkugligen Gebilde abgerundet.
Der zweite Ringwulst liegt im vorderen D ritte l des Gehäuses. Die Schale is t an beiden
Ringen gleich weit. Länge 0,11—0,135 mm. Fundorte: Davis-Strasse 6. September 1893; Plankton
Expedition Labradorstrom an der Neufundlandbank (30. Juli).
3. P. DrygalsTcii n. sp. (Fig. 14). Gehäuse erheblich kleiner und verhältnismässig dicker
als bei den drei anderen Arten. Der zweite Ringwulst liegt fa st in der Mitte der Hülse, die
s tärkste Erweiterung am vorderen Ring. Der abgerundete Spitzenteil is t hier noch weniger abgesetzt
und kürzer als bei P. obtusa. Länge 0,08—0,1 mm. Fundorte: Davis-Strasse 4. und
6. September 1893; Karajak-Fjord Oktober und November; Plankton-Expedition Labradorstrom
an der Neufundlandbank (30. Juli).