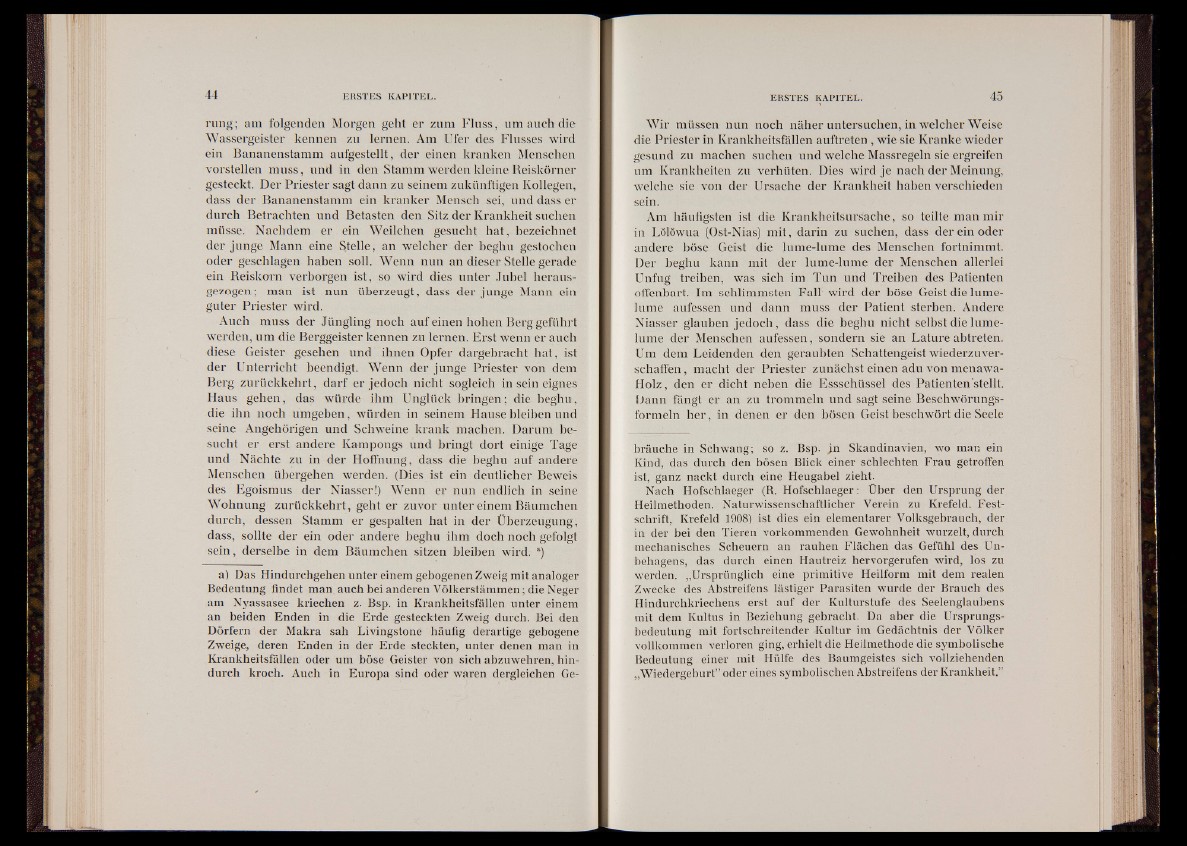
rang,; am folgenden Morgen geht er zum Fluss, um auch die
Wassergeister kennen zu lernen. Am Ufer des Flusses wird
ein Bananenstamm aufgestellt, der einen kranken Menschen
vorstellen m u ss, und in den Stamm werden kleine Reiskörner
gesteckt. Der Priester sagt dann zu seinem zukünftigen Kollegen,
dass der Bananenstamm ein kranker Mensch sei, und dass er
durch Betrachten und Betasten den Sitz der Krankheit suchen
müsse. Nachdem er ein Weilchen gesucht h a t, bezeichnet
der junge Mann eine Stelle, an welcher der beghu gestochen
oder geschlagen haben soll. Wenn nun an dieser Stelle gerade
ein Reiskorn verborgen ist, so wird dies unter Jubel herausgezogen;
man ist nun überzeugt, dass der junge Mann ein
guter Priester wird.
Auch muss der Jüngling noch auf einen hohen Berg geführt
werden, um die Berggeister kennen zu lernen. Erst wenn er auch
diese Geister gesehen und ihnen Opfer dargebracht h a t, ist
der Unterricht beendigt. Wenn der junge Priester von dem
Berg zurückkehrt, darf er jedoch nicht sogleich in sein eignes
Haus gehen, das würde ihm Unglück bringen; die beghu,
die ihn noch umgeben, würden in seinem Hause bleiben und
seine Angehörigen und Schweine krank machen. Darum besucht
er erst andere Kampongs und bringt dort einige Tage
und Nächte zu in der Hoffnung, dass die beghu auf andere
Menschen übergehen werden. (Dies ist ein deutlicher Beweis
des Egoismus der Niasser!) Wenn er nun endlich in seine
Wohnung zurückkehrt, geht er zuvor unter einem Bäumchen
durch, dessen Stamm er gespalten hat in der Überzeugung,
dass, sollte der ein oder andere beghu ihm doch noch gefolgt
sein, derselbe in dem Bäumchen sitzen bleiben wird. *)
a) Das Hindurchgehen unter einem gebogenen Zweig mit analoger
Bedeutung findet man auch bei anderen Völkerstämmen; die Neger
am Nyassasee kriechen z. Bsp. in Krankheitsfällen unter einem
an beiden Enden in die Erde gesteckten Zweig durch. Bei den
Dörfern der Makra sah Livingstone häufig derartige gebogene
Zweige, deren Enden in der Erde steckten, unter denen man in
Krankheitsfällen oder um böse Geister von sich abzuwehren, hindurch
kroch. Auch in Europa sind oder waren dergleichen Ge-
Wir müssen nun noch näher untersuchen, in welcher Weise
die Priester in Krankheitsfällen auftreten , wie sie Kranke wieder
gesund zu machen suchen und welche Massregeln sie ergreifen
um Krankheiten zu verhüten. Dies wird je nach der Meinung,
welche sie von der Ursache der Krankheit haben verschieden
sein.
Am häufigsten ist die Krankheitsursache, so teilte man mir
in Lölöwua (Ost-Nias) m it, darin zu suchen, dass der ein oder
andere böse Geist die lume-lume des Menschen fortnimmt.
Der beghu kann mit der lume-lume der Menschen allerlei
Unfug treiben, was sich im Tun und Treiben des Patienten
offenbart. Im schlimmsten Fall wird der böse Geist die lume-
lume aufessen und dann muss der Patient sterben. Andere
Niasser glauben jedoch, dass die beghu nicht selbst die lume-
lume der Menschen aufessen, sondern sie an Lature abtreten.
Um dem Leidenden den geraubten Schattengeist wiederzuverschaffen
, macht der Priester zunächst einen adu von menawa-
Holz, den er dicht neben die Essschüssel des Patienten’stellt.
Dann fängt er an zu trommeln und sagt seine Beschwörungsformeln
h e r , in denen er den bösen Geist beschwört die Seele
bräuche in Schwang; so z. Bsp. jn Skandinavien, wo man ein
Kind, das durch den bösen Blick einer schlechten Frau getroffen
ist, ganz nackt durch eine Heugabel zieht.
Nach Hofschlaeger (R. Hofschlaeger: Über den Ursprung der
Heilmethoden. Naturwissenschaftlicher Verein zu Krefeld. Festschrift,
Krefeld 1908) ist dies ein elementarer Volksgebrauch, der
in der bei den Tieren vorkommenden Gewohnheit wurzelt, durch
mechanisches Scheuern an rauhen Flächen das Gefühl des Unbehagens,
das durch einen Hautreiz hervorgerufen wird, los zu
werden. „Ursprünglich eine primitive Heilform mit dem realen
Zwecke des Abstreifens lästiger Parasiten wurde der Brauch des
Hindurchkriechens erst auf der Kulturstufe des Seelenglaubens
mit dem Kultus in Beziehung gebracht. Da aber die Ursprungsbedeutung
mit fortschreitender Kultur im Gedächtnis der Völker
vollkommen verloren ging, erhielt die Heilmethode die symbolische
Bedeutung einer mit Hülfe des Baumgeistes sich vollziehenden
„Wiedergeburt” oder eines symbolischen Abstreifens der Krankheit.”