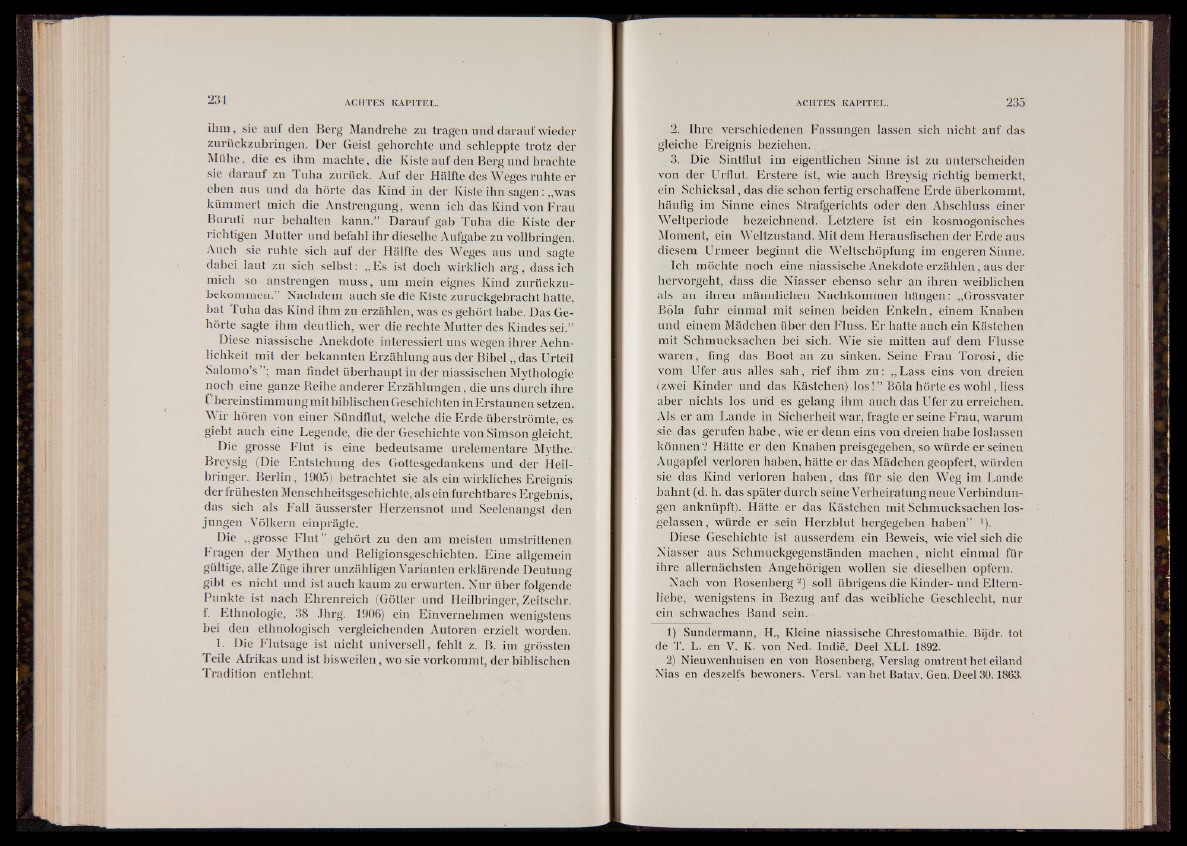
ihm , sie auf den Berg' Mandrehe zu tragen und darauf wieder
zurückzubringen. Der Geist gehorchte und schleppte trotz der
Mühe, die es ihm machte, die Kiste auf den Berg und brachte
sie darauf zu Tuha zurück. Auf der Hälfte des Weges ruhte er
eben aus und da hörte das Kind in der Kiste ihn sagen: „was
kümmert mich die Anstrengung, wenn ich das Kind von Frau
Buruti nur behalten kann.” Darauf gab Tuha die Kiste der
richtigen Mutter und befahl ihr dieselbe Aufgabe zu vollbringen.
Auch sie ruhte sich auf der Hälfte des Weges aus und sagte
dabei laut zu sich selbst: „ Es ist doch wirklich a rg , dass ich
mich so anstrengen muss, um mein eignes Kind zurückzubekommen.
’ Nachdem auch sie die Kiste zurückgebracht hatte,
bat Tuha das Kind ihm zu erzählen, was es gehört habe. Das Gehörte
sagte ihm deutlich, wer die rechte Mutter des Kindes sei.”
Diese niassische Anekdote interessiert uns wegen ihrer Aehn-
lichkeit mit der bekannten Erzählung aus der Bibel „das Urteil
Salomo’s ”; man findet überhaupt in der niassischen Mythologie
noch eine ganze Beihe anderer Erzählungen, die uns durch ihre
Übereinstimmung mit biblischen Geschichten in Erstaunen setzen.
Wir hören von einer Sündflut, welche die Erde überströmte; es
giebt auch eine Legende, die der Geschichte von Simson gleicht.
Die grosse Flut is eine bedeutsame urelementare Mythe.
Brevsig (Die Entstehung des Gottesgedankens und der Heilbringer.
Berlin, 1905) betrachtet sie als ein wirkliches Ereignis
der frühesten Menschheitsgeschichte, als ein furchtbares Ergebnis,
das sich als Fall äusserster Herzensnot und Seelenangst den
jungen Völkern einprägte.
Die „ grosse Flut ” gehört zu den am meisten umstrittenen
Fragen der Mythen und Beligionsgeschichten. Eine allgemein
gültige, alle Züge ihrer unzähligen Varianten erklärende Deutung
gibt es nicht und ist auch kaum zu erwarten. Nur über folgende
Punkte ist nach Ehrenreich (Götter und Heilbringer, Zeitschr.
f. Ethnologie, 38 Jhrg. 1906) ein Einvernehmen wenigstens
bei den ethnologisch vergleichenden Autoren erzielt worden.
1. Die Flutsage ist nicht universell, fehlt z. B. im grössten
Teile Afrikas und ist bisweilen, wo sie vorkommt, der biblischen
Tradition entlehnt.
2. Ihre verschiedenen Fassungen lassen sich nicht auf das
gleiche Ereignis beziehen.
3. Die Sintflut im eigentlichen Sinne ist zu unterscheiden
von der Urilut. Erstere ist, wie auch Breysig richtig bemerkt,
ein Schicksal, das die schon fertig erschaffene Erde überkommt,
häufig im Sinne eines Strafgerichts oder den Abschluss einer
Weltperiode bezeichnend. Letztere ist ein kosmogonisches
Moment, ein Weltzustand. Mit dem Herausfischen der Erde aus
diesem Urmeer beginnt die Weltschöpfung im engeren Sinne.
Ich möchte noch eine niassische Anekdote erzählen, aus der
hervorgeht, dass die Niasser ebenso sehr an ihren weiblichen
als an ihren männlichen Nachkommen hängen: „Grossvater
Bola fuhr einmal mit seinen beiden Enkeln, einem Ivnabeh
und einem Mädchen über den Fluss. Er hatte auch ein Kästchen
mit Schmucksachen bei sich. Wie sie mitten auf dem Flusse
waren, fing das Boot an zu sinken. Seine Frau Torosi, die
vom . Ufer aus alles s a h , rief ihm z u : „ Lass eins von dreien
(zwei Kinder und das Kästchen) lo s ! ” Böla hörte es w o h l, liess
aber nichts los und es gelang ihm auch das Ufer zu erreichen.
Als er am Lande in Sicherheit war, fragte er seine Frau, warum
sie das gerufen h ab e , wie er denn eins von dreien habe loslassen
können ? Hätte er den Knaben preisgegeben, so würde er seinen
Augapfel verloren haben, hätte er das Mädchen geopfert, würden
sie das Kind verloren haben, das für sie den Weg im Lande
bahnt (d. h. das später durch seine Verheiratung neue Verbindungen
anknüpft). Hätte er das Kästchen mit Schmucksachen losgelassen,
würde er sein Herzblut hergegeben haben” *)•
Diese Geschichte ist ausserdem ein Beweis, wie viel sich die
Niasser aus Schmuckgegenständen machen, nicht einmal für
ihre allernächsten Angehörigen wollen sie dieselben opfern.
Nach von Kosenberg 2) soll übrigens die Kinder- und Elternliebe,
wenigstens in Bezug auf das weibliche Geschlecht, nur
ein schwaches Band sein.
1) Sundermann, H., Kleine niassische Chrestomathie. Bijdr. tot
de T. L. en V. K. von Ned. Indie. Deel XLI. 1892.
2) Nieuwenhuisen en von Rosenberg, Verslag omtrent het eiland
Nias en deszelfs bewoners. Versl. van het Batav. Gen. Deel 30.1863.