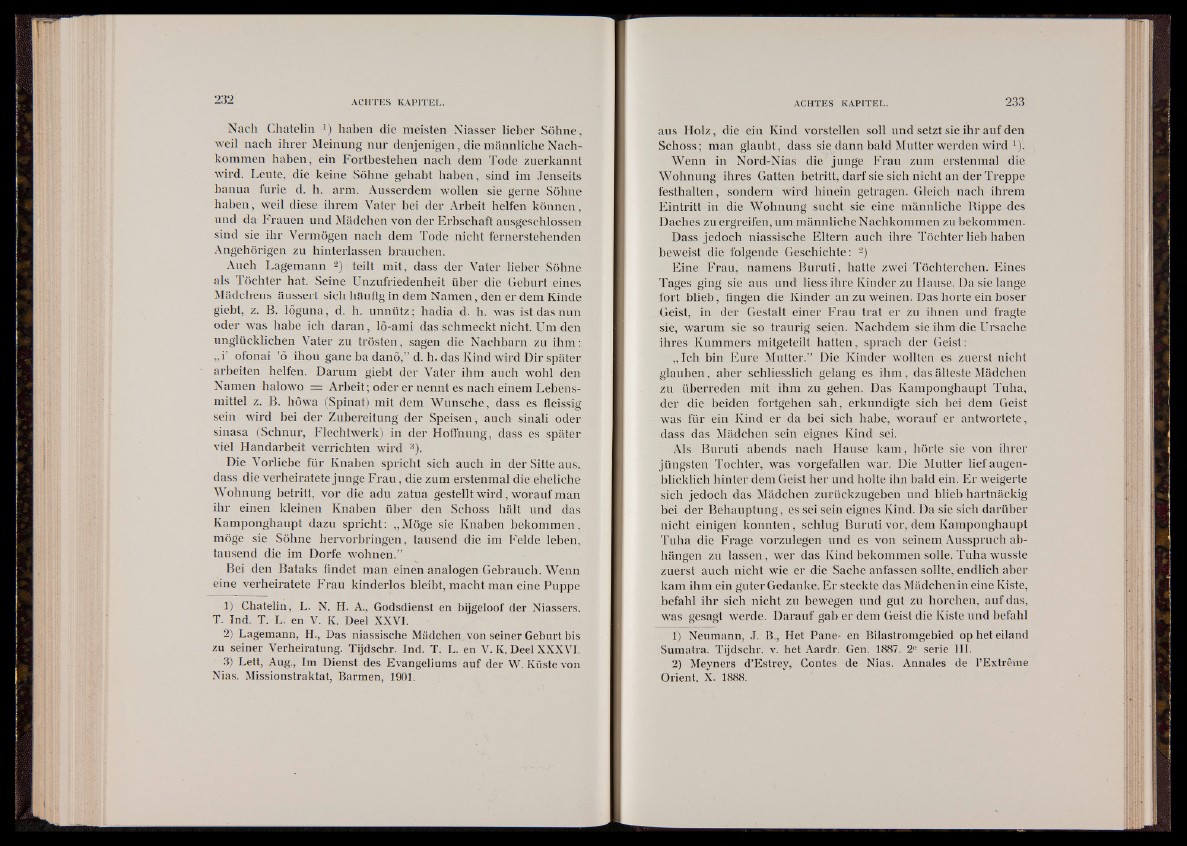
Nach Chatelin *) haben die meisten Niasser lieber Söhne,
weil nach ihrer Meinung n u r denjenigen, die männliche Nachkommen
haben, ein Fortbestehen nach dem Tode zuerkannt
wird. Leute, die keine Söhne gehabt haben, sind im Jenseits
banua furie d. h. arm. Ausserdem wollen sie gerne Söhne
haben, weil diese ihrem Vater bei der Arbeit helfen können,
und da Frauen und Mädchen von der Erbschaft ausgeschlossen
sind sie ih r Vermögen nach dem Tode nicht fernerstehenden
Angehörigen zu hinterlassen brauchen.
Auch Lagemann 2) teilt mit, dass der Vater lieber Söhne
als Töchter hat. Seine Unzufriedenheit über die Geburt eines
Mädchens äussert sich häufig in dem Namen, den er dem Kinde
giebt, z. B. löguna, d. h. unnütz; hadia d. h was ist das nun
oder was habe ich d aran, lö-ami das schmeckt nicht. Um den
unglücklichen Vater zu trösten, sagen die Nachbarn zu ihm :
„ f ofonai ’ö ihou gane ba danö,” d. h. das Kind wird Dir später
arbeiten helfen. Darum giebt der Vater ihm auch wohl den
Namen halowo = Arbeit; oder er nennt es nach einem Lebensmittel
z. B. höwa (Spinat) mit dem Wunsche, dass es fleissig
sein wird bei der Zubereitung der Speisen, auch sinali oder
sinasa (Schnur, Flechtwerk) in der Hoffnung, dass es später
viel Handarbeit verrichten wird s).
Die Vorliebe für Knaben spricht sich auch in der Sitte aus.
dass die verheiratete junge F r a u , die zum erstenmal die eheliche
Wohnung betritt, vor die adu zatua gestellt w ird , worauf man
ihr einen kleinen Knaben über den Schoss hält und das
Kamponghaupt dazu spricht: „Möge sie Knaben bekommen,
möge sie Söhne hervorbringen, tausend die im Felde leben,
tausend die im Dorfe wohnen.”
Bei den Bataks findet man einen analogen Gebrauch. Wenn
eine verheiratete Frau kinderlos bleibt, macht man eine Puppe
1) Chatelin, L. N. H. A., Godsdienst en bijgeloof der Niassers.
T. Ind. T. L. en V. K. Deel XXVI.
2) Lagemann, H., Das niassische Mädchen von seiner Geburt bis
zu seiner Verheiratung. Tijdschr. Ind. T. L. en V. K. Deel XXXVI.
3) Lett, Aug., Im Dienst des Evangeliums auf der W. Küste von
Nias. Missionstraktat, Barmen, 1901.
aus Holz, die ein Kind vorstellen soll und setzt sie ih r auf den
Schoss; man glaubt, dass sie dann bald Mutter werden wird 1).
Wenn in Nord-Nias die junge Frau zum erstenmal die
Wohnung ihres Gatten betritt, darf sie sich nicht an der Treppe
festhalten, sondern wird hinein getragen. Gleich nach ihrem
Eintritt in die Wohnung sucht sie eine männliche Kippe des
Daches zu ergreifen, um männliche Nachkommen zu bekommen.
Dass jedoch niassische Eltern auch ihre Töchter lieb haben
beweist die folgende Geschichte: 2)
Eine Frau, namens B u ru ti, hatte zwei Töchterchen. Eines
Tages ging sie aus und liess ihre Kinder zu Hause. Da sie lange
fort blieb, fingen die Kinder an zu weinen. Das hörte ein böser
Geist, in der Gestalt einer Frau trat er zu ihnen und fragte
sie, warum sie so traurig seien. Nachdem sie ihm die Ursache
ihres Kummers mitgeteilt hatten, sprach der Geist:
„ Ich bin Eure Mutter.” Die Kinder wollten es zuerst nicht
glauben, aber schliesslich gelang es ihm , das älteste Mädchen
zu überreden mit ihm zu gehen. Das Kamponghaupt Tuha,
der die beiden fortgehen sah, erkundigte sich bei dem Geist
was für ein Kind er da bei sich habe, worauf er antwortete,
dass das Mädchen sein eignes Kind sei.
Als Buruti abends nach Hause kam, hörte sie von ihrer
jüngsten Tochter, was vorgefallen war. Die Mutter lief augenblicklich
hinter dem Geist her und holte ihn bald ein. Er weigerte
sich jedoch das Mädchen zurückzugeben und blieb hartnäckig
bei der Behauptung, es sei sein eignes Kind. Da sie sich darüber
nicht einigen k o nnten, schlug Buruti vor, dem Kamponghaupt
Tuha die Frage vorzulegen und es von seinem Ausspruch ab-
hängen zu lassen, wer das Kind bekommen solle. Tuha wusste
zuerst auch nicht wie er die Sache anfassen sollte, endlich aber
kam ihm ein guter Gedanke. E r steckte das Mädchenin eine Kiste,
befahl ih r sich nicht zu bewegen und gut zu horchen, auf das,
was gesagt werde. Darauf gab er dem Geist die Kiste und befahl
1) Neumann, J. B., Het Pane- en Bilastromgebied opheteiland
Sumatra. Tijdschr. v. het Aardr. Gen. 1887. 2e serie III.
2) Meyners d’Estrey, Contes de Nias. Annales de l’Extrême
Orient. X. 1888.