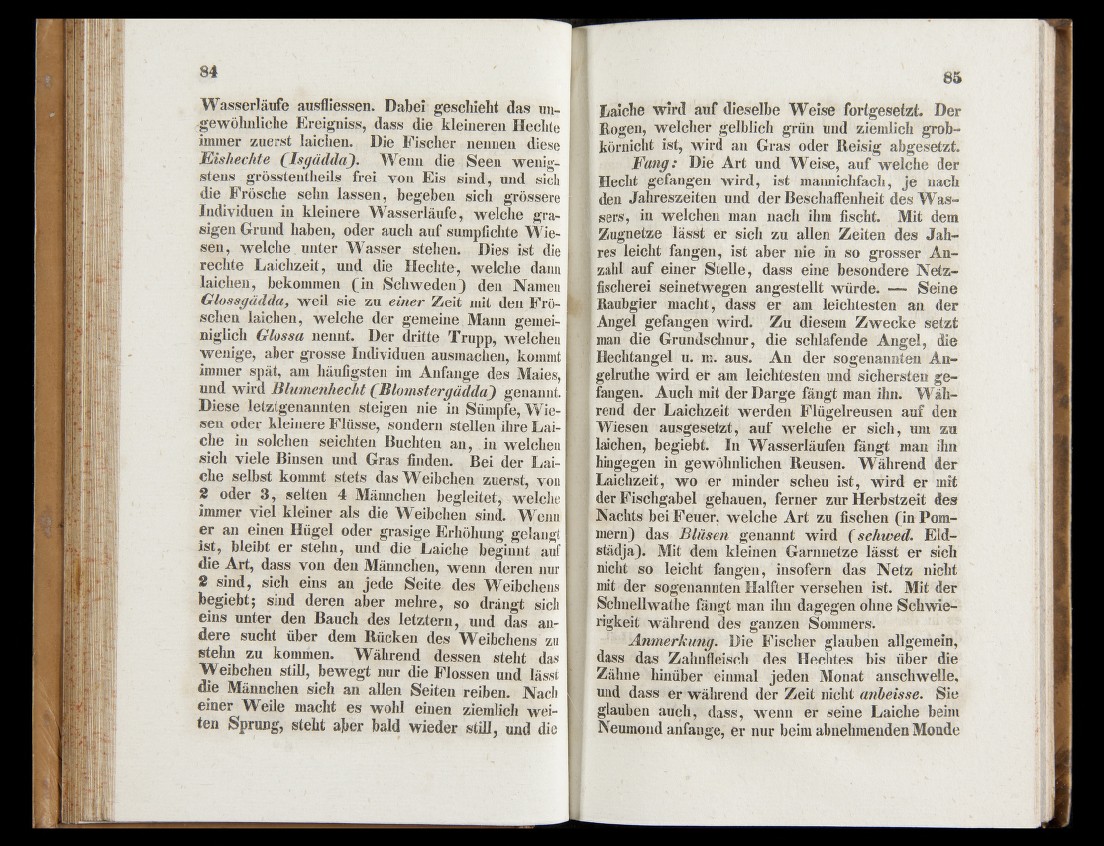
Wasserläufe ausfliessen. Dabei geschieht das ungewöhnliche
Ereigniss, dass die kleineren Hechte
immer zuerst laichen. Die Fischer nennen diese
Eisheckte QIsgädda)* Wenn die Seen wenigstens
grösstentheils frei von Eis sind, und;, sich
die Frösche sehn lassen, begeben sich grössere
Individuen in kleinere Wasserläufe, welche grasigen
Grund haben, oder auch auf sumpfichte Wiesen,
welche , unter Wasser stehen. Dies ist die
rechte Laichzeit, und. die Hechte-, welche dann
laichen, bekommen (in Schweden) den »Namen
Glossgädda, weil sie zu einer Zeit mit den Fröschen
laichen, welche der gemeine. Mann gemeiniglich
Glossa nennt* Der dritte Trupp, welchen
wenige, aber grosse Individuen ausmachen, kommt
immer spät, am häufigsten im Anfänge des Maies,
und wird Blumenhecht (Blomstergädda) genannt.
Diese letztgenannten steigen nie in Sümpfe, Wiesen
oder kleinere Flüsse, sondern stellen ihre Laiche
in solchen seichten Buchten an, in welchen
sich viele Binsen und Gras finden. Bei der Laiche
selbst kommt stets das Weibchen zuerst, von
2 oder 3 , selten 4 Männchen begleitet,^ welche
immer viel kleiner als die Weibchen sind. A^enn
er an einen Hügel oder grasige Erhöhung gelangt
ist, bleibt er stehn, und die Laiche beginnt auf
die Art, dass von den Männchen, wenn deren nur
2 sind, sich eins an jede Seite, des Weibchens
begiebt; sind deren aber mehre, so drängt sich
eins unter den Bauch des letztem, und das andere
sucht über dem Rücken des Weibchens zu
stehn zu kommen. Während dessen steht das
Weibchen still, bewegt nur die Flossen und -lässt
die Männchen sich an allen {Seiten reiben. Nach
einer Weile macht es wohl einen ziemlich weiten
Sprung, steht aber bald wieder still, und die
I Laiche wird auf dieselbe Weise fortgesetzt. Der I Rogen, welcher gelblich grün und ziemlich grob-
I körnicht ist, wird an Gras oder Reisig abgesetzt.
Fang: Die Art und Weise, auf welche der I Hecht gefangen wird, ist mannichfach, je nach
I den Jahreszeiten und der Beschaffenheit des W as-
I sers, in welchen man nach ihm fischt. Mit dem
i Zugnetze läs^t fer sich zu allen Zeiten des Jah-
I res leicht fangen, ist aber nie , in so grosser An-
I zahl auf einer Stelle, dass eine besondere Netz-
I fischerei seinetwegen angestellt würde. — Seine
■ Raubgier macht , dass er am leichtesten an der
■ Angel gefangen wird; Zu diesem Zwecke setzt
I man die Grundschnur, die schlafende Angel, die
I Hechtangel u. m. aus. An der sogenannten An-
I gelrutlie wird ei* am leichtesten und sichersten ge-
I fangen. Auch mit der Darge fangt man ihn. Wäh-
I rend der Laichzeit werden Flügelreusen auf den
I Miesen ausgesetzt , auf welche er sich , um zu
I laichen, begiebt. In Wasserläufen fängt man ihn
I hingegen in gewöhnlichen Reusen. Während der
I Laichzeit, wo er minder scheu ist, wird er mit
I der Fischgabel gehauen, ferner zur Herbstzeit des I Nachts bei Feuer, welche Art zu fisehen (inPom-
I mern) das Blusen genannt wird ( sehtved. Eld-
I städja). Mit dem kleinen Garnnetze lässt er sich
I nicht so leicht fangen, insofern das Netz nicht
I mit der sogenannten Halfter versehen ist. Mit der
I Schnellwathe fängt man ihn dagegen ohne Sehwie-
j rigkeit während des ganzen Sommers.
Anmerkung. Die Fischer glauben allgemein,
dass das Zahnfleisch des Hechtes bis über die
I Zähne hinüber' einmal jeden Monat anschwelle,
und dass er während der Zeit nicht anheisse. Sie
glauben auch, dass, wenn er seine Laiche beim
Neumond anfange, er nur beim abnehmenden Monde