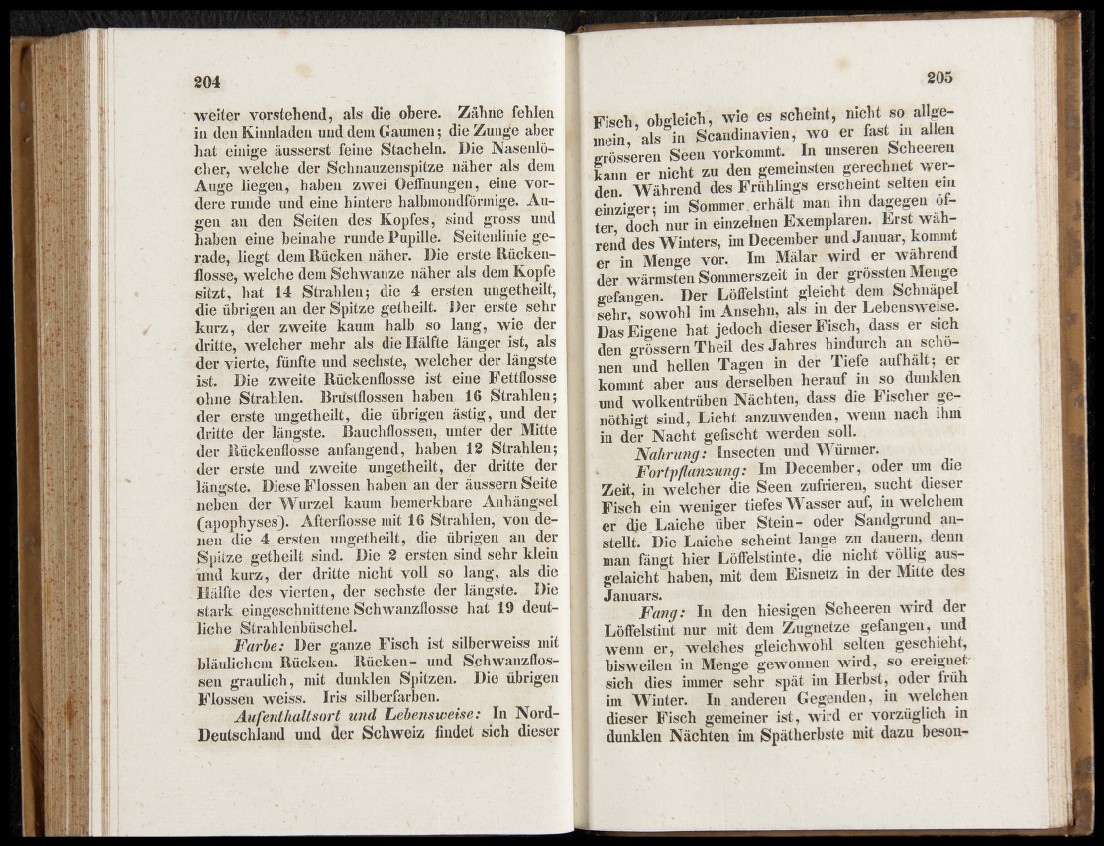
weiter vorstehend, als die obere. Zähne fehlen
in den Kinnladen und dein Gaumen; die Zungje aber I
hat einige äusserst feine Stacheln. Die Nasenlö- I
eher, welche der Schnauzenspitze näher als dem I
Auge liegen, haben zwei Oeffnungen, eine vor- I
dere ruiide und eine hintere halbmondförmige. Au- I
gen au den Seiten des Kopfes sind gross und I
haben eine beinahe runde Pupille. Seitenlinie ge- I
rade, liegt dem Rücken näher. Die erste-Rücken- I
flösse, welche dem Schwänze näher als dem Kopfe
sitzt, hat 14 Strahlen; die 4 ersten ungeteilt,
die übrigen an der Spitze getheilt. Der erste sehr
kurz, der zweite kaum halb so lang, wie der
dritte, welcher mehr als die Hälfte länger ist, als
der vierte, fünfte und sechste, welcher der längste
ist. Die zweite Rückenflosse ist eine Fettflosse
ohne Strahlen. Brifslflossen haben 16 Strahlen;
der erste ungetheilt, die übrigen ästig, und der I
dritte der längste. Bauchflossen, unter der Mitte
der Rückenflosse anfangend, haben 12 Strahlen; I
der erste, und zweite ungetheilt, der dritte der I
längste. Diese Flossen haben an der aussern Seite
neben der Wurzel kaum bemerkbare Anhängsel I
(apophyses). Afterflosse mit 16 Strählen, von de- J
neu die 4. ersten ungetheilt, die übrigen an der
Spitze getheilt sind. Die 2 ersten sind sehr klein
und kurz, der dritte nicht voll so lang, als die
Hälfte des vierten, der sechste der längste. Die
stark eingeschnittene Schwanzflosse hat 19 deutliche
Strahlenbüschel.
Farbe: Der ganze Fisch ist silberweiss mit
bläulichem Rücken. Rücken- und Schwanzflossen
graulich, mit dunklen Spitzen. Die übrigen
Flossen weiss. Iris silberfarben.
Aufenthaltsort und Lebensweise: In Nord-
Deutschland und der Schweiz findet sich dieser
Fisch, obgleich, wie es scheint, mcht so allge-
inein, als in Scandiuavien, wo er fast m allen
grösseren Seen vorkommt. In unseren ^Scheeren
kann er nicht zu den gemeinsten gerechnet wer-
den. Während des Frühlings erscheint selten ein
einziger: im Sommer, erhält man ihn dagegen öfter
doch nur in einzelnen Exemplaren. Erst wahrend
des Winters, im December und Januar, kommt
er in Menge vor. Im Mälar wird er wahrend
der wärmsten Sommerszeit in der grössten Menge
gefangen. Der Löffelstint gleicht dem Schnapel
sehr, sowohl im Ansehn, als in der Lebensweise.
Das Eigene hat jedoch dieser Fisch, dass er sich
den grossem Theil des Jahres hindurch an schonen
und hellen Tagen in der Tiefe aufhält; er
kommt aber aus derselben herauf m so dunklen
und wolkentrüben Nächten, dass die Fischer ge-
nöthigt sind, Licht anzuwenden, wenn nach ihm
in der Nacht gefischt werden soll.
Nahrung: Insecten und Würmer.
Fortpflanzung: Im December, oder um die
Zeit, in welcher die Seen zufrieren, sucht dieser
Fisch ein weniger tiefes Wasser auf, in welchem
er die Laiche über Stein- oder Sandgrund anstellt.
Die Laiche scheint lange zu dauern, denn
man fängt hier Löffelstinte, die nicht völlig aus-
gelaicht haben, mit dem Eisnetz in der Mitte des
Januars. , , ,
Fang: In den hiesigen Scheeren wird der
Löffelstint nur mit dem Zugnetze gefangen, und
wenn er, welches gleichwohl selten geschieht,
bisweilen in Menge gewonnen wird, so ereignet'
sich dies immer sehr spät im Herbst, oder früh
im Winter. In anderen Gegenden, in welchen
dieser Fisch gemeiner ist, wird er vorzüglich in
dunklen Nächten im Spätherbste mit dazu beson