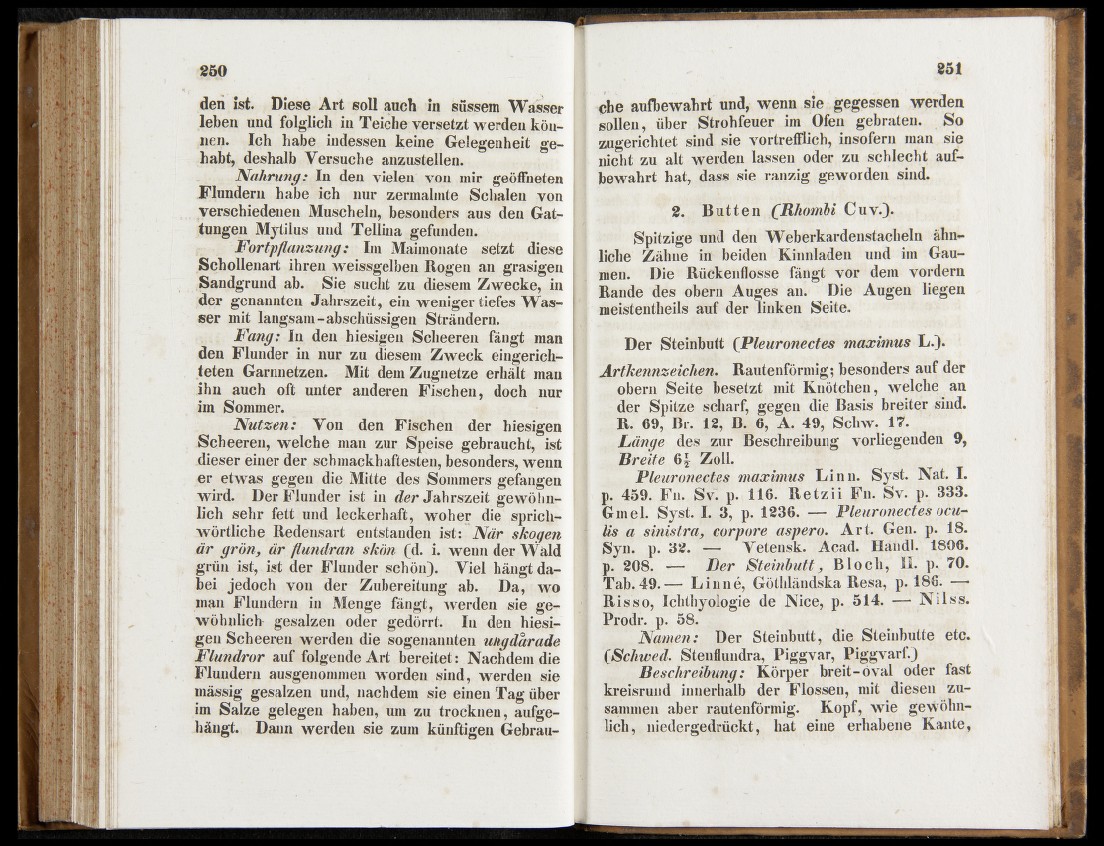
den ist. Diese Art soll auch in süssem Wässer
leben und folglich in Teiche versetzt werden können.
Ich habe indessen keine Gelegenheit gehabt,
deshalb Versuche anzustellen.
Nahrung: In den vielen von mir geöffneten
„Flundern habe ich nur zermalmte Schalen von
verschiedenen Muscheln, besonders aus den Gatr
tungeil Mytilus und Tellina gefunden.
Fortpflanzung: Im Maimonate setzt diese
Schollenart ihren weissgelben Rogen an grasigen
Sandgrund ab. Sie sucht zu diesem Zwecke, in
der genannten Jahrszeit, ein weniger tiefes Wasser
mit langsam - abschüssigen Strändern.
Fang: In den hiesigen Scheeren fängt man
den Flunder in nur zu diesem Zweck eingerichteten
Garnnetzen. Mit dem Zugnetze erhält man
ihn auch oft unter anderen Fischen, doch nur
im Sommer.
Nutzen: Von den Fischen der hiesigen
Scheeren, welche man zur Speise gebraucht, ist
dieser einer der schmackhaftesten, besonders, wenn
er etwas gegen die Mitte des Sommers gefangen
wird. Der Flunder ist in der Jahrszeit gewöhnlich
sehr fett und leckerhaft, woher die sprichwörtliche
Redensart entstanden ist: skogen
är grön, ur flundran skön (d. i. wenn der Wald
grün ist, ist der Flunder schön). Viel hängt dabei
jedoch von der Zubereitung ab. Da, wo
man Flundern in Menge fängt, werden sie gewöhnlich
gesalzen oder gedörrt. In den hiesigen
Scheeren werden die sogenannten ungdarade
Flundror auf folgende Art bereitet: Nachdem die
Flundern ausgenommen worden sind, werden sie
mässig gesalzen und, nachdem sie einen Tag über
im Salze gelegen haben, um zu trocknen, aufgehängt.
Dann werden sie zum künftigen Gebrauehe
aufbewahrt und, wenn sie gegessen werden
sollen, über Strohfeuer im Ofen gebraten. S o
zugericbtet sind sie vortrefflich, insofern man sie
nicht zu alt werden lassen oder zu schlecht auf-
j bewahrt hat, dass sie ranzig geworden sind.
2. But t en £Bhombi Cuv.).
Spitzige und den Weberkardenstacheln ähn-
U liehe Zähne ins beiden Kinnladen und im Gaumen.
Die Rückenflosse fängt vor dem vordem
Rande des obern Auges an. Die Augen liegen
meistentheiis auf der linken Seite.
Der Steinbutt fPleuronectes maximus L.).
I Artkennzeichen. Rautenförmig; besonders auf der
obern Seitp besetzt mit Knötchen, welche an
der Spitze scharf, gegen die Basis breiter sind.
R. 69, Br. 12, B. 6, Â. 49, Schw. 17.
Länge des zur Beschreibung vorliegenden 9,
Breite 6£ Zoll. t
Pleuronectes maximus Linn. Syst. Nat. I.
! p. 459. Fn. SV p. 116. R e t z i i Fn. Sv. p. 333.
Gmel. Syst. I. 3, p. 1236. — Pleuronectes ocu-
lis a sinisira, corpore aspero. Art. Gen. p. 18.
Syn. p. 32. — Vetensk. Acad. Han dl. 1806.
p. 208. — Der Steinbutt, Bloch, II. p. 70.
Tab. 49.— Linné, Göthländska Resa, p. 186. —*
Ris so, Ichthyologie de Nice, p. 514. —* N i l s s .
Prodr. p. 58.
Namen: Der Steinbutt, die Steinbutte etc.
(Schwed. Stenflundra, Piggvar, Piggvarf.)
Beschreibung : Körper breit-oval oder fast
kreisrund innerhalb der Flossen, mit diesen zusammen
aber rautenförmig. Kopf, wie gewöhn-
1 lieh, niedergedrückt, hat eine erhabene Kante,