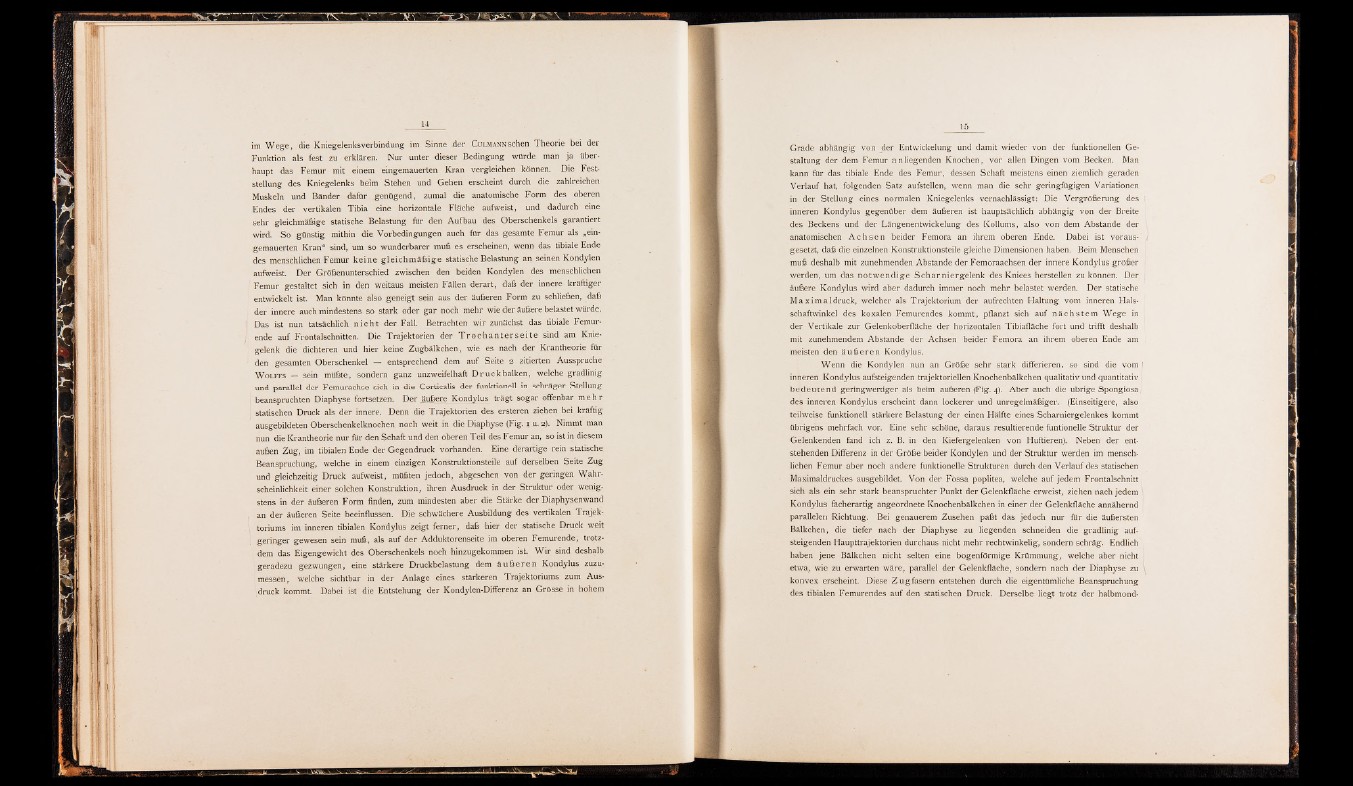
im W eg e , die Kniegelenksverbindung im Sinne -der C ulmannsehen Theorie bei der
Funktion als fest zu erklären. Nur unter dieser Bedingung würde man ja überhaupt
das Femur mit einem eingemauerten Kran vergleichen können. Die Feststellung
des Kniegelenks beim Stehen und Gehen erscheint durch die zahlreichen
Muskeln und Bänder dafür genügend, zumal die anatomische Form des oberen
Endes der vertikalen Tibia eine horizontale Fläche aufweist, und dadurch eine
sehr gleichmäßige statische Belastung für den Aufbau des Oberschenkels garantiert
wird. So günstig mithin die Vorbedingungen auch für das gesamte Femur als „eingemauerten
Kran" sind, um so wunderbarer muß es erscheinen, wenn das tibiale Ende
des menschlichen Femur k eine g le ic hm ä ß ig e statische Belastung an, seinen Kondylen
aufweist. Der Größenunterschied zwischen den beiden Kondylen des menschlichen
Femur gestaltet sich in den weitaus meisten Fällen derart, daß der innere kräftiger
entwickelt ist. Man könnte also geneigt sein aus der äußeren Form zu schließen, daß
der innere auch mindestens so stark oder gar noch mehr wie der äußere belastet würde.
Das ist nun tatsächlich n i c h t der Fall. Betrachten wir zunächst das tibiale Femurende
auf Frontalschnitten. Die Trajektorien der T r o c h a n t e r s e i t e sind am Kniegelenk
die dichteren und hier keine Zugbälkchen, wie es nach der Krantheorie für
den gesamten Oberschenkel — entsprechend dem auf Seite 2 zitierten Ausspruche
W ölffs — sein müßte, sondern ganz unzweifelhaft Druckba lk en, welche gradlinig
und parallel der Femurachse sich in die Corticalis der funktionell in schräger Stellung
| beanspruchten Diaphyse fortsetzen. Der äußere Kondylus trägt sogar offenbar m eh r
| statischen Druck als der innere. Denn die Trajektorien des ersteren ziehen bei kräftig
ausgebildeten Oberschenkelknochen noch weit in die Diaphyse (Fig. 1 u. 2). Nimmt man
nun die Krantheorie nur für den Schaft und den oberen T eil des Femur an, so ist in diesem
außen Zug, im tibialen Ende der Gegendruck vorhanden. Eine derartige rein statische^
Beanspruchung, welche in einem einzigen Konstruktionsteile auf derselben Seite Zug
und gleichzeitig Druck aufweist, müßten jedoch, abgesehen von der geringen Wahrscheinlichkeit
einer solchen Konstruktion, ihren Ausdruck in der Struktur oder wenigstens
in der äußeren Form finden, zum mindesten aber die Stärke der Diaphysenwand
an der äußeren Seite beeinflussen. Die schwächere Ausbildung des vertikalen Trajek-
toriums im inneren tibialen Kondylus zeigt ferner, daß hier der statische Druck weit
geringer gewesen sein muß, als auf der Adduktorenseite im oberen Femurende, trotzdem
das Eigengewicht des Oberschenkels noch hinzugekommen ist. W ir sind deshalb
geradezu gezwungen, eine stärkere Druckbelastung dem ä u ß e r e n Kondylus zuzumessen,
welche sichtbar in der Anlage eines stärkeren Trajektoriums zum Ausdruck
kommt. Dabei ist die Entstehung der Kondylen-Differenz an Grösse in hohem
Grade abhängig von der Entwickelung und damit wieder von der funktionellen Gestaltung
der dem Femur anliegenden Knochen, vor allen Dingen vom Becken. Man
kann für das tibiale Ende des Femur, dessen Schaft meistens einen ziemlich geraden
Verlauf hat, folgenden Satz aufstellen, wenn man die sehr geringfügigen Variationen
in der Stellung eines normalen Kniegelenks vernachlässigt: Die Vergrößerung des
inneren Kondylus gegenüber dem äußeren ist hauptsächlich abhängig von der Breite
des Beckens und der Längenentwickelung des Kollums, also von dem Abstande der
anatomischen A c h s e n beider Femora an ihrem oberen Ende. Dabei ist vorausgesetzt,
daß die einzelnen Konstruktionsteile gleiche Dimensionen haben. Beim Menschen
muß deshalb mit zunehmenden Abstande der Femoraachsen der innere Kondylus größer
werden, um das n o tw en d ig e Scharniergelenk des Kniees herstellen zu können. Der
äußere Kondylus wird aber dadurch immer noch mehr belastet werden. Der statische
M a x im a l druck, welcher als Trajektorium der aufrechten Haltung vom inneren Halsschaftwinkel
des koxalen Femurendes kommt, pflanzt sich auf n ä c h s t em Wege in
der Vertikale zur Gelenkoberfläche der horizontalen Tibiafläche fort und trifft deshalb
mit zunehmendem Abstande der Achsen beider Femora an ihrem oberen Ende am
meisten den ä u ß e r en Kondylus.
Wenn die Kondylen nun an Größe sehr stark differieren, so sind die vom
inneren Kondylus aufsteigenden trajektoriellen Knochenbälkchen qualitativ und quantitativ
bed eu ten d geringwertiger als beim äußeren (Fig. 4). Aber auch die übrige Spongiosa;
des inneren Kondylus erscheint dann lockerer und unregelmäßiger. (Einseitigere, also
teilweise funktionell stärkere Belastung der einen Hälfte eines Scharniergelenkes kommt
übrigens mehrfach vor. Eine sehr schöne, daraus resultierende funtionelle Struktur der
Gelenkenden fand ich z. B. in den Kiefergelenken von Huftieren). Neben der entstehenden
Differenz in der Größe beider Kondylen und der Struktur werden im menschlichen
Femur aber noch andere funktionelle Strukturen durch den Verlauf des statischen
Maximaldruckes ausgebildet. Von der Fössa poplitea, welche auf jedem Frontalschnitt
sich als ein sehr stark beanspruchter Punkt der Gelenkfläche erweist, ziehen nach jedem
Kondylus fächerartig angeordnete Knochenbälkchen in einer der Gelenkfläche annähernd
parallelen Richtung. Bei genauerem Zusehen paßt das jedoch nur für die äußersten
Bälkchen, die tiefer nach der Diaphyse zu liegenden schneiden die gradlinig aufsteigenden
Haupttrajektorien durchaus nicht mehr rechtwinkelig, sondern schräg. Endlich
haben jene Bälkchen nicht selten eine bogenförmige Krümmung, welche aber nicht
etwa, wie zu erwarten wäre, parallel der Gelenkfläche, sondern nach der Diaphyse zu
konvex erscheint. Diese Zu gfa sern entstehen durch die eigentümliche Beanspruchung
des tibialen Femurendes auf den statischen Druck. Derselbe liegt trotz der halbmond