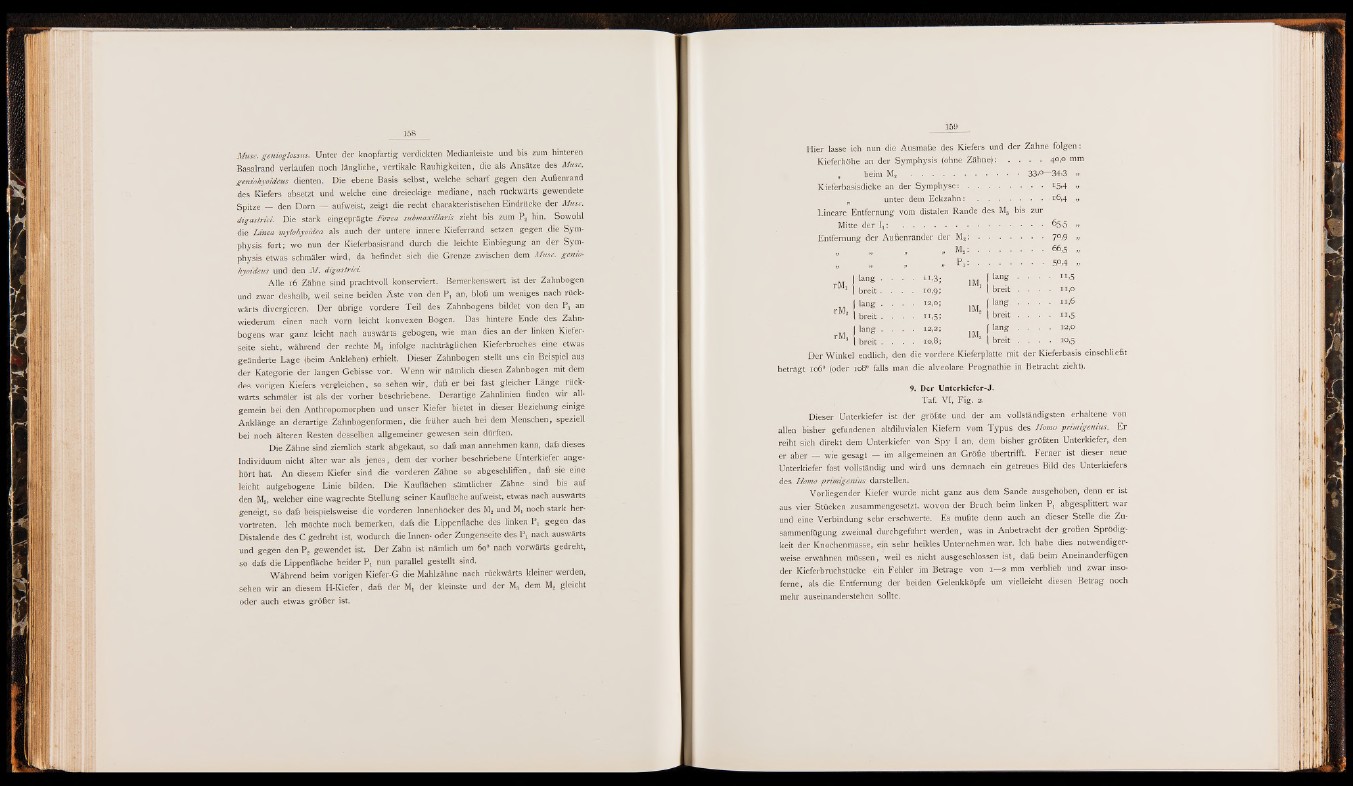
Muse, genioglossus. Unter der knopfartig verdickten Medianleiste und bis zum hinteren
Basalrand verlaufen noch längliche, vertikale Rauhigkeiten, die als Ansätze des Muse,
geniohyoideus dienten. Die ebene Basis selbst, welche scharf gegen den Außenrand
des Kiefers absetzt und welche eine dreieckige mediane, nach rückwärts gewendete
Spitze — den Dorn — aufweist, zeigt die recht charakteristischen Eindrücke , der Muse,
digastrici. Die stark eingeprägte Fovea submaxülaris zieht bis zum P2 hin. Sowohl
die Linea mylohyoidea als auch der untere innere Kieferrand setzen gegen die Sym-
physis fort; wo nun der Kieferbasisrand durch die leichte Einbiegung an der Sym-
physis etwas schmäler wird, da befindet sich die Grenze zwischen dem Muse, geniohyoideus
und den M. digastrici.
Alle 16 Zähne sind prachtvoll konserviert. Bemerkenswert ist der Zahnbogen
und zwar deshalb, weil seine beiden Äste von den P, an, bloß um weniges nach rückwärts
divergieren. Der übrige vordere Teil des Zahnbogens bildet von den P, an
wiederum einen nach vorn leicht konvexen Bogen. Das hintere Ende des Zahnbogens
war ganz leicht nach auswärts gebogen, wie man dies an der linken Kieferseite
sieht, während der rechte M3 infolge nachträglichen Kieferbruches eine etwas
geänderte Lage (beim Ankleben) erhielt. Dieser Zahnbogen stellt uns ein Beispiel aus
der Kategorie der langen Gebisse vor. Wenn wir nämlich diesen Zahnbogen mit dem
des vorigen Kiefers vergleichen, so sehen wir, daß er bei fast gleicher Länge rückwärts
schmäler ist als der vorher beschriebene. Derartige Zahnlinien finden wir allgemein
bei den Anthropomorphen und unser Kiefer bietet in dieser Beziehung einige
Anklänge an derartige Zahnbogenformen, die früher auch bei dem Menschen, speziell
bei noch älteren Resten desselben allgemeiner gewesen “sein dürften.
Die Zähne sind ziemlich stark abgekaut, so daß man annehmen kann, daß dieses
Individuum nicht älter war als jenes, dem der vorher beschriebene Unterkiefer ange^
hört hat An diesem Kiefer sind die vorderen Zähne so abgeschliffen, daß sie eine
leicht aufgebogene Linie bilden. Die Kauflächen sämtlicher Zähne sind bis auf
den Ms, welcher eine wagrechte Stellung seiner Kaufläche aufweist, etwas nach auswärts
geneigt, so daß beispielsweise die vorderen Innenhöcker des M2 und Mx noch stark hervortreten.
Ich möchte noch bemerken, daß die Lippenfläche des linken Pi gegen das
Distalende des C gedreht ist, wodurch die Innen- oder Zungenseite des Px nach auswärts
und gegen den P2 gewendet ist. Der Zahn ist nämlich um 6o° nach vorwärts gedreht,
sö daß die Lippenfläche beider Pt nun parallel gestellt sind.
Während beim vorigen Kiefer-G die Mahlzähne nach rückwärts kleiner werden,
sehen wir an diesem H-Kiefer, daß der der kleinste und der M3 dem M2 gleicht
oder auch etwas größer ist.
Hier lasse ich nun die Ausmaße des Kiefers und der Zähne folgen:
Kieferhöhe an der Symphysis (ohne Zähne): . . . . 40,0 mm
„ beim M2 .................................... ..... 33>° 34>3. »
Kieferbasisdicke an der Symphyse: . . ,■ . • • • *5 4 »
n unter dem E c k z a h n : .....................-, • 16,4 „
Lineare Entfernung vom distalen Rande des M3 bis zur
Mitte der It : ......................................................... • • %>5 »
Entfernung der Außenränder der M3: ...............................7°»9 »
n „ „ M2: ............................... 66,5 „
„ „ „ „ P u ............................... 5°i4 »
I lang . ■ 1 ■ m im .
lang . . . • i i ,5
1 breit . . . . 10,9 breit . . . . 11,0
! lang . . . . 12,0
1M2
lang . . . . 11,6
1 breit . . . . 11,5 breit . . . • 11.5
1 lang . . . . 12,2
im3
lang . . . . 12,0
1 breit . . . . 10,8 breit . . . • 10,5
Der W inkel endlich, den die vordere Kieferplatte mit der Kieferbasis einschließt
beträgt 1060 (oder 1080 falls man die alveolare Prognathie in Betracht zieht),
9. Der Unterkiefer-J.
Taf. VI, Fig. 2.
Dieser Unterkiefer ist der größte und der am vollständigsten erhaltene von
allen bisher gefundenen altdiluvialen Kiefern vom Typus des Homo primigenius. Er
reiht sich direkt dem Unterkiefer von Spy I an, dem bisher größten Unterkiefer, den
er aber — wie gesagt — im allgemeinen an Größe übertrifft. Ferner ist dieser neue
Unterkiefer fast vollständig und wird uns demnach ein getreues Bild des Unterkiefers
des Homo primigenius darstellen.
Vorliegender Kiefer wurde nicht ganz aus dem Sande ausgehoben, denn er ist
aus vier Stücken zusammengesetzt, wovon der Bruch beim linken Pt abgesplittert war
und eine Verbindung sehr erschwerte. Es mußte denn auch an dieser Stelle die Zusammenfügung
zweimal durchgeführt werden, was in Anbetracht der großen Sprödigkeit
der Knochenmasse, ein sehr heikles Unternehmen war. Ich habe dies notwendigerweise
erwähnen müssen, weil es nicht ausgeschlossen ist, daß beim Aneinanderfügen
der Kieferbruchstücke ein Fehler im Betrage von 1—2 mm verblieb und zwar inso-
ferne, als die Entfernung der beiden Gelenkköpfe um vielleicht diesen Betrag noch
mehr auseinanderstehen sollte.