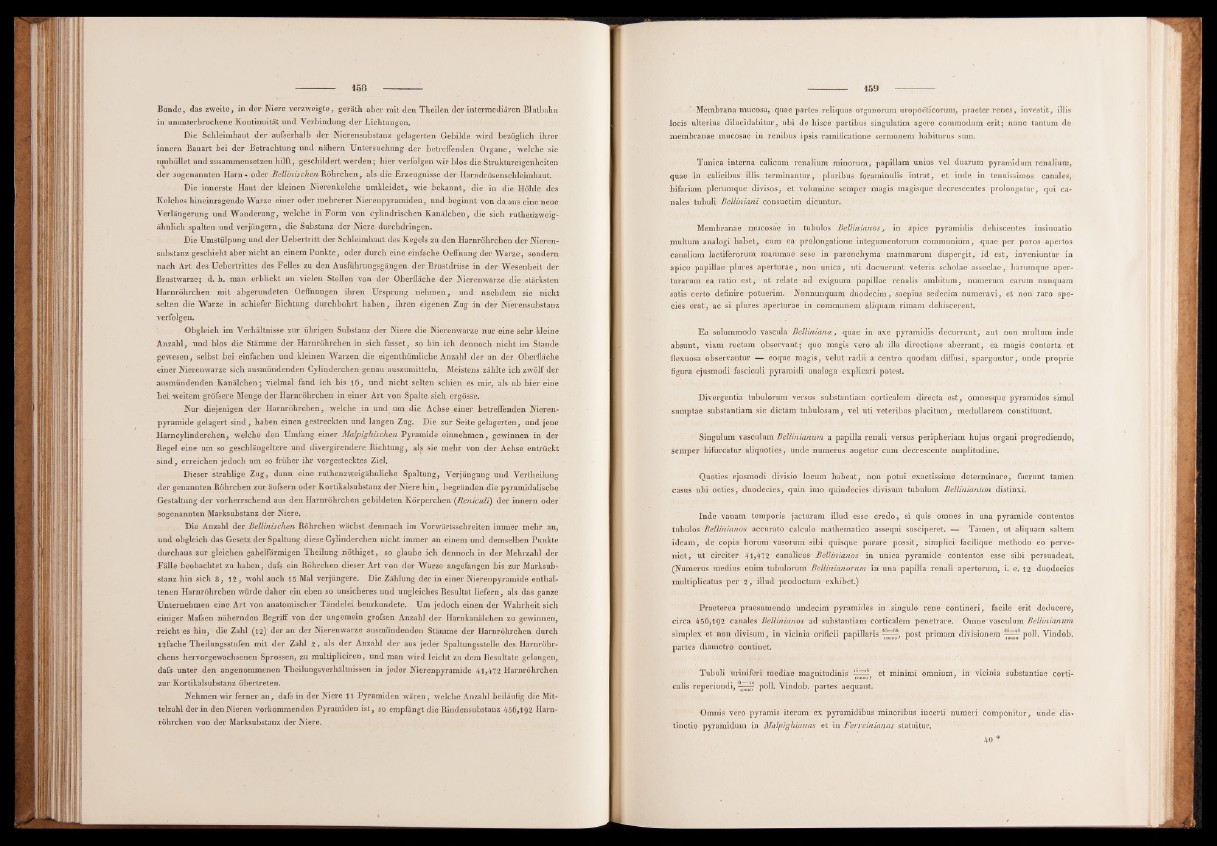
Bunde, das zweite, in der Niere verzweigte, gerätli aber mit den Theilen der intermediären Blutbabn
in ununterbrochene Kontinuität und Verbindung der Lichtungen.
Die Schleimhaut der aufserhalb der Nierensubstanz gelagerten Gebilde wird bezüglich ihrer
innern Bauart bei der Betrachtung und nähern Untersuchung der betreffenden Organe, 'welche sie
umhüllet und zusammensetzen hilft, geschildert werden; hier verfolgen wir blos die Struktureigenheiten
der sogenannten Harn- oder Bellinischen Röhrchen, als die Erzeugnisse der Harndrüsenschleimhaut.
Die innerste Haut der kleinen Nierenkelche umkleidet, wie bekannt, die in die Höhle des
Kelches liineinragende Warze einer oder mehrerer Nierenpyramiden, und beginnt von da aus eine neue
Verlängerung und Wanderung, welche in Form von cylindrischen Kanälchen, die sich rutherizweig-
ähnlich spalten und verjüngern, die Substanz der Niere durchdringen.
Die Umstülpung und der Uebertritt der Schleimhaut des Kegels zu den Harnröhrchen der Nierensubstanz
geschieht aber nicht an einem Punkte, oder durch eine einfache Oeffnung der Warze, sondern
nach Art des Uebertrittes des Felles zu den Ausführungsgängen der Brustdrüse in der Wesenheit der
Brustwarze; d. h. man erblickt an vielen Stellen von der Oberfläche der Nierenwarze die stärksten
Harnröhrchen mit abgerundeten Oeffnungen ihren Ursprung nehmen, und nachdem sie nicht
selten die Warze in schiefer Richtung durchbohrt haben, ihren eigenen Zug in der Nierensubstanz
verfolgen.
Obgleich im Verhältnisse zur übrigen Substanz der Niere die Nierenwarze nur eine sehr kleine
Anzahl, und blos die Stämme der Harnröhrchen in sich fasset, so bin ich dennoch nicht im Stande
gewesen, selbst bei einfachen und kleinen Warzen die eigenthümliche Anzahl der an der Oberfläche
einer Nierenwarze sich ausmündenden Cylinderchen-genau auszumitteln. Meistens zählte ich zwölf der
ausmündenden Kanälchen; vielmal fand ich bis 16, und nicht selten schien es mir, als ob hier eine
bei weitem gröfsere Menge der Harnröhrchen in einer Art von Spalte sich ergösse.
Nur diejenigen der Harnröhrchen, welche in und um die Achse einer betreffenden Nierenpyramide
gelagert sind, haben einen gestreckten und langen Zug. Die zur Seite gelagerten, und jene
Harncylinderchen, welche den Umfang einer Malpighischen Pyramide einnehmen, gewinnen in der
Regel eine um so geschlängeltere und divergirendere Richtung, als sie mehr von der Achse entrückt
sind , erreichen jedoch um so früher ihr vorgestecktes Ziel.
Dieser strahlige Zug, dann eine ruthenzweigähnliche Spaltung, Verjüngung und Vertheilung
der genannten Röhrchen zur äufsern oder Kortikalsubstanz der Niere hin, begründen die pyramidalische
Gestaltung der vorherrschend aus den Harnröhrchen gebildeten Körperchen (Reniculi) der innern oder
sogenannten Marksubstanz der Niere.
Die Anzahl der Bellinischen Röhrchen wächst demnach im Vorwärtsschreiten immer mehr an,
und obgleich das Gesetz der Spaltung diese Cylinderchen nicht immer an einem und demselben Punkte
durchaus zur gleichen gabelförmigen Theilung nöthiget, so glaube ich dennoch in der Mehrzahl der
Fälle beobachtet zu haben, dafs ein Röhrchen dieser Art von der Warze angefangen bis zur Marksubstanz
hin sich 8, 12 , wohl auch 15 Mal verjüngere. Die Zählung der in einer Nierenpyramide enthaltenen
Harnröhrchen würde daher ein eben so unsicheres und ungleiches Resultat liefern, als das ganze
Unternehmen eine Art von anatomischer Tändelei, beurkundete. Um jedoch einen der Wahrheit sich
einiger Mafsen nähernden Begriff von der ungemein grofsen Anzahl der Harnkanälchen zu gewinnen,
reicht es hin, die Zahl (12) der an der Nierenwarze ausmündenden Stämme der Harnröhrchen durch
12fache Theilungsstufen mit der Zahl 2> als der Anzahl der aus jeder Spaltungsstelle des HarnrÖhr-
chens hervorgewachsenen Sprossen, zu multipliciren, und man wird leicht zu dem Resultate gelangen,
dafs unter den angenommenen Theilungsverhältmssen in jeder Nierenpyramide 41,472 Harnröhrchen
zur Kortikalsubstanz übertreten.
Nehmen wir ferner an, dafs in der Niere l l Pyramiden wären, welche Anzahl beiläufig die Mittelzahl
der in den Nieren vorkommenden Pyramiden ist, so empfängt die Rindensubstanz 456,192 Harn-
röhrchen von der Marksubstanz der Niere.
Membrana mucosa, quae partes reliquas organorum uropoëticorum, praeter renes, investit, illis
locis ulterius dilucidabitur, ubi de hisce partibus singulatim agere commodum erit; nunc tantum de
membranae mucosae in renibus ipsis ramificatione sermonem habiturus sum.
Tunica interna calicum renalium minorum, papillam unius vel duarum pyramidum renalium,
quae in calicibus illis terminantur, pluribus foraminulis intrat, et inde in tenuissimos canales,
bifariam plerumque divisos, et volumine semper magis magisque decrescentes prolongatur, qui canales
tubuli Belliniani consuetim dicuntur.
Membranae mucosae in tubulos Bellinianos in apice pyramidis dehiscentes insinuatio
multum analogi habet, cum ea prolongatione integumentorum communium, quae per poros apertos
canalium lactiferorum mammae sese in parenchyma mammarum dispergit, id est, inveniuntur in
apice papillae plures aperturae, non unica; uti docuerunt veteris scholae asseclae, harumque aper-
turarum ea ratio est, ut relate ad exiguum papillae renalis ambitum, numerum earum nunq.uam
satis certo definire potuerim. Nonnunquam duodecim, saepius sedecim numeravi, et non raro species
erat, ac si plures aperturae in communem aliquam rimam dehiscerent.
Ea solummodo vascula Belliniana j quae in axe pyramidis decurrunt, aut non multum inde
absunt, viam rectam observant; quo magis verb ab ilia directione aberrant, ea magis contorta et
. flexuosa observantur — eoque magis, velut radii a céntro quodam diffusi, sparguntur, unde proprie
figura ejusmodi fasciculi pyramidi analoga explicari potest.
Divergentia tubulorum versus substantiam corticalem directa est, omnesque pyramides simul
sumptae substantiam sic dictam tubulosam, vel uti veteribus placitum, medullarem constituunt.
Singulum vasculum Bellinianum a papilla renali versus peripheriam hujus organi progrediendo,
semper bifurcatur aliquoties, unde numerus augetur cum decrescente amplitudine.
Quoties ejusmodi divisio locum habeat, non potui exactissime determinare, fuerunt tarnen
casus ubi octies, duodecies, quin imo quindecies divisum tubulum Bellinianüm distinxi.
Inde vanam temporis jacturam illud esse credo, si quis omnes in una pyramide contentos
tubulos Bellinianos accurato calculo mathematico assequi susciperet. — Tamen, ut aliquam saltern
ideam, de copia horum vasorum sibi quisque parare possit, simplici facilique methodo eo perve-
niet, ut circiter 41,472 canalicos Bellinianos in unica pyramide contentos esse sibi persuadeal.
(Numerus medius enim tubulorum Bellinianorum in una papilla renali apertorum, i. e. 12 duodecies
multiplicatüs per 2 , illud productum exhibet.)
Praeterea praesumendo undecim pyramides in singulo rene contineri, facile erit deducere,
circa 456,192 canales Bellinianos ad substantiam corticalem penetrare. Omne vasculum Bellinianum
simplex et non divisum, in vicinia orificii papillaris post primam divisionem poll. Vindob.
partes diametro continet.
Tubuli uriniferi mediae magnitudinis ||||j| et minimi omnium, in vicinia substantiae corti-
calis reperiundi, poll. Vindob. partes aequant.
Omnis vero pyramis iterum ex pyramidibus minoribus incerti numeri componitur, unde dis-
tinctio pyramidum in Malpighianas et in Ferreinianas statuitur.