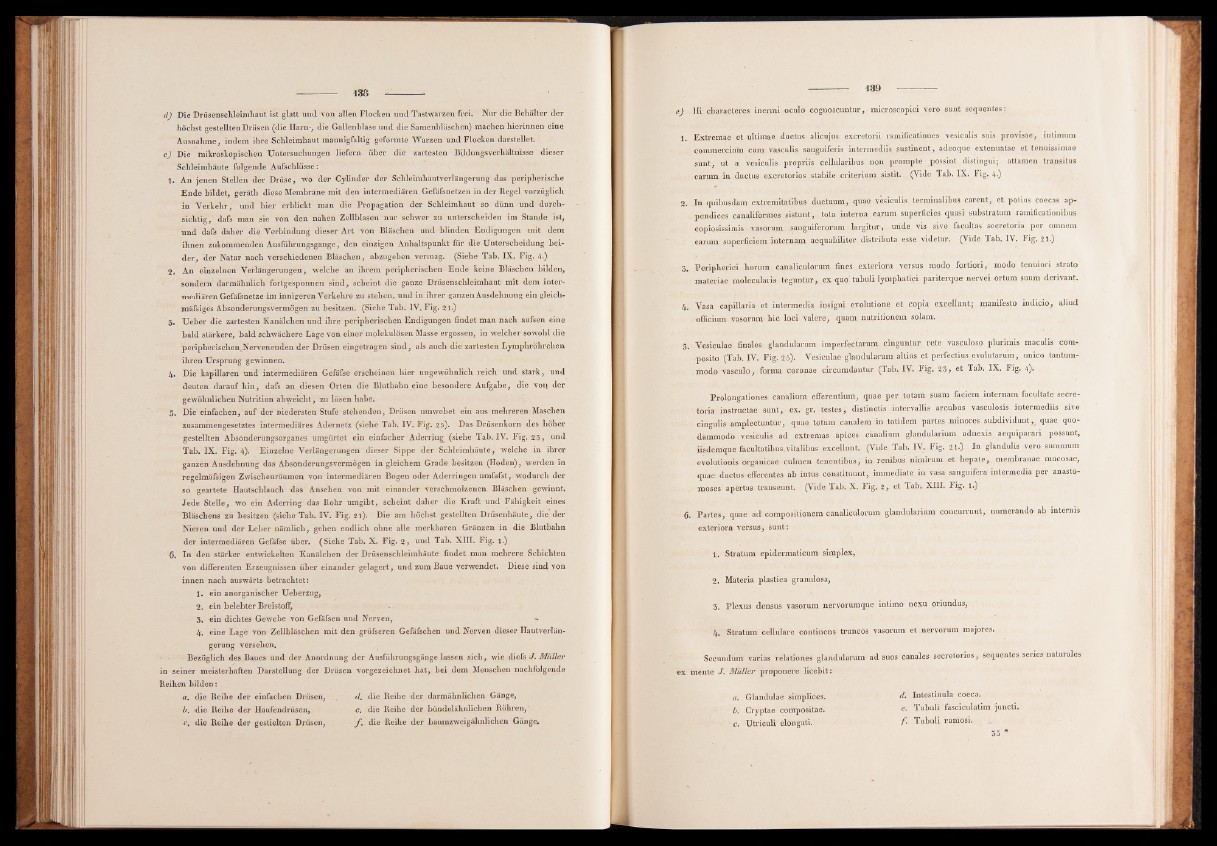
d) Die Drüsenschleimhaut ist glatt und von allen Flocken und Tast^arzen frei. Nur die Behälter der
höchst gestellten Drüsen (die Harn-, die Gallenblase und die Samenbläschen) machen hierinnen eine
Ausnahme, indem ihre Schleimhaut mannigfaltig geformte Warzen und Flocken darstellet.
e) Die mikroskopischen Untersuchungen liefern über die zartesten Bildungsverhältnisse dieser
Schleimhäute folgende Aufschlüsse:
1. An jenen Stellen der Drüse, wo der Cylinder der Schleiriihautverlängerung das peripherische
Ende bildet, geräth diese Membrane mit den intermediären Gefäfsnetzen in der Regel vorzüglich
in Verkehr, und hier erblickt man die Propagation der Schleimhaut so dünn und durchsichtig,
dafs man sie von den nahen Zellblasen nur schwer zu unterscheiden im Stande ist,
und dafs daher die Verbindung dieser Art von Bläschen und blinden Endigungen mit dem
ihnen zukommenden Ausführungsgange, den einzigen Anhaltspunkt für die Unterscheidung beider,
der Natur nach verschiedenen Bläschen, abzugeben vermag. (Siehe Tab. IX. Fig. 4-.)
2. An einzelnen Verlängerungen, welche an ihrem peripherischen Ende keine Bläschen bilden,
sondern darmähnlich fortgesponnen sind, scheint die ganze Drüsenschleimhaut mit dem intermediären
Gelafsnetze im innigeren Verkehre zu stehen, und in ihrer ganzen Ausdehnung ein gleicli-
mäfsiges Absonderungsvermögen zu besitzen. (Siehe Tab. IV. Fig. 21.)
3. Ueber die zartesten Kanälchen und ihre peripherischen Endigungen findet man nach aufsen eine
bald stärkere, bald schwächere Lage von einer molekulösen Masse ergossen, in welcher sowohl die
peripherischen.Nervenenden der Drüsen eingetragen sind, als auch die zartesten LymphrÖhrchen
ihren Ursprung gewinnen.
4. Die kapillaren und intermediären Gefafse erscheinen hier ungewöhnlich reich und stark, und
deuten- darauf h in , dafs an diesen Orten die Blutbahn eine besondere Aufgabe, die von der
gewöhnlichen Nutrition abweicht, zu lösen habe,.
5. Die einfachen, auf der niedersten Stufe stehenden, Drüsen umwebet ein aus mehreren Maschen
zusammengesetztes intermediäres Adernetz (siehe Tab. IV. Fig. 2ö). Das Drüsenkorn des höher
gestellten Absonderungsorganes umgürtet ein einfacher Aderring^ (siehe Tab. IV. Fig. 23, und
Tab. IX. Fig. 4). Einzelne Verlängerungen dieser Sippe der Schleimhäute, welche in ihrer
ganzen Ausdehnung das Absonderungsvermögen in gleichem Grade besitzen (Hoden), werden in
regelmäfsigen Zwischenräumen von intermediären Bogen oder Aderringen umfafst, wodurch der
so geartete Hautschlauch das Ansehen von mit einander verschmolzenen Bläschen gewinnt.
Jede Stelle, wo ein Aderring das Rohr umgibt, scheint daher die Kraft und Fähigkeit eines
Bläschens zu besitzen (siehe Tab. IV. Fig. 2l). Die am höchst gestellten Drüsenhäute, die der
Nieren und der Leber nämlich, gehen endlich ohne alle merkbaren Gränzen in die Blutbahn
der intermediären Gefafse über. (Siehe Tab. X. Fig. 2, und Tab. XIII. Fig. 1.)
' 6. In den stärker entwickelten Kanälchen der Drüsenschleimhäute findet man mehrere Schichten
von differenten Erzeugnissen über einander gelagert, und zum Baue verwendet. Diese sind Yon
innen nach auswärts betrachtet:
1. ein anorganischer Ueberzug,
2. ein belebter Breistoff,
3. ein dichtes Gewebe von Gefäfsen und Nerven,
J(. eine Lage von Zellbläschen mit den gröfseren Gefäfschen und Nerven dieser Hautverlängerung
versehen.
Bezüglich des Baues und der Anordnung der Ausführungsgänge lassen sich, wie diefs / . Müller
in seiner meisterhaften Darstellung der Drüsen vorgezeichnet hat, bei dem Menschen nachfolgende
Reihen bilden:
a. die Reihe der einfachen Drüsen, d. die Reihe der darmähnlichen Gänge,
b. ‘die Reihe der Haufendrüsen, e. die Reihe der bündelähnlichen Röhren,'
c. die Reihe der gestielten Drüsen, f , die Reihe der baumzweigähnlichen Gänge*
e ) Hi characteres inermi oculo cognoscuntur, microscopici vero sunt sequentes:
1. Extremae et ultimae ductus alicujus excretörii ramificationes Yesiculis suis provisae, intimum
commerciu'm cum vasculis sanguiferis intermedns sustinent, adeoque extenuatae et tenuissimae
sunt, ut a vesicülis propriis cellularibus non prompte possint distingui; attamen transitus
. earum in ductus excretorios stabile criterium sistit. (Vide Tab. IX. Fig. 4.)
2. In quibusdam extremitatibus ductuum, quae vesicülis terminalibus carent, et potius coecas appendices
canaliformes sistunt, tota interna earum superficies quasi substratum ramificationibus
copiösissimis vasorum sanguiferorum largitur, unde vis .sive facultas secretoria per omnera
earum superficiem intern am aequabiliter distributa esse videtur. (Vide Tab. IV. Fig. 21.)
3. Peripherici horum canaliculorum fines exteriora versus modo fortiori, modo tenuiori strato
materiae molecularis teguntur, ex quo tubuli lymphatici pariterque nervei ortum suum derivant.
4. Vasa capillaria et intermedia insigni evolutione et copia excelluntj manifesto indicio, aliud
officium vasorum hic loci valere, quam nutritionem solam.
5. Vesiculae finales glandularum imperfectarum cinguntur rete vasculoso plurimis maculis composite
(Tab. IV. Fig. 25). Vesiculae glandularum altius et perfectius evolutarum, unico tantum-
modo vasculo, forma coronae circumdantur (Tab. IV. Fig. 23, et Tab. IX. Fig. 4).
Prolongationes canalium efferentium, quae per totam suam faciem internam facultate secretoria
instructae sunt, ex. gr. testes, distinctis intervallis arcubus vasculosis intermediis sive
cingulis amplectuntur, quae totum canalem in totidem partes minores subdividunt,, quae quo-
dammodo vesicülis ad extremes apices canalium glandularium adnexis aequiparari possunt,
iisdemque facultatibus.vitalibus excellunt. (Vide Tab. IV. Fig. 21.) In glandulis vero summum
evolutionis organicae culmen tenentibus, in renibus nimirum et hepate, membranae mucosae,
quae ductus efferentes ab intus constituunt, immediate in vasa sanguifera intermedia per anasto-
, moses apertas transeunt. (Vide Tab. X. Fig. 2 , et Tab. XIII. Fig. 1.)
ß. Partes, quae ad compositionem canaliculorum glandularium concurrunt, numerando ab internis
exteriora versus, sunt:
1. Stratum epidermaticum simplex,
2. Materia plastica granulo.sa,
3. Plexus densus vasorum nervorumque intimo nexu oriundus,
4. Stratum cellulare continens truncos vasorum et nervorum majores.
Secundum varias relationes glandularum ad suos canales secretorios, sequentes series naturales
ex mente /. Müller proponere licebit:
Glandulae simplices. d. Intestinüla coeca.
b. Cryptae compositae. e. Tubuli fasciculatim juncti.
. c. Utriculi elongati. /• Tubuli ramosi.