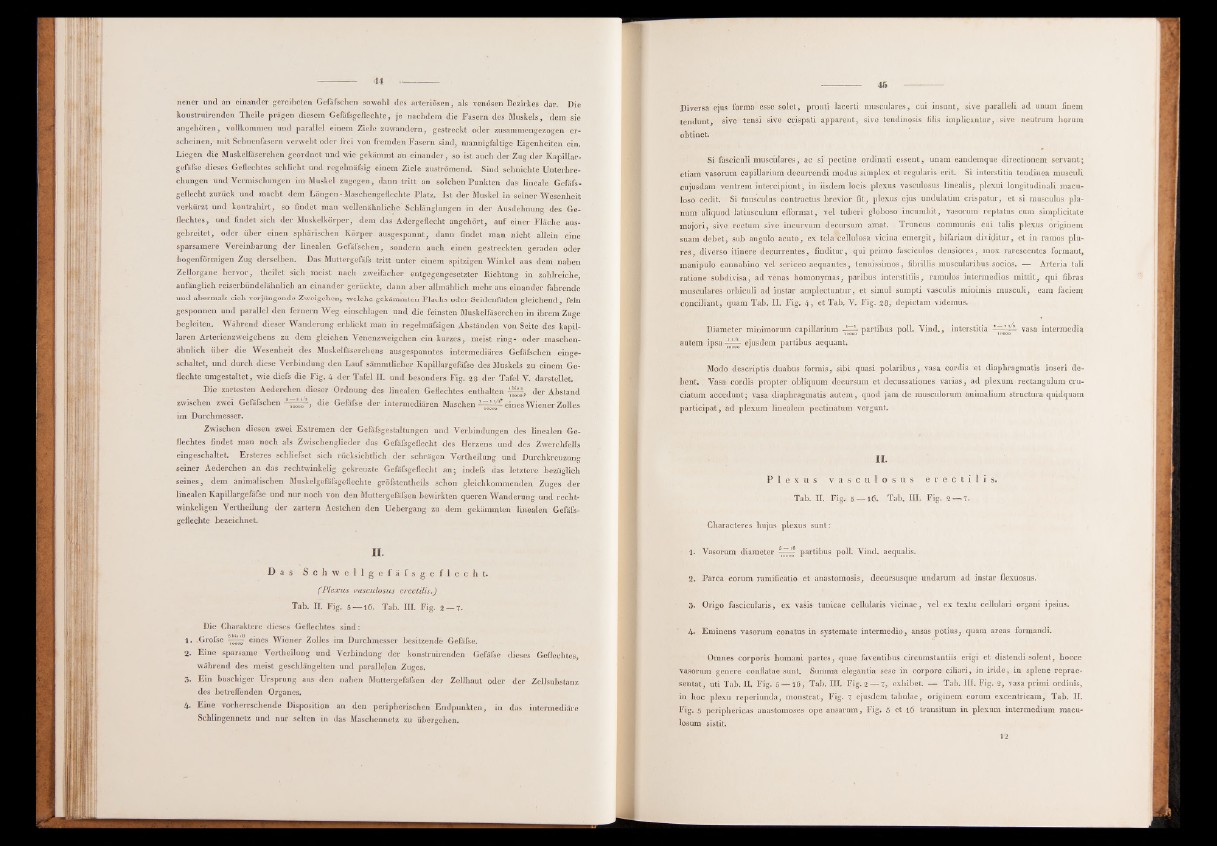
nener und an einander gereiheten Gefäfschen sowohl des arteriösen, als venösen Bezirkes dar. Die
konstruirenden Theile prägen diesem Gefafsgeflechte, je nachdem die Fasern des Muskels, dem sie
angehören, vollkommen und parallel einem Ziele zuwandern, gestreckt oder zusammengezogen erscheinen,
mit Sehnenfasern verweht oder frei von fremden Fasern sind, mannigfaltige Eigenheiten ein.
Liegen die Muskelfaserchen geordnet und wie gekämmt an einander, so ist auch der Zug der Kapillar,
gefäfse dieses Geflechtes schlicht und regelmäfsig einem Ziele zuströmend. Sind sehnichte Unterbrechungen
und Vermischungen im Muskel zugegen, dann tritt an solchen Punkten das lineale Gefafs-
gefleclit zurück und macht dem Längen - Maschengeflechte Platz. Ist der Muskel in seiner Wesenheit
verkürzt und kontrahirt, so findet man wellenähnliche Schlänglungen in der Ausdehnung des Geflechtes,
und findet sich der Muskelkörper, dem das Adergeflecht angehört, auf einer Fläche ausgebreitet,
oder über einen sphärischen Körper ausgespannt, dann findet man nicht allein eine
sparsamere Vereinbarung der linealen Gefäfschen, sondern auch einen gestreckten geraden oder
bogenförmigen Zug derselben. Das Muttergefäfs tritt unter einem spitzigen Winkel aus dem nahen
Zellorgane hervor, theilet sich, meist nach zweifacher entgegengesetzter Richtung in zahlreiche,
anfänglich reiserbündelähnlich an einander gerückte, dann aber allmählich mehr aus einander fahrende
und abermals sich verjüngende Zweigehen, welche gekämmten Flachs oder Seidenfäden gleichend, fein
gesponnen und parallel den fernem Weg einschlagen und die feinsten Muskelfäserchen in ihrem Zuge
begleiten. Während dieser Wanderung erblickt man in regelmäfsigen Abständen von Seite des kapillaren
Arterienzweigehens zu dem gleichen Venenzweigehen ein kurzes, meist ring- oder maschenähnlich
über die Wesenheit des Muskelfaserchens ausgespanntes intermediäres Gefäfschen eingeschaltet,
und durch diese Verbindung den Lauf sämmtlicher Kapillargefafse des Muskels zu einem Geflechte
umgestaltet, wie diefs die Fig. 4 der Tafel II. und besonders Fig. 28 der Tafel V. darstellet.
Die zartesten Aederchen dieser Ordnung des linealen Geflechtes enthalten der Abstand
zwischen zwei Gefäfschen -^=^1, die Gefäfse der intermediären Maschen eines Wiener Zolles
im Durchmesser.
Zwischen diesen zwei Extremen der Gefäfsgestaltungen und Verbindungen des linealen Geflechtes
findet man noch als Zwischenglieder das Gefäfsgeflecht des Herzens und des Zwerchfells
eingeschaltet Ersteres schliefset sich rücksichtlich der schrägen Vertheilung und Durchkreuzung
seiner Aederchen an das rechtwinkelig gekreuzte Gefäfsgeflecht an; indefs das letztere bezüglich
seines, dem animalischen Muskelgefäfsgeflechte gröfstentheils schon gleichkommenden Zuges der
linealen Kapillargefafse und nur noch von den Muttergefäfsen bewirkten queren Wanderung und rechtwinkeligen
Vertheilung der zartem Aestchen den Uebergang zu dem gekämmten linealen Gefäfs-
geflechte bezeichnet.
II.
Da s Sch w e l l g e f ä f s g e f l e c h t .
(Plexus vasculosus erectilis.)
Tab. II. Fig. 5 — 16. Tab. III. Fig. 2 — 7.
Die Charaktere dieses Geflechtes sind:
1 . .Grofse 5ioo~oo° eines Wiener Zolles im Durchmesser besitzende Gefälse.
2. Eine sparsame Vertheilung und Verbindung der konstruirenden Gefäfse dieses Geflechtes
während des meist geschlängelten und parallelen Zuges.
3. Ein buschiger Ursprung aus den nahen Muttergefäfsen der Zellhaut oder der Zellsubstanz
des betreffenden Organes.
4. Eine vorherrschende Disposition an den peripherischen Endpunkten, in das intermediäre
Schlingennetz und nur selten in das Maschennetz zu übergehen.
Diversa ejus forma'esse solet, prouti lacerti musculares, cui insunt, sive paralleli ad unum finem
tendunt, sive tensi sive crispati apparent, sive tendinosis filis implicantur, sive neutrum horum
obtinet.
Si fasciculi musculares, ac si pectine ordinati essent, unam eandemque directionem servant;
etiam vasorum capillarium decurrendi modus simplex et regularis erit. Si interstitia tendinea musculi
cujusdam ventrem intercipiunt, in iisdem locis plexus vasculosus linealis, plexui longitudinali macu-
loso cedit. Si fnusculus contractus brevior fit, plexus ejus undulatim crispatur, et si musculus planum
aliquod latiusculum efformat, vel tuberi globoso incumbit, vasorum reptatus cum simplicitate
majori, siye rectum' sive incurvum decursum am at. Truncus communis cui talis plexus originem
suam debet, sub angulo acuto, ex tela cellulosa vicina emergit, bifariam dividitur, et in ramos plu-
res, di verso itinere decurrentes, finditur, qui primo fascicules densiores, mox rarescentes formant,
manipulo cannabino vel sericeo aequantes, tenuissimos, fihrillis muscularibus socios. — Arteria tali
ratione subdivisa, ad vénas homonymas, paribus interstitiis, ramulos intermedios mittit, qui fibras
musculares orbiculi ad instar amplectuntur, et simul sumpti vasculis minimis musculi, earn faciem
conciliant, quam Tab. II. Fig. 4 , et Tab. V. Fig. 28, depictam videmus.
Diameter minimorum capillarium ■ l~a- partibus poll. Vind., interstitia - vasa intermedia
autem ipsa 'o'^a ejusdem partibus aequant.
Modo descriptis duabus formis, sibi quasi polaribus, vasa cordis et diaphragmatis inseri de-
b ent,, Vasa cordis propter obliquum decursum et decussationes varias, ad plexum rectangulum cru-
ciatum accedunt; vasa diaphragmatis autem, quod jam de musculorum animalium structura quidquam
participât, ad plexum linealem pectinatum vergunt.
II.
P l e x u s v a s c u l o s u s e r e c t i l i s .
Tab. II. Fig.- 5 — 16. Tab. HI. Fig. 2 — 7.
Characteres hujus plexus sunt:
1. Vasorum diameter partibus poll. Vind. aequalis.
2. Parca eorum ramificatio et anastomosis, decursusque undarum ad instar flexuosus.
3. Origo fascicularis, ex vasis tunicae cellularis vicinae, vel ex textu cellulari organi ipsius.
4* Eminens vasorum conatus in systemate intermedio, ansas potius, quam areas formandi.
Omnes corporis humani partes, quae faventibus circumstantiis erigi et distendi solent, hocce
vasorum genere conflatae sunt. Summa elegantia sese in corpore ciliari, in iride, in splene reprae-
sentat, uti Tab. II. Fig. 5 — 16, Tab. III. Fig. 2 — 7, exhibet. — Tab. III. Fig. 2, vasa primi ordinis,
in hoc plexu reperiunda, monstrat, Fig. 7 ejusdem tabulae, originem eorum excentricam, Tab. H.
Fig. 5 periphericas anastomoses ope ansarum, Fig. 5 et 16 transitum in plexum intermedium macu-
losum sistit.