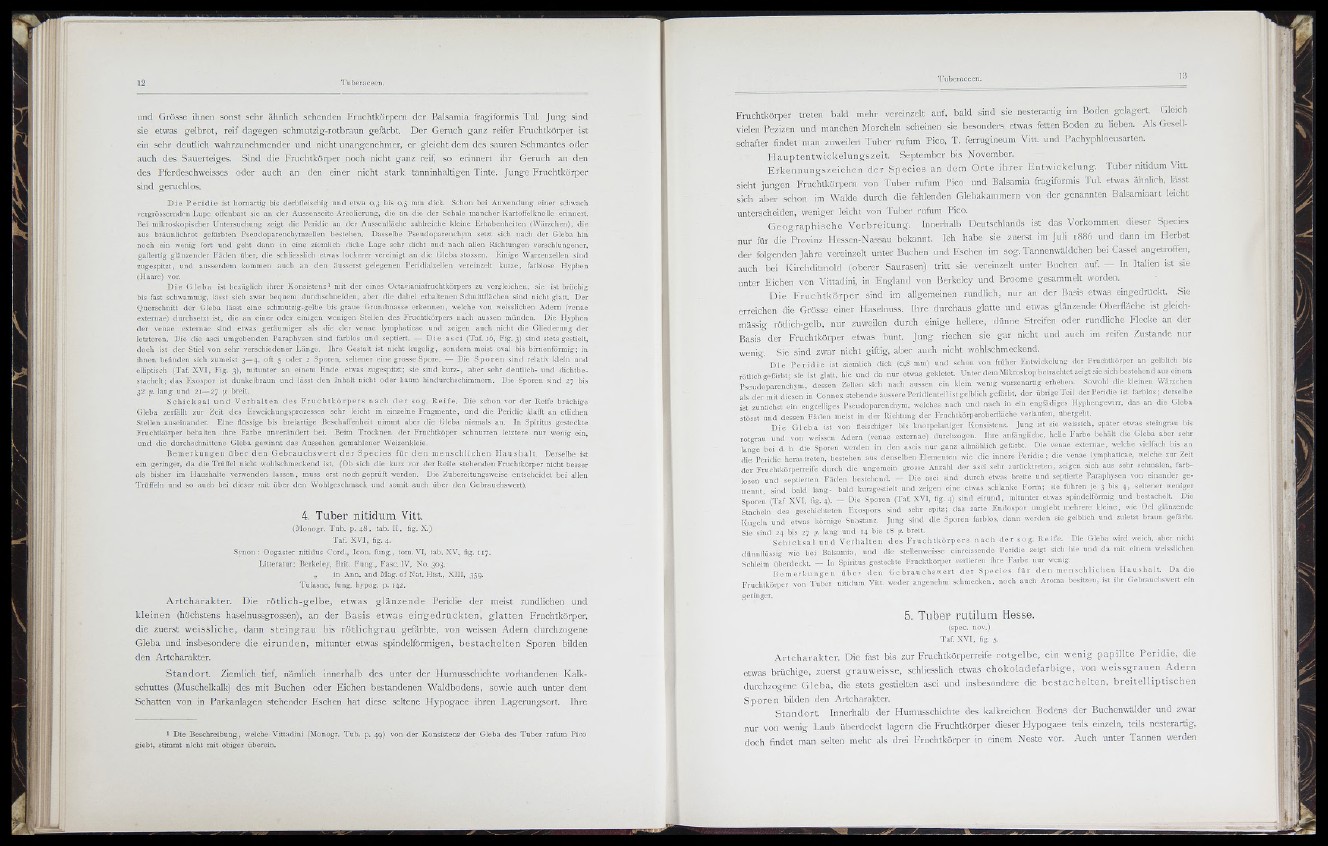
und Grösse ihnen sonst sehr ähnlich sehenden Fruchtkörpern der Balsamia fragiformis Tul. Jung sind
sie etwas gelbrot, reif dagegen schmutzig-rotbraun gefärbt. Der Geruch ganz reifer Fruchtkörper ist
ein sehr deutlich wahrzunehmender und nicht unangenehmer, er gleicht dem des sauren Schmantes oder
auch des Sauerteiges. Sind die Fruchtkörper noch nicht ganz reif, so erinnert ihr Geruch an den
des Pferdeschweisses oder auch an den einer nicht stark, tanninhaltigen Tinte. Junge Fruchtkörper
sind geruchlos.
Die P e r id ie ist hornartig bis derbfleischig und etwa 0,3 bis 0,5 mm dick. Schon bei Anwendung einer scliwach
vergrösserndon Lupe offenbart sie an der Aussenseite Areolierung, die an die der Schale mancher Kartoffelknolle erinnert.
Bei mikroskopischer Untersuchung zeigt die Peridie an der Aussenfläche zahlreiche kleine Erhabenheiten (Wärzchen), die
aus bräunlichrot gefärbten Pseudoparenchymzellen bestehen. Dasselbe Pseudoparenchym setzt sich nach der Gleba hin
noch ein wenig fort und geht dann in eine ziemlich dicke Lage sehr dicht und nach allen Richtungen verschlungener,
gallertig glänzender Eäden über, tlie schliesslich etwas lockerer vereinigt an die Gleba stossen. Einige Warzenzellen sind
zugespitzt, und ausserdem kommen auch an den äusserst gelegenen Peridialzellen vereinzelt kurze, farblose Hyphen
(Haare) vor.
D ie C»leba ist bezüglich ihrer Konsistenz' mit der eines Octavianiafruchtkörpers zu vergleichen, sie ist brüchig
bis fast schwammig, lässt sich zwar bequem durchschneiden, aber die dabei erhaltenen Schnittflächen sind nicht glatt. Der
Querschnitt der Gleba lässt eine schmutzig-gelbe bis graue Giundmasse erkennen, welche von weisslichen Adern (venae
externae) durchsetzt ist, die an einer oder einigen wenigen Stellen des Fruchtkörpers nach aussen münden. Die Hyphen
der venae externae sind etwas geräumiger als die der venae lymphaticae und zeigen auch nicht die Gliederung der
letzteren. Die die asci umgebenden Paraphysen sind farblos uud septiert. — D ie a s c i (Taf. 16, Fig. 3) sind stets gestielt,
doch ist der Stiel von sehr verschiedener Länge. Ihre Gestalt ist nicht kugelig, sondern meist oval bis birnenförmig; in
ihnen befinden sich zumeist 3—4, oft 5 oder 2 Sporen, seltener eine grosse Spore. — Die Sp o ren sind relativ klein und
elliptisch (Taf. XVI, Fig. 3), mitunter an einem Ende etwas zugespitzt; sie sind kurz-, aber sehr deutlich- und dichtbe-
stachelt; das Exospor ist dunkelbraun und lässt den Inhalt nicht oder kaum hindurchschimmern, Die Sporen sind 27 bis
32 y. lang uud 2 1—27 y. breit.
S c h ic k s a l und V e rh a lte n des F ru c h tk ö rp e r s nach d e r sog. R e ife , Die schon vor der Reife brüchige
Gleba zerfällt zur Zeit des Erweichungsprozesses sehr leicht in einzelne Fragmente, und die Peridie klafft an etlichen
Stellen auseinander. Eine flüssige bis breiartige Beschaffenheit nimmt aber die Gleba niemals an. In Spiritus gesteckte
Fruchtkörper behalten ihre Farbe unverändert bei. Beim Trocknen der Fruchtköper schnurren letztere nur wenig ein,
und die durchschnittene Gleba gewinnt das Aussehen gemahlener Weizenkleie.
Bemerkungen über den G eb rau ch sw e r t d er S p e c ie s für den menschlich en Haush alt. Derselbe ist
ein geringer, da die Trüffel nicht wohlschmeckend ist. (Ob sich die kurz vor der Reife stehenden Fruchtkörper nicht besser
als bisher im Haushalte verwenden lassen, muss erst noch geprüft werden. Die Zubereitungsweise entscheidet bei allen
Trüffeln und so auch bei dieser mit über den Wohlgeschmack und somit auch über den Gebrauchswert).
4. Tuber nitidum Vitt.
(Monogr. Tub. p. 48, tab. II, fig. X.)
Taf. XVI, fig. 4.
Synon: Oogaster nitidus Cord., Icon, fung., tom. VI, tab, XV, fig, 117.
Litteratur: Berkeley, Brit, Fung., Fase. IV, No. 303.
,, in .Ann. and Mag. of Nat. Hist., Xlll, 359.
Tulasne, fung. hypog. p. 142.
A r tch a r ak te r . Die rö tlic h -g e lb e , etwas g län z en d e Peridie der meist rundlichen und
kleinen (höchstens haselnussgrossen), an der B a s is e twas e in g ed rü ck te n , g la tte n Fruchtkörper,
die zuerst w e is s lich e , dann s te in g ra u bis rö tlich g rau gefärbte, von weissen Adern durchzogene
Gleba und insbesondere die e iru nd en, mitunter etwas spindelförmigen, b e s ta ch e lten Sporen bilden
den Artcharakter.
Stand o rt. Ziemlich tief, nämlich innerhalb des unter der Humusschichte vorhandenen Kalkschuttes
(Muschelkalk) des mit Buchen oder Eichen bestandenen Waldbodens, sowie auch unter dem
Schatten von in Parkanlagen stehender Eschen hat diese seltene Hypogaee ihren Lagerungsort. Ihre
1 Die Beschreibung, welche Vittadini (Monogr. Tub. p. 49) von der Konsistenz der Gieba des Tuber rufum Pico
giebt, stimmt nicht mit obiger überein.
Fruchtkörper treten bald mehr vereinzelt auf, bald sind sie nesterartig im Boden gelagert. Gleich
vielen Bezizen und manchen Morcheln scheinen sie besonders etwas fetten Boden zu lieben. Als Gesellschafter
findet man zuweilen Tuber rufum Pico, T. ferrugineum Vitt, und Pachyphloeusarten.
H au p ten tw ic k e lu n g sz e it. September bis November.
E rk en n u n g sze ich en der S p e c ie s an dem Orte ih re r E n tw ick e lu n g . 1 über nitidum Vitt,
sieht jungen Fruchtkörpern von Tuber rufum Pico und Balsamia fragiformis Tul. etwas ähnlirh, lasst
sich aber schon im Walde durch die fehlenden Glebakammern von der genannten Balsamiaart leicht
unterscheiden, weniger leicht von Tuber rufum Pico.
G e o g ra p h is c h e V e rb re itu n g . Innerhalb Deutschlands ist das Vorkommen dieser Species
nur für die Provinz Hessen-Nassau bekannt. Ich habe sie zuerst im Juli 1886 und dann im Herbst
der folgenden Jahre vereinzelt unter Buchen und FZschen im sog. Tannenwäldchen bei Cassel angetroffen,
auch bei Kirchditmold (oberer Saurasen) tritt sie vereinzelt unter Buchen auf. - ln Italien ist sie
unter Eichen von Vittadini, in England von Berkeley und Broome gesammelt worden.
D ie F'ru chtk ö rp e r sind im allgemeinen rundlich, nur an der Basis etwas eingedrückt. Sie
erreichen die Grösse einer Haselnuss. Ihre durchaus glatte und etwas glänzende Oberfläche ist gleich-
mässig rötlich-gelb, nur zuweilen durch einige hellere, dünne Streifen oder rundliche Hecke an der
Basis der Fruchtkörper etwas bunt. Jung riechen sie gar nicht und auch im reifen Zustande nur
wenig. Sie sind zwar nicht giftig, aber auch nicht wohlschmeckend.
D ie P e r id ie ist ziemlich dick (0,8 111111) und schon von früher Entivickelung der FruclitkÖr,ier an gelblidi bis
rötlich gefärbt; sie ist glatt, hie und da nur etwas gekleiet. Unter dem Mikroskop betrachtet zeigt sie sich bestehend aus einem
Pseudoparenchym, dessen Zellen sich nach ansseii ein klein wenig warzenartig erheben. Sowohl dio kleinen Wärzchen
als der mit diesen in Connex stehende äussere Peridienteil ist gelblich gefärbt, der übrige Teil der Peridie ist farblos; derselbe
ist zunächst ein engzelliges Psendoparenchym, welches nach und nach in ein eiigfädiges Hyphengewirr, das an die Gleba
stösst und dessen Fäden meist in der Richlimg der Fruditkorperoberflilche verlaufen, übergeht.
D ie G le b a ist von fleischiger bis knorpelatliger Konsistenz. Jung Ist sie weissich, spater etwas steingran bis
rotgran und von weissen Adern (venae externae) durchzogen. Ihre anfängliche, hello Farbe behält die Gleba aber sehr
lange bei d h die Sporen werden in den ascis nur ganz allmählich gefärbt. Die venae externae, welche vielfach b.s an
die Peridie hcrai treten, bestehen aus denselben Elementen wie die innere Peridie ; die venae lymphaticae, welche zur Zeit
der Fmchtkörperreife dnrch die ungemein grosse .inzahl der asd sehr zuräcktreten, zeigen sich ans sehr schmalen, farblosen
und septierten Fäden bestehend. - Die asci sind dnrch etwas breite und septierte Paraphysen von einander getrennt
sind bald lang- bald knrzgestielt nnd zeigen eine etwas schlanke Form; sie führen je 3 bis 4 , seltener weniger
Spore) (Taf XVI, flg. 4). — Die Sporen (Taf. XVI, flg. 4) sind eirnnd, mitunter etwas spindelförmig und bestachelt. Die
Stacheln des geldflchteten Exospors sind sehr spitz; das zarte Endospor umgiebt mehrere kleine, wie Oel glänzende
Kägeln nnd etwas körnige Snoslanz. Jung sind die Sporen farblos, dann werden sie gelblich und zuletzt braun gefärbt.
Sie sind 24 bis 27 ,n lang nnd 14 bis 18 ¡2. breit,
S c h ic k s a l und V e rh a lle n des F ru ch tk ö rp e r s nach der sog. Re ife. Die Gleba wird weich, aber mcht
dlinnllnasig wie bei Halsamia, und die stellenweisse einreissende Peridie zeigt sich hie nnd da mit einem weisslichen
Scläeim überdeckt. — In Spiritus gesteckte Frucktkörper verlieren ihre Farbe nur wenig.
B em e rk u n g en über den G eb rau ch sw e r t der Sp e c ie s für den mc nsch liehen II aus halt. Da die
Fruchtkörper von Tnber nitidum Vitt, weder angenehm schmecken .noch auch .Aroma besitzen, ist ihr Gehrauchswert ein
geringer.
5. Tubur rutilum Hesse.
(spec, nov.)
Taf. XVI, flg. 5.
A r tch a r a k te r . Die fast bis zur Fruchtkörperreife ro tg e lb e , ein w en ig p ap illte P e r id ie , die
etwas brüchige, zuerst g ra uw e is s e , schlies.slich etwas c h o k o la d e fa rb ig e , von w e is sg rau en A d e rn
durchzogene G leb a , die stets gestielten asci und insbesondere die b e s ta c h e lt e n , b r e it e llip t is c h e n
S p o re n bilden den Artcharakter.
S tand o rt. Innerhalb der Humusschichte des kalkreichen Bodens der Buchenwälder und zwar
nur von wenig Laub überdeckt lagern die Fruchtkörper dieser Hypogaee teils einzeln, teils nesterartig,
doch findet miin selten mehr als drei Fruchtkörper in einem Neste vor. Auch unter Tannen werden
t <1
111 i l l
I
- T j