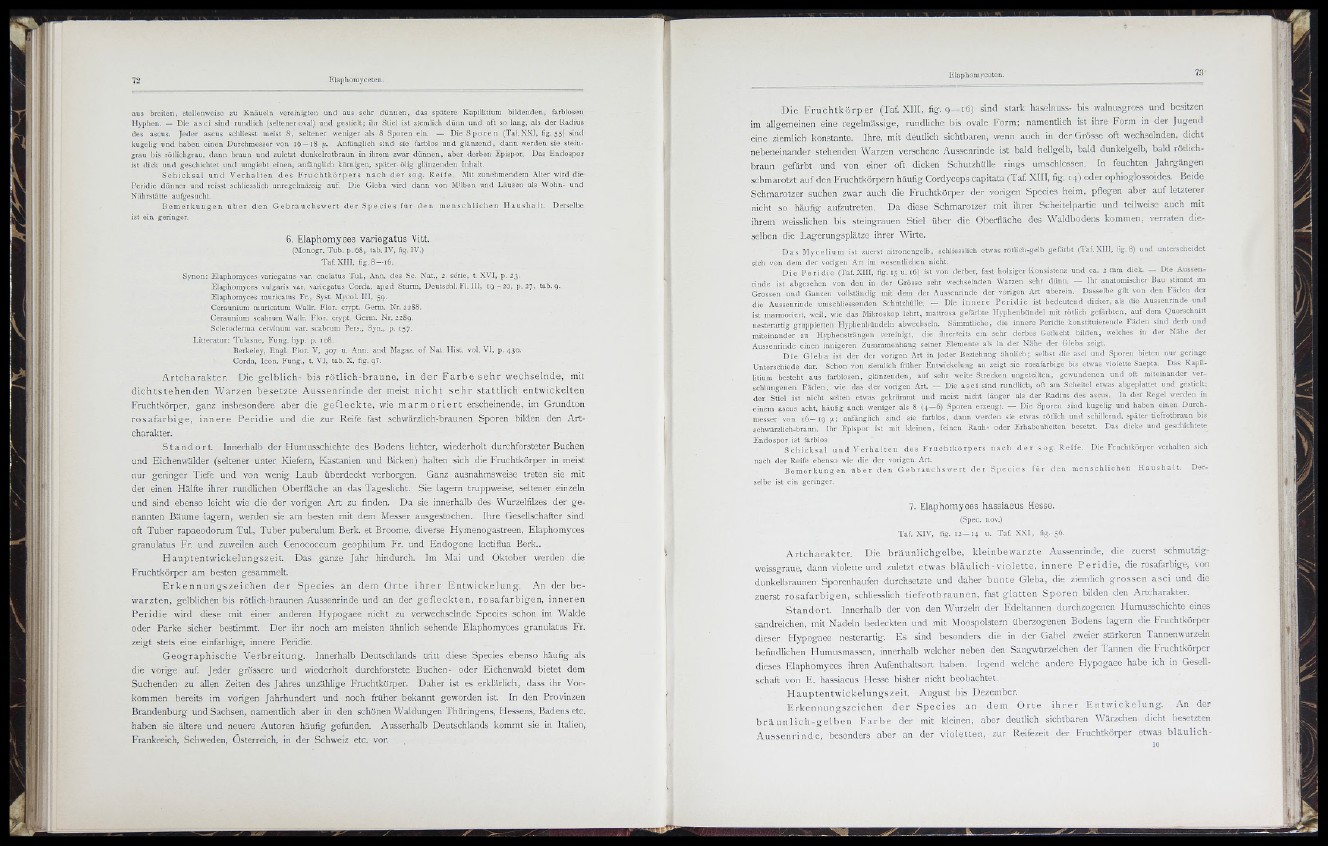
Elaphomyceten.
aus breiten, stellenweise zu Knäueln vereinigten und aus sehr dünnen, das spätere Kapillitium bildenden, farblosen
Hyphen. — Die a s c i sind rundlich (selteneroval) und gestielt; ihr Stiel ist ziemlich dünn und oft so lang, als der Radius
des ascus. Jeder ascus schliesst meist 8, seltener weniger als 8 Sporen ein. — Die S p o re n (Tai,XXI, fig. 55) sind
kugelig und haben einen Durchmesser von i6 —x8 ¡a. Anfänglich sind sie farblos und glänzend, dann werden sie stein-
grau bis rötlichgrau, dann braun und zuletzt dunkelrotbraun in ihrem zwar dünnen, aber derben Epispor. Das Endospor
ist dick und geschichtet und umgiebt einen, anfänglich körnigen, später ölig glänzenden Inhalt.
S c h ic k s a l untl V e rh a lten d e s F ru ch tk ö rp e r s nach der sog. Re ife. .Mit zunehmendem Alter wird die
Peridie dünner und reisst schliesslich unregehnässig auf. Die Gleba wird dann von M'lben und Läusen als Wohn- und
Nährstätte aufgesucht.
Bem e rku n g en über den G eb rau ch sw e r t der S p e c ie s für den menschlich en Haush alt, Derselbe
ist ein geringer.
6. Elaphomyces variegatus Vitt.
(Monogr. Tub. p. 68, tab. IV, fig. IV.)
Taf. XIII. fig. 8 - 1 6 .
Synon: Elaphomyces variegatus var. caelatus Tul., Ann. des Sc. Nat., 2. série, t. XVI, p. 23.
Elaphomyces vulgaris var. variegatus Corda, apud Sturm, Deutschi. Fl. III, 19 - 2 0 , p. 27, tab. 9.
Elaphomyces rauricatus Fr., Sjst. Mycol. Ill, 59.
Ceraunium muricatura Wallr. Flor, crypt. Germ. Nr. 2288.
Ceraunium scabrum Wallr. Flor, crypt. Germ. Nr. 2289.
Seleroderma cervinum var. scabrum Pers., Syn., p. 157.
Litteratur: Tulasne, Fung. hyp. p. 108.
Berkeley, Engl. Flor. V, 307 u. Ann, and Magaz. of Nat. Hist. vol. VI, p. 430.
Corda, Icon. Fung,, t. VI, tab. X, fig. g7.
A r tch a r a k te r . Die g e lb lic h - b is rö tlich -b rau n e , in d e r F a r b e s e h r w ech se lnd e , mit
d ich t s t e h e n d e n Warz en b e s e tz te A u s s en r in d e der meist n ic h t s e h r s ta t t lic h entwick elten
Fruchtkörper, ganz insbesondere aber die g e f le c k t e , wie m a rm o r i e r t erscheinende, im Grundton
r o s a fa r b ig e , in n e re P e r id ie und die zur Reife fast schwärzlich-braunen Sporen bilden den Artcharakter.
S t a n d o r t . Innerhalb der Humusschichte des Bodens lichter, wiederholt durchforsteter Buchen
und Eichenwälder (seltener unter Kiefern, Kastanien und Birken) halten sich die Fruchtkörper in meist
nur geringer Tiefe und von wenig Laub überdeckt verborgen. Ganz ausnahmsweise treten sie mit
der einen Hälfte ihrer rundlichen Oberfläche an das Tageslicht. Sie lagern truppweise, seltener einzeln
und sind ebenso leicht wie die der vorigen Art zu finden. Da sie innerhalb des Wurzelfilzes der genannten
Bäume lagern, werden sie am besten mit dem Messer ausgestochen. Ihre Gesellschafter sind
oft Tuber rapaeodorum Tul., Tuber puberulum Berk, et Broome, diverse Hymenogastreen, Elaphomyces
granulatus Fr, und zuweilen auch Cenococcum geophilum Fr. und Endogone lactiflua Berk..
H aup ten tw ick e lu n g sz e it. Das ganze Jahr hindurch. Im Mai und Oktober werden die
Fruchtkörper am besten gesammelt.
E r k e n n u n g s z e ic h e n d e r S p e c ie s an dem O r te ih r e r E n tw ic k e lu n g . An der b e warz
ten, gelblichen bis rötlich-braunen Aussenrinde und an der g e f le c k t e n , ro s a fa rb ig e n , inneren
P e r id ie wird diese mit einer anderen Hypogaee nicht zu verwechselnde Species schon im Walde
oder Parke sicher bestimmt. Der ihr noch am meisten ähnlich sehende Elaphomyces granulatus Fr.
zeigt stets eine einfarbige, innere Peridie.
G e o g ra p h is c h e Ä'e rbre itung. Innerhalb Deutschlands tritt diese Species ebenso häufig als
die vorige auf. Jeder grössere und wiederholt durchforstete Buchen- oder Eichenwald bietet dem
Suchenden zu allen Zeiten des Jahres unzählige Fruchtkörper. Daher ist es erklärlich, dass ihr Vorkommen
bereits im vorigen Jahrhundert und noch früher bekannt geworden ist. In den Provinzen
Brandenburg und Sachsen, namentlich aber in den schönen Waldungen Thüringens, Hessens, Badens etc.
haben sie ältere und neuere Autoren häufig gefunden. Ausserhalb Deutschlands kommt sie in Italien,
Frankreich, Schweden, Österreich, in der Schweiz etc. vor.
%
D ie F r u c h tk ö r p e r (Taf. X l ll, fig. 9— 16) sind stark haselnuss- bis walnusgross und besitzen
im allgemeinen eine regelmässige, rundliche bis ovale Form; namentlich ist ihre Form in der Jugend
eine ziemlich konstante. Ihre, mit deutlich sichtbaren, wenn auch in der Grösse oft wechselnden, dicht
nebeneinander stehenden Warzen versehene Aussenrinde ist bald hellgelb, bald dunkelgelb, bald rötlichbraun
gefärbt und von einer oft dicken Schutzhülle rings umschlossen. In feuchten Jahrgängen
schmarotzt auf den Fruchtkörpern häufig Cordyceps capitata (Taf XIII, fig. 14) oder ophioglossoides. Beide
Schmarotzer suchen zwar auch die Fruchtkörper der vorigen Species heim, pflegen aber auf letzterer
nicht so häufig aufzutreten. Da diese Schmarotzer mit ihrer Scheitelpartie und teilweise auch mit
ihrem weisslichen bis steingrauen Stiel über die Oberfläche des AValdbodens kommen, verraten die-
selben die Lagerungsplätze ihrer Wirte.
D a s Mycelium ist zuerst citronengelb, schliesslich etwas rötlich-gelb gefärbt (Taf. Xlll, fig. 8) und unterscheidet
sich von dem der vorigen Art im wesentlichen nicht.
D ie P e r id ie (Taf.Xlll, fig. 15 u. 16) ist von derber, fast holziger Konsistenz und ca. 2 mm dick. — Die Aussenrinde
ist abgesehen von den in der Grösse sehr wechselnden Warzen sehr dünn. — Ihr anatomischer Bau stimmt im
Grossen und Ganzen vollständig mit dem der Aussenrinde der vorigen Art überein. Dasselbe gilt von den Faden der
die Aussenrinde umschliessenden Schutzhülle. — Die innere P e r id ie ist bedeutend dicker, als die Aussenrinde und
ist marmoriert, weil, wie das Mikroskop lehrt, mattrosa gefärbte Hyphenbündel mit rötlich gefärbten, auf dem Querschnitt
nesterartig gruppierten Hyphenbündeln abwechseln. Sämmtliche, die innere Peridie konstituierende Fäden sind derb und
miteinander zu Hyphensträngen vereinigt, die ihrerseits ein sehr derbes Geflecht bilden, welches in der Nähe der
Aussenrinde einen innigeren Zusammenhang seiner Elemente als in der Nähe der Gleba zeigt.
Die G ie b a ist der der vorigen Art in jeder Beziehung ähnlich; selbst die asci und Sporen bieten nur geringe
Unterschiede dar. Schon von ziemlich früher Entwickelung an zeigt sie rosafarbige bis etwas violette Saepta, Das Kapillitium
besteht aus farblosen, glänzenden, auf sehr weite Strecken ungeteilten, gewundenen und oft miteinander verschlungenen
Fäden, wie das der vorigen Art. - Die a s c i sind rundlich, oft am Scheitel etwas abgeplattet und gestielt;
der Stiel ist nicht selten etwas gekrümmt und meist nicht länger als der Radius des ascus. In der Regel werden in
einem ascus acht, häufig auch weniger als 8 ( 4 -6 ) Sporen erzeugt. — Die Sporen sind kugelig und haben einen Durch-
raesser von 1 6 - 1 9 p.; anfänglich sind sie farblos, dann werden sie etwas rötlich und schillernd, später tiefrotbraun bis
schwärzlich-braun. Ihr Epispor ist mit kleinen, feinen Rauh- oder Erhabenheiten besetzt. Das dicke und geschichtete
Endospor ist farblos
S c h ic k s a l und V e rh a lte n des F ru ch tk ö rp e r s nach d e r so g . Reife. Die Fruchtkörper verhalten sich
nach der Reife ebenso wie die der vorigen Art.
B em e rk u ng en ü b e r den G e b r a u ch sw e r t d e r S p e c ie s für de
selbe ist ein geringer.
schlichen H a u sh a lt . Der-
7. Elaphomyces hassiacus Hesse.
(Spec. nov.)
Taf. XIV, fig. 12—14 o. Taf. X XI , fig. 56.
A r tch a r a k te r . Die b r ä u n lich g e lb e , k le in b ew a rz te Aussenrinde, die zuerst schmutzigweissgraue,
dann violette und zuletzt e twas b lä u lic h - v io le t t e , inne re P e r id i e , die rosafarbige, von
dunkelbraunen Sporenhaufen durchsetzte und daher bunte Gleba, die ziemlich g ro s s en a sc i und die
zuerst ro s a fa rb ig e n , schliesslich t ie fro tb r au n en , fast g la tte n S p o re n bilden den Artcharakter.
S tan d o r t. Innerhalb der von den AVurzeln der Edeltannen durchzogenen Humusschichte eines
sandreichen, mit Nadeln bedeckten und mit Moospolstern überzogenen Bodens lagern die Fruchtkörper
dieser Hypogaee nesterartig. Es sind besonders die in der Gabel zweier stärkeren Tannenwurzeln
befindlichen Humusmassen, innerhalb welcher neben den Saugwürzelchen der Tannen die Fruchtkörper
dieses Elaphomyces ihren Aufenthaltsort haben. Irgend welche andere Hypogaee habe ich in Gesell-
Schaft von E. hassiacus Hesse bisher nicht beobachtet.
H aup ten tw ick e l 11 ngsze it, August bis Dezember.
E rk en n u n g s z e ich en d e r S p e c ie s an d em O r te ih r e r E n tw i c k e lu n g . An der
b r ä u n l i e h - g e lb e n I''a rb e der mit kleinen, aber deutlich sichtbaren AVärzchen dicht besetzten
A u s s e n r in d e , besonders aber an der v io le tten , zur Reifezeit der Fruchtkörper etwas b lä u lic h