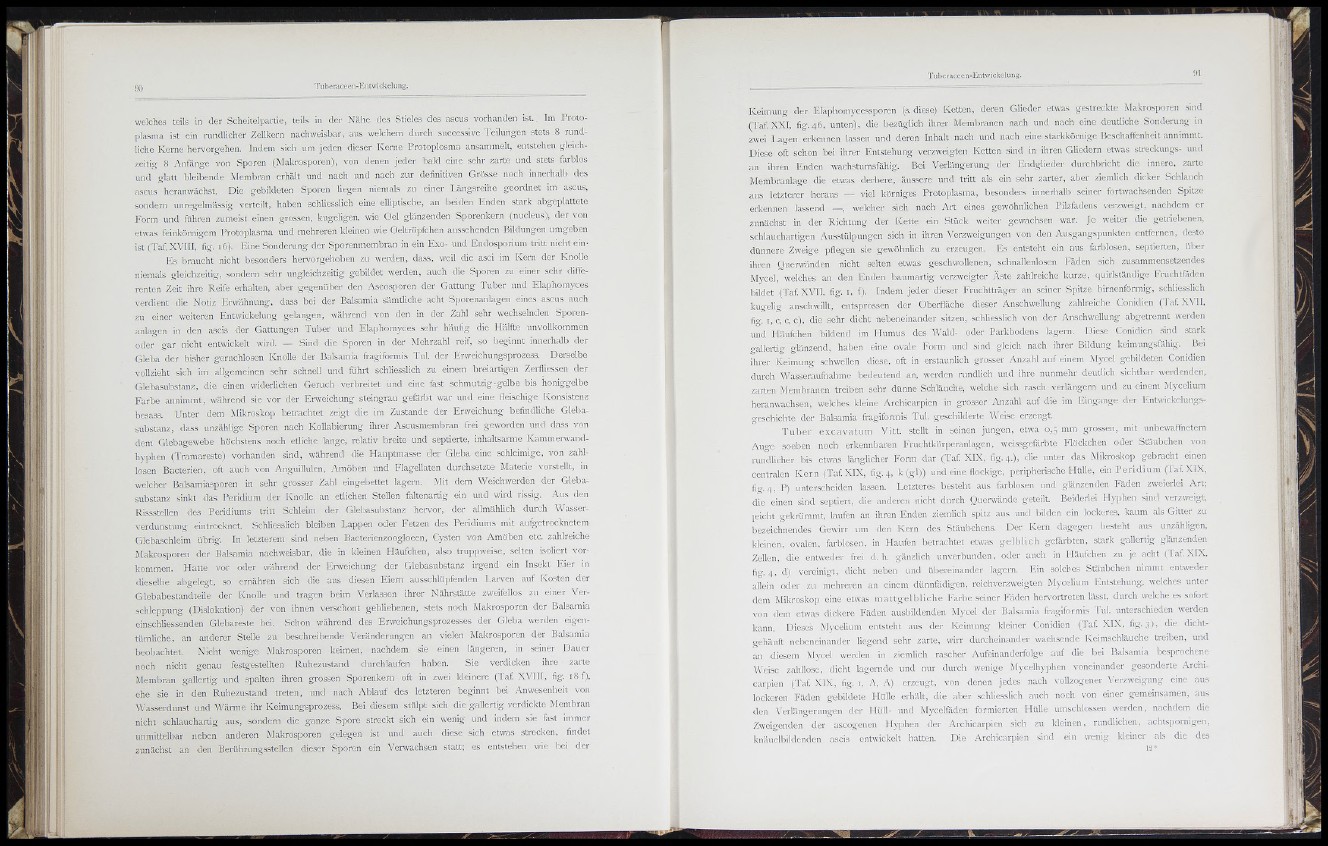
welches teils in der Scheitelpartie, teils in der Nähe des Stieles des ascus vorhanden ist. Im Protoplasma
ist ein rundlicher Zellkern nachweisbar, aus welchem durch successive Teilungen stets 8 rundliche
Kerne hervorgeheii. Indem sich um jeden dieser Kerne Protoplosma ansammelt, entstehen gleichzeitig
8 Anfänge von Sporen (Makrosporen), von denen jeder bald eine sehr zarte und stets farblos
und glatt bleibende Membran erhält und nach und nach Zur definitiven Grösse noch innerhalb des
ascus heranwächst. Die gebildeten Sporen liegen niemals zu einer Längsroihe geordnet im ascus,
.sondern unregelmässig verteilt, haben schliesslich eine elliptische, an beiden Enden stark abgeplattete
Form und führen zumeist einen grossen, kugeligen, wie Oel glänzenden Sporenkern (nucleus), der von
etwas feinkörnigem l'rotoplasma und mehreren kleinen wie Oeltröpfchen aussehenden Bildungen umgeben
ist (Tat XVIII, fig. i6). Eine Sonderung der Sporenmembran in ein Exo- und Endosporlum tritt nicht ein-
E s braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass, weil die asci im Kern der Knolle
niemals gleichzeitig, sondern sehr ungleichzeitig- gebildet werden, auch die Sporen zu einer sehr differenten
Zeit ihre Reife erhalten, aber gegenüber den Ascosporen der Gattung Tuber und Elaphomyces
verdient die Notiz Erwähnung, dass bei der Balsamia sämtliche acht Sporenanlagen eines ascus auch
zu einer weiteren Entwickelung gelangen, während von den in der Zahl sehr wechselnden Sporen-
aiilagen in den ascis der Gattungen Tuber und Elaphomjmes sehr häufig die Hälfte unvollkommen
oder gar nicht entwickelt wird. — Sind die Sporen in der Mehrzahl reif, so beginnt innerhalb der
Gleba der bisher geruchlosen Knolle der Balsamia fragiformis Tul. der Erweichungsprozess. Derselbe
vollzieht sich im allgemeinen sehr schnell und führt schliesslich zu einem breiartigen Zerfliessen der
Glebasubstanz, die einen widerlichen Geruch verbreitet und eine fast schmutzig-gelbe bis honiggelbe
Farbe annimmt, während sie vor der Erweichung steingrau gefärbt wär und eine fleischige Konsistenz
besass. Unter dem Mikroskop betrachtet zeigt die im Zustande der Erwreichung befindliche Glebasubstanz,
dass unzählige Sporen nach Kollabierung ihrer Ascusmembran frei geworden und dass von
dem Giebagewebe höchstens noch etliche lange, relativ breite und septierte, inhaltsarme Kammerwaiid-
hyphen (Tramareste) vorhanden sind, während die klauptmasse der Gleba eine schleimige, von zahllosen
Bacterien, oft auch von Anguillulen, Amöben und Flagellaten durchsetzte Materie vorstellt, in
welcher Balsamiasporen in sehr grösser Zahl eingebettet lagern. Mit dem Weichwerden der Glebasubstanz
sinkt das Peridium der Knolle an etlichen Stellen faltenartig ein und wird rissig. Aus den
Rissstellen des Peridiums tritt Schleim der Glebasubstanz hervor, der allmählich durch Wasscr-
verdunstuiig eintrocknet. Schliesslich bleiben Lappen oder Fetzen des Peridiums mit aufgetrocknetem
Glebaschleim übrig. In letzterem sind neben Bacterienzoogloeen, Cysten von Amöben etc. zahlreiche
Makrosporen der Balsamia nachweisbar, die in kleinen Häufchen, also truppweise, selten isoliert Vorkommen.
Hatte vor oder während der Erweichung der Glebasubstanz irgend ein Insekt Eier in
dieselbe abgelegt, so ernähren sich die aus diesen Eiern ausschlüpfenden Larven auf Kosten der
Giebabestandteile der Knolle und tragen beim Verlassen ihrer Nährstätte zweifellos zu einer Verschleppung
(Dislokation) der von ihnen verschont gebliebenen, stets noch Makrosporen der Balsamia
einschliessenden Giebareste bei. Schon während des Erweichimgsprozesses der Gleba werden eigentümliche,
an anderer Stelle zu beschreibende Veränderungen an vielen Makrosporen der Balsamia
beobachtet. Nicht wenige Makrosporen keimen, nachdem sie einen längeren, in seiner Dauer
noch nicht genau festgestellten Ruhezustand durchlaufen haben. Sie verdicken ihre zarte
Membran gallertig und spalten ihren grossen Sporenkern oft in zwei kleinere (Taf. XV III, fig. 18 f),
ehe sie in den Ruhezustand treten, und ntich Ablauf des letzteren beginnt bei Anwesenheit von
Wasserdunst und Wärme ihr Keimungsprozess. Bei diesem stülpt sich die gallertig verdickte Membran
nicht schlauchartig aus, sondern die ganze Spore streckt sich ein wenig und indem sie fast immer
unmittelbar neben anderen Makrosporen gelegen ist und auch diese sich etwas strecken, findet
zunächst an den Berührimgsstellen dieser Sporen ein Verwachsen statt; es entstehen wie bei der
Keimung der Elaphomycessporen (s. diese) Ketten, deren Glieder etwas gestreckte Makrosporen sind
(Tat XXI, fig. 45, unten), die bezüglich ihrer Membranen nach und nach eine deutliche Sonderung in
zwei I.agen erkennen lassen und deren Inhalt nach und nach eine starkkörnige Beschaffenheit annimmt.
Diese oft schon bei ihrer Entstehung verzweigten Ketten sind in ihren Gliedern etwas streckungs- und
an ihren Enden wachstumsfähig. Bei Verlängerung der Endglieder durchbricht die innere, zarte
Membranlage die etwas derbere, äussere und tritt als ein sehr zarter, aber ziemlich dicker Schlauch
aus letzterer heraus — viel körniges Protoiilasma, besonders innerhalb seiner fortwachsenden Spitze
erkennen lassend welcher sich nach Art eines gewöhnlichen Pilzfadens verzweigt, nachdem er
zunächst in der Richtung der Kette ein Stück weiter gewachsen war. Je weiter die getriebenen,
schlauchartigen Ausstülpungen sich in ihren k'erzweigungen von den Ausgangspunkten entfernen, desto
dünnere Zweige pflegen sie gewöhnlich zu erzeugen. E s entsteht ein aus farblosen, septierten, über
ihren Querwänden nicht selten etwas geschwollenen, schnallenlosen Fäden sich zusammensetzendes
Mycel, welches an den Enden baumartig verzweigter Äste zahlreiche kurze, quirlständige Fruchtfäden
bildet (T a fX V il, fig. i, f). Indem jeder dieser Fruchtträger an seiner Spitze birnenförmig, schliesslich
kugelig anschwillt, entsprossen der Oberfläche dieser Anschwellung zahlreiche Conidien (Tat X\'II,
fig. i,c , c, c), die sehr dicht nebeneinander sitzen, schliesslich von der Anschwellung abgetrennt tverden
und Häufchen bildend im Humus des AVald- oder Parkbodens lagern. Diese Conidien sind stark
gallertig glänzend, haben eine ovtile Form und sind gleich nach ihrer Bildung keimungsfählg. Bei
ihrer Keimung schwellen diese, oft in erstaunlich grösser yAnzahl auf einem Mycel gebildeten Conidien
durch Wasseraufnahme bedeutend an, werden rundlich und ihre nunmehr deutlich sichtbar werdenden,
zarten Membranen treiben sehr dünne Schläuche, welche sich rasch verlängern und zu einem Mycelium
heranwachsen, welches kleine Archicarpien in grösser Anzahl auf die im liingange der Entwickelungsgeschichte
der Balsamia fragiformis Tul. geschilderte Weise erzeugt.
T u b e r e x c a v a tum Vitt, stellt in seinen jungen, etiva 0,5 mm grossen, mit unbewaffnetem
Auge soeben noch erkennbaren Fruehtkörperanlagen, weissgefärbte Flöckchen oder Stäubchen von
rundlicher bis etwas länglicher Form dar (T a f.X IX , fig. 4.), die unter das Mikroskop gebracht einen
centralen K e rn (Tat XIX, fig. 4, k (gl)) und eine flockige, peripherische Hülle, ein P e r id ium (Taf. XIX,
fig. 4, P) unterscheiden lassen. Letzteres besteht aus farblosen und glänzenden Fäden zweierlei Art;
dte einen sind septiert, die anderen nicht durch Querwände geteilt. Beiderlei Hyphen sind verziveigt,
(eicht gekrümmt, laufen an ihren Enden ziemlich spitz aus und bilden ein lockeres, kaum als Gitter zu
bezeichnendes Gewirr um den Kern des Stäubchens. Der Kern dagegen besteht aus unzähligen,
kleinen, ovalen, farblosen, in Haufen betrachtet etwas g e lb lic h gefärbten, stark gallertig glänzenden
Zellen, die entweder frei d.h. gänzlich unverbunden, oder auch in Fläufchen zu je acht (Taf.XIX,
fig. 4, d) vereinigt, dicht neben und übereinander lagern. Ein solches Stäubchen nimmt entweder
allein oder zu mehreren an einem dünnfädigen, reichverziveigten Mycelium Entstehung, welches unter
dem Mikroskop eine etwas m a t tg e lb lich e F'arbe seiner Fäden hervortreten lässt, durch welche es sofort
von dem etwas dickere Fäden ausbildenden Mycel der Balsamia fragiformis Tul. unterschieden werden
kann. Dieses Mrcelium entsteht ans der Keimung kleiner Conidien ( l a f X IX , fig. 3), diü dicht-
geliätift nebeneinander liegend sehr zarte, wirr durcheinander wachsende Keimschläuche treiben, und
mi diesem Mycel werden in ziemlich rascher yVufeinanderfolge auf die bei Balsamia besprochene
Weise zahllose, dicht lagernde und nur durch wenige Mycelhyphen voneinander gesonderte Archicarpien
(Tat XIX , fig. I , A, A.) erzeugt, von denen jedes nach vollzogener A'erzw-eigung eine aus
lockeren baden gebildete Flülle erhält, die aber schliesslich auch noch von einer gemeinsamen, aus
den A'crlängerungen der Hüll- und Mycelfäden formierten Hülle umschlossen werden, nachdem die
Zweigenden der ascogenen Hyphen der yVrchlcarpien sich zu kleinen, rundlichen, achtspornigen,
knüuelbildenden ascis entwickelt hatten. Die Archicarpien sind ein wenig kleiner als die des