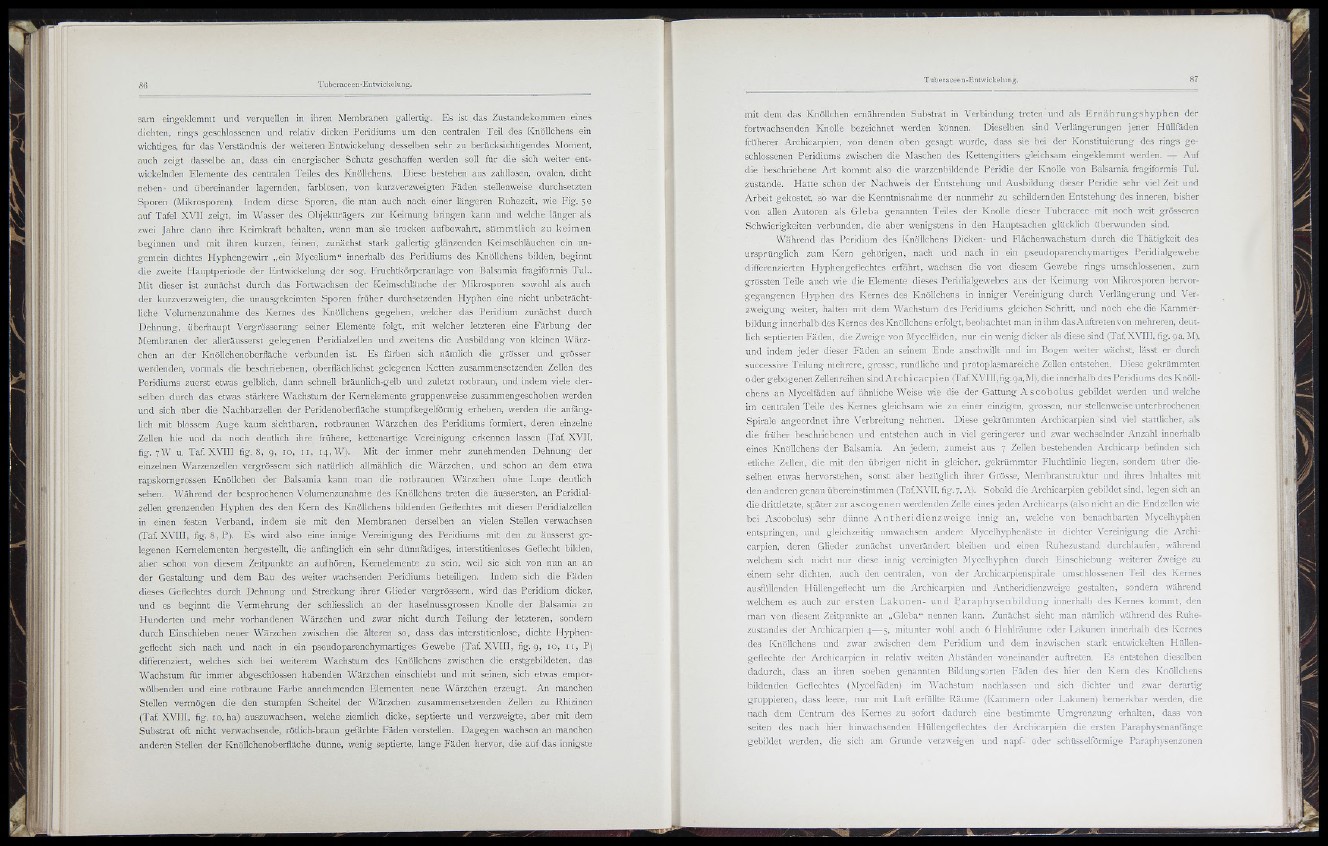
!
In )
sam eingeklemmt und verquellen in ihren Membranen gallertig. Es ist das Zustandekommen eines
dichten, rings geschlossenen und relativ dicken Peridiums um den centralen Teil des Knöllchens ein
wichtiges, für das Verständnis der weiteren Entwickelung desselben sehr zu berücksichtigendes Moment,
auch zeigt dasselbe an, dass ein energischer Schutz geschaffen werden soll für die sich weiter entwickelnden
Elemente des centralen Teiles des Knöllchens. Diese bestehen aus zahllosen, ovalen, dicht
neben- und übereinander lagernden, farblosen, von kurzverzweigten Fäden stellenweise durchsetzten
Sporen (Mikrosporen). Indem diese Sporen, die man auch nach einer längeren Ruhezeit, wie Eig. 5e
auf Tafel XVII zeigt, im Wasser des Objektträgers zur Keimung bringen kann und welche länger als
zwei Jahre dann ihre Keimkraft behalten, wenn man sie trocken aufbewahrt, säm mtlich zu keimen
beginnen und mit ihren kurzen, feinen, zunächst stark gallertig glänzenden Keimschläuchen ein un-
gemein dichtes Ilyphengewirr „ein Mycelium“ innerhalb des Peridiums des Knöllchens bilden, beginnt
die zweite Hauptperiode der Entwickelung der sog. Fruchtkörperanlage von Balsamia fragiformis Tul..
Mit dieser ist zunächst durch das Fortwachsen der Keimschläuche der Mikrosporen sowohl als auch
der kurzverzweigten, die unausgekeimten Sporen früher durchsetzenden Hyphen eine nicht unbeträchtliche
Ä'olumenzunahme des Kernes des Knöllchens gegeben, welcher das Peridium zunächst durch
Dehnung, überhaupt Vergrösserung seiner Elemente folgt, mit welcher letzteren eine Färbung der
Membranen der alleräusserst gelegenen Peridialzellen und zweitens die Ausbildung von kleinen Wärzchen
an der Knöllchenoberfiäche verbunden ist. Es färben sich nämlich die grösser und grösser
werdenden, vormals die beschriebenen, oberflächlichst gelegenen Ketten zusammensetzenden Zellen des
Peridiums zuerst etwas gelblich, dann schnell bräunlich-gelb und zuletzt rotbraun, und indem viele derselben
durch das etwas stärkere V'achstum der Kernelemente gruppenweise zusammengeschoben werden
und sich über die Nachbarzelien der Peridenoberfläche stumpfkegelförmig erheben, werden die anfänglich
mit blossem Auge kaum sichtbaren, rotbraunen Wärzchen des Peridiums formiert, deren einzelne
Zellen hie und da noch deutlich ihre frühere, kettenartige Vereinigung erkennen lassen (Taf. XVII,
fig. yW u. T a f X VIII fig. 8, 9, 10, 1 1 , 14 , W). Mit der immer mehr zunehmenden Dehnung der
einzelnen Warzenzellen vergrössern sich natürlich allmählich die Wärzchen, und schon an dem etwa
rapskorngrossen Knöllchen der Balsamia kann man die rotbraunen Wärzchen ohne Lupe deutlich
sehen. Während der besprochenen Volumenzunahme des Knöllchens treten die äussersten, an Peridialzellen
grenzenden Hyphen des den Kern des Knöllchens bildenden Geflechtes mit diesen Peridialzellen
in einen festen \'erband, indem sie mit den Membranen derselben an vielen Stellen verwachsen
(Taf. XM II, fig. 8, P). E s wird also eine innige Vereinigung des Peridiums mit den zu äusserst gelegenen
Kernelementen hergestellt, die anfänglich ein sehr dünnfädiges, interstitienloses Geflecht bilden,
aber schon von diesem Zeitpunkte an aufhören, Kernelemente zu sein, weil sie sich von nun an an
der Gestaltung und dem Bau des weiter wachsenden Peridiums beteiligen. Indem sich die Fäden
dieses Geflechtes durch Dehnung und Streckung ihrer Glieder vergrössern, wird das Peridium dicker,
und es beginnt die Vermehrung der schliesslich an der haselnussgrossen Knolle der Balsamia zu
Hunderten und mehr vorhandenen Wärzchen und zwar nicht durch Teilung der letzteren, sondern
durch Einschieben neuer Wärzchen zwischen die älteren so, dass das interstitienlose, dichte Hyphengeflecht
sich nach und nach in ein pseudoparenchymartiges Gewebe (Taf. XV III, flg. 9, 10, 1 1 , P)
differenziert, welches sich bei weiterem Wachstum des Knöllchens zwischen die erstgebildeten, das
Wachstum für immer abgeschlossen habenden Wärzchen einschiebt und mit seinen, sich etwas emporwölbenden
und eine rotbraune Farbe annehmenden Elementen neue Wärzchen erzeugt. An manchen
Stellen vermögen die den stumpfen Scheitel der Wärzchen zusammensetzenden Zellen zu Rhizinen
(Taf. XM II , fig. 10, ha) auszuwachsen, welche ziemlich dicke, septierte und verzweigte, aber mit dem
Substrat oft nicht verwachsende, rötlich-braun gefärbte Fäden vorstellen. Dagegen wachsen an manchen
anderen Stellen der Knöllchenoberfläche dünne, wenig septierte, lange Fäden hervor, die auf das innigste
mit dem das Knöllchen ernährenden Substrat in Verbindung treten und als E rn äh ru n g sh yp h en der
fortwachsenden Knolle bezeichnet werden können. Dieselben sind Verlängerungen jener Hüllfäden
früherer Archicarpien, von denen oben gesagt wurde, dass sie bei der Konstituierung des rings geschlossenen
Peridiums zwischen die Maschen des Kettengitters gleichsam eingeklemmt werden. — Auf
die beschriebene Art kommt also die warzenbildende Peridie der Knolle von Balsamia fragiformis Tul.
zustande. Hatte schon der Nachweis der Entstehung und Ausbildung dieser Peridie sehr viel Zeit und
Arbeit gekostet, so war die Kenntnisnahme der nunmehr zu schildernden Entstehung des inneren, bisher
von allen Autoren als G le b a genannten Teiles der Knolle dieser Tuberacee mit noch weit grösseren
Schwierigkeiten verbunden, die aber wenigstens in den Hauptsachen glücklich überwunden sind.
Während das Peridium des Knöllchens Dicken- und Flächenwachstum durch die Thätigkeit des
ursprünglich zum Kern gehörigen, nach und nach in ein pseudoparenchymartiges Peridialgewebe
differenzierten Hyphengefiechtes erfährt, wachsen die von diesem Gewebe rings umschlossenen, zum
grössten Teile auch wie die Elemente dieses Peridialgewebes aus der Keimung von Mikrosporen hervorgegangenen
Hyphen des Kernes des Knöllchens in inniger Vereinigung durch Verlängerung und Verzweigung
weiter, halten mit dem Wachstum des Peridiums gleichen Schritt, und noch ehe die Kammerbildung
innerhalb des Kernes des Knöllchens erfolgt, beobachtet man in ihm das Auftreten von mehreren, deutlich
septierten Fäden, die Zweige von Mycelfäden, nur ein wenig dicker als diese sind (Taf XVIII, fig. 9a, M),
und indem jeder dieser Fäden an seinem Ende anschwillt und im Bogen weiter wächst, lässt er durch
successive Teilung mehrere, grosse, rundliche und protoplasmareiche Zellen entstehen. Diese gekrümmten
oder gebogenenZellenreihen sind A rc h ic a rp ie n (Taf.X\'III,fig.ga,M), die innerhalb des Peridiums des Knöllchens
an Mycelfäden auf ähnliche Weise wie die der Gattung A s c o b o lu s gebildet werden und welche
im centralen Teile des Kernes gleichsam wie zu einer einzigen, grossen, nur stellenweise unterbrochenen
Spirale angeordnet ihre Verbreitung nehmen. Diese gekrümmten Archicarpien sind viel stattlicher, als
die früher beschriebenen und entstehen auch in viel geringerer und zwar wechselnder Anzahl innerhalb
eines Knöllchens der Balsamia. An jedem, zumeist aus 7 Zellen bestehenden Archicarp befinden sich
etliche Zellen, die mit den übrigen nicht in gleicher, gekrümmter Fluchtlinie liegen, sondern über dieselben
etwas hervorstehen, sonst aber bezüglich ihrer Grösse, Membranstruktur und ihres Inhaltes mit
den anderen genau übereinstimmen (Taf XMI, fig. 7, A). Sobald die Archicarpien gebildet sind, legen sich an
die drittletzte, später zur asco g en en werdenden Zelle eines jeden Archicarps (also nicht an die Endzeilen wie
bei Ascobolus) sehr dünne A n th e r id ie n zw e ig e innig an, welche von benachbarten Mycelhyphen
entspringen, und gleichzeitig- umwachsen andere Mycelhyphenäste in dichter Vereinigung die Archicarpien,
deren Glieder zunächst unverändert bleiben und einen Ruhezustand durchlaufen, während
welchem sich nicht nur diese innig vereinigten Mycelhj’phen durch Einschiebung weiterer Zweige zu
einem sehr dichten, auch den centralen, von der Archicarpienspirale umschlossenen Teil des Kernes
ausfallenden Hüllengeflecht um die Archicarpien und Antheridienzweige gestalten, sondern während
welchem es auch zur ersten L akunen- und P a ra p h y s en b ild u n g innerhalb des Kernes kommt, den
man von diesem Zeitpunkte an „Gleba“ nennen kann. Zunächst sieht man nämlich während des Ruhezustandes
der Archicarpien 4— 5, mitunter wohl auch 6 Hohlräume oder Lakunen innerhalb des Kernes
des Knöllchens und zwar zwischen dem Peridium und dem inzwischen stark entwickelten Hüllen-
gellechte der Archicarpien in relativ weiten Abständen voneinander auftreten. Es entstehen dieselben
dadurch, dass an ihren soeben genannten Bildungsorten Eäden des hier den Kern des Knöllchens
bildenden Geflechtes (Mycelfäden) im Wachstum nachlassen und sich dichter und zwar derartig
gruppieren, dass leere, nur mit Luft ertüllte Räume (Kammern oder I,akunen) bemerkbar werden, die
nach dem Centrum des Kernes zu sofort dadurch eine bestimmte Umgrenzung erhalten, dass von
seiten des nach hier hinwachsenden Hüllengeflechtes der Archicarpien die ersten Paraphysenanfänge
gebildet werden, die sich am Grunde verzweigen und napf- oder schüsselförmige Paraphysenzonen
■il'
11