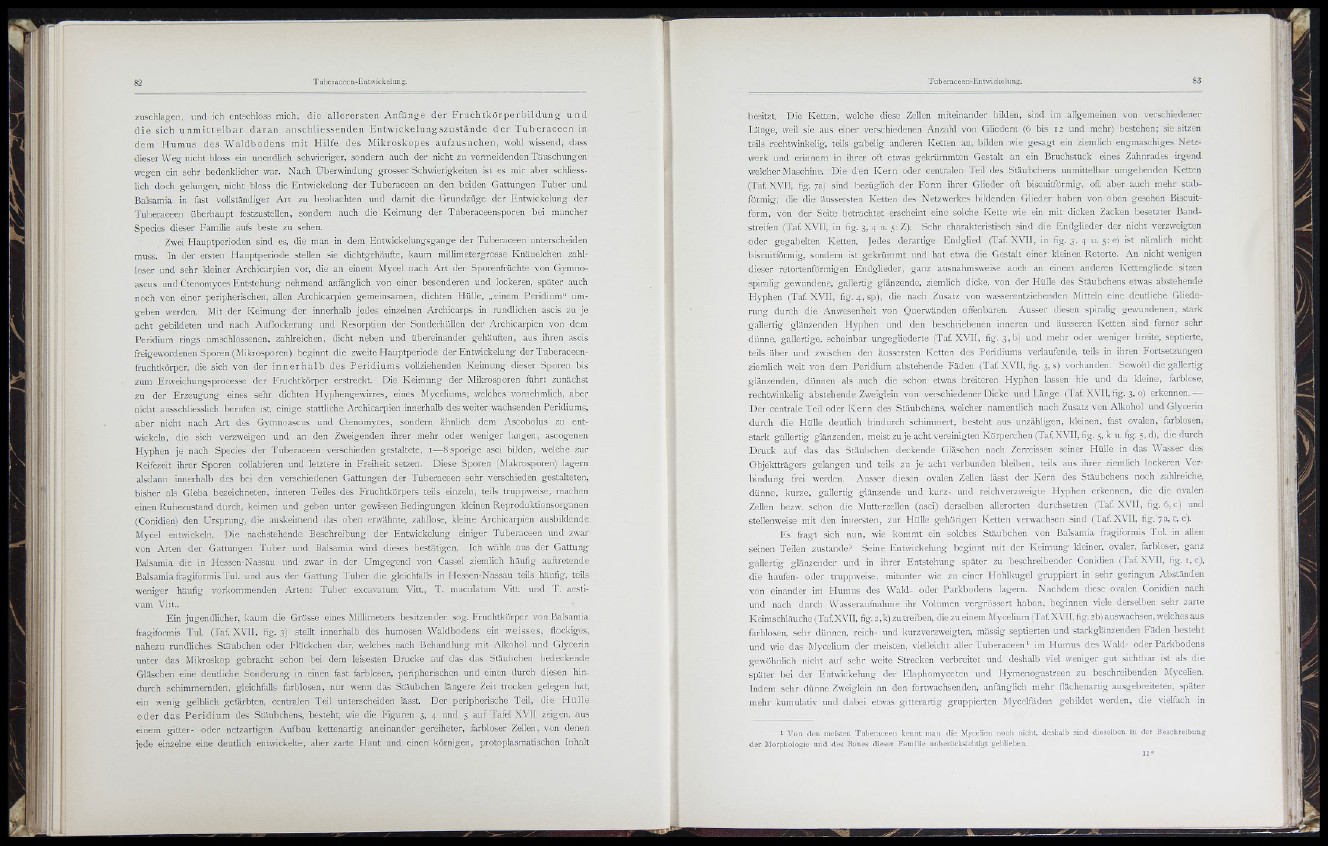
I I E
li':
Zuschlägen, und ich entschloss mich, die a lle re r s ten A n fän g e de r F ru c h tk ö rp e rb ild u n g u n d
d i e sich u n m i t t e lb a r d a ra n an sch lie ssen d en E n tw ic k e lu n g s zu s tä n d e d e r T u b e r a c e e n in
dem Humus des W a ld b od en s mit H ilfe des M ik ro sk o p e s aufzu su ch en, wohl wissend, dass
dieser Weg nicht bloss ein unendlich schwieriger, sondern auch der nicht zu vermeidenden Täuschungen
wegen ein sehr bedenklicher war. Nach Überwindung grösser Schwierigkeiten ist es mir aber schliesslich
doch gelungen, nicht bloss die Entwickelung der Tuberaceen an den beiden Gattungen Tuber und
Balsamia in fast vollständiger Art zu beobachten und damit die Grundzüge der Entwickelung der
Tuberaceen überhaupt festzustellen, sondern auch die Keimung der Tuberaceensporen bei mancher
Species dieser Familie aufs beste zu sehen.
Zwei Hauptperioden sind es, die man in dem Entwickelungsgange der Tuberaceen unterscheiden
muss, ln der ersten Hauptperiode stellen sie dichtgehäufte, kaum millimetergrosse Knäuelchen zahlloser
und sehr kleiner Archicarpien vor, die an einem Mycel nach Art der Sporenfrüchte von Gymno-
ascus und Ctenomyces Entstehung nehmend anfänglich von einer besonderen und lockeren, später auch
noch von einer peripherischen, allen Archicarpien gemeinsamen, dichten Hülle, „einem Peridium“ umgeben
werden. Mit der Keimung der innerhalb jedes einzelnen Archicarps in rundlichen ascis zu je
acht o-ebildeten und nach Auflockerung und Resorption der Sonderhüllen der Archicarpien von dem
Peridium rings umschlossenen, zahlreichen, dicht neben und übereinander gehäuften, aus ihren ascis
freigewordenen Sporen (Mikrosporen) beginnt die zweite Hauptperiode der Entwickelung der Tuberaceen-
fruchtkörper, die sich von der in n e r h a lb des P e r id ium s vollziehenden Keimung dieser Sporen bis
zum Erweichungsprocesse der PTuchtkörper erstreckt. Die Keimung der Mikrosporen führt zunächst
zu der Erzeugung eines sehr dichten Hyphengewirres, eines Myceliums, welches vornehmlich, aber
nicht ausschliesslich berufen ist, einige stattliche Archicarpien innerhalb des weiter wachsenden Peridiums,
aber nicht nach Art des Gymnoascus und Ctenomyces, sondern ähnlich dem Ascobolus zu entwickeln,
die sich verzweigen und an den Zweigenden ihrer mehr oder weniger langen, ascogenen
Hyphen je nach Species der Tuberaceen verschieden gestaltete, i—Ssporige asci bilden, welche zur
Reifezeit ihrer Sporen collabieren und letztere in Freiheit setzen. Diese Sporen (Makrosporen) lagern
alsdann innerhalb des bei den verschiedenen Gattungen der Tuberaceen sehr verschieden gestalteten,
bisher als Gleba bezeichneten, inneren Teiles des Fruchtkörpers teils einzeln, teils truppweise, machen
einen Ruhezustand durch, keimen und geben unter gewissen Bedingungen kleinen Reproduktionsorganen
(Conidien) den Ursprung, die auskeimend das oben erwähnte, zahllose, kleine Archicarpien ausbildende
Mycel entwickeln. Die nachstehende Beschreibung der Entwickelung einiger Tuberaceen und zwar
von Arten der Gattungen Tuber und Balsamia wird dieses bestätigen. Ich wähle aus der Gattung
Balsamia die in Hessen-Nassau und zwar in der Umgegend von Cassel ziemlich häufig auftretende
Balsamia fragiformis Tul. und aus der Gattung Tuber die gleichfalls in Hessen-Nassau teils häufig, teils
weniger häufig vorkommenden Arten: Tuber excavatum Vitt., T. maculatum Vitt, und T. aestivum
Vitt..
Ein jugendlicher, kaum die Grösse eines Millimeters besitzender sog. P'ruchtkörper von Balsamia
fragiformis Tul. (Taf. XVII, fig. 3) stellt innerhalb des humosen Waldbodens ein w e is se s , flockiges,
nahezu rundliches Stäubchen oder Flöckchen dar, welches nach Behandlung mit Alkohol und Glycerin
unter das Mikroskop gebracht schon bei dem leisesten Drucke auf das das Stäubchen bedeckende
Gläschen eine deutliche Sonderung in einen fast farblosen, peripherischen und einen durch diesen hindurch
schimmernden, gleichfalls farblosen, nur wenn das Stäubchen längere Zeit trocken gelegen hat,
ein wenig gelblich gefärbten, centralen Teil unterscheiden lässt. Der peripherische Teil, die H ü lle
od e r d a s P e r id ium des Stäubchens, besteht, wie die Figuren 3, 4 und 5 auf Tafel XVII zeigen, aus
einem gitter- oder netzartigen Aufbau kettenartig aneinander gereiheter, farbloser Zellen, von denen
jede einzelne eine deutlich entwickelte, aber zarte Haut und einen körnigen, protoplasmatischen Inhalt
besitzt. Die Ketten, welche diese Zellen miteinander bilden, sind im allgemeinen von verschiedener
Länge, weil sie aus einer verschiedenen Anzahl von Gliedern (6 bis 12 und mehr) bestehen; sie sitzen
teils rechtwinkelig, teils gabelig anderen Ketten an, bilden wie gesagt ein ziemlich engmaschiges Netzwerk
und erinnern in ihrer oft etwas gekrümmten Gestalt an ein Bruchstück eines Zahnrades irgend
welcher Maschine. Die den K e rn oder centralen Teil des Stäubchens unmittelbar umgebenden Ketten
(Taf. XVII, flg. 7a) sind bezüglich der P'orm ihrer Glieder oft biscuitförmig, oft aber auch mehr stabförmig;
die die äussersten Ketten des Netzwerkes bildenden Glieder haben von oben gesehen Biscuitform,
von der Seite betrachtet erscheint eine solche Kette wie ein mit dicken Zacken besetzter Bandstreifen
(TafXVTI, in fig. 3, 4 u. 5:Z). Sehr charakteristisch sind die Endglieder der nicht verzweigten
oder gegabelten Ketten. Jedes derartige Endglied (Taf. XV II, in flg. 3, 4 u. 5:e) ist nämlich nicht
biscuitförmig, sondern ist gekrümmt und hat etwa die Gestalt einer kleinen Retorte. An nicht wenigen
dieser retortenförmigen Endglieder, ganz ausnahmsweise auch an einem anderen Kettengliede sitzen
spiralig gewundene, gallertig glänzende, ziemlich dicke, von der Plülle des Stäubchens etwas abstehende
Hyphen (Taf. XVII, fig. 4,5p), die nach Zusatz von wasserentziehenden Mitteln eine deutliche Gliederung
durch die Anwesenheit von Querwänden offenbaren. Ausser diesen spiralig gewundenen, stark
gallertig glänzenden Hyphen und den beschriebenen inneren und äusseren Ketten sind ferner sehr
dünne, gallertige, scheinbar ungegliederte (Taf. XV II, fig. 3 ,b ) und mehr oder weniger breite, septierte,
teils über und zwischen den äussersten Ketten des Peridiums verlaufende, teils in ihren Portsetzungen
ziemlich weit von dem Peridium abstehende Fäden (Taf. XVII, fig. 3, s) vorhanden. Sowohl die gallertig
glänzenden, dünnen als auch die schon etwas breiteren Hyphen lassen hie und da kleine, farblose,
rechtwinkelig abstehende Zweiglein von verschiedener Dicke und Länge (Taf X \ 'I1, fig. 3, o) erkennen, —
Der centrale Teil oder K e rn des Stäubchens, welcher namentlich nach Zusatz von Alkohol und Glycerin
durch die Hülle deutlich hindurch schimmert, besteht aus unzähligen, kleinen, fast ovalen, farblosen,
stark gallertig glänzenden, meist zu je acht vereinigten Körperchen (Taf XVII, fig. 5, k u. fig. 5, d), die durch
Druck auf das das Stäubchen deckende Gläschen nach Zerreissen seiner Hülle in das Wasser des
Objektträgers gelangen und teils zu je acht verbunden bleiben, teils aus ihrer ziemlich lockeren \ er-
bindung frei werden. Ausser diesen ovalen Zellen lasst der Kern des Stäubchens noch zahlreiche,
dünne, kurze, gallertig glänzende und kurz- und reichverzweigte Hyphen erkennen, die die ovalen
Zellen bezw. schon die Mutterzellen (asci) derselben allerorten durchsetzen (Taf. X \ ’II, fig. 6, c) und
stellenweise mit den innersten, zur Hülle gehörigen Ketten verwachsen sind (PafXÄTI, fig. 7a, c, c).
Es fragt sich nun, wie kommt ein solches Stäubchen von Balsamia fragiformis Tul. in allen
seinen Teilen zustande? Seine Entwickelung beginnt mit der Keimung kleiner, ovaler, farbloser, ganz
gallertig glänzender und in ihrer Entstehung später zu beschreibender Conidien (Taf XVII, fig. i,c ),
die häufen- oder truppweise, mitunter wie zu einer Hohlkugel gruppiert in sehr geringen Abständen
von einander im Humus des Wald- oder Parkbodens lagern. Nachdem diese ovalen Conidien nach
und nach durch Wasscraufnahme ihr Volumen vergrössert haben, beginnen viele derselben sehr zarte
Keimschläuche (Taf.X\TI, fig. 2, k) zu treiben, die zu einem Mycelium (Taf. XVII, fig. 2b) auswachsen, welches aus
farblosen, sehr dünnen, reich- und kurzverzweigten, mässig septierten und starkglänzenden Fäden besteht
und wie das Mycelium der meisten, vielleicht aller Tuberaceen' im Humus des V'ald- oder Parkbodens
gewöhnlich nicht auf sehr weite Strecken verbreitet und deshalb viel weniger gut sichtbar ist als die
später bei der lintwickehmg der Elaphomyceten und Plymenogastreen zu beschreibenden Mycelien.
Indem sehr dünne Zweiglein an den fortwachsenden, anfänglich mehr flächenartig ausgebreiteten, später
mehr kumulativ und dabei etwas gitterartig gruppierten Mycelfäden gebildet werden, die vielfach in
1 Von den meisten Tuberaceen kennt man die Mycelien noch nicht, deshalb sind dieselben
tier Morphologie und des Baues dieser Familie unberücksichtigt geblieben.
1 der Beschreibung
13
'ii .4
i l