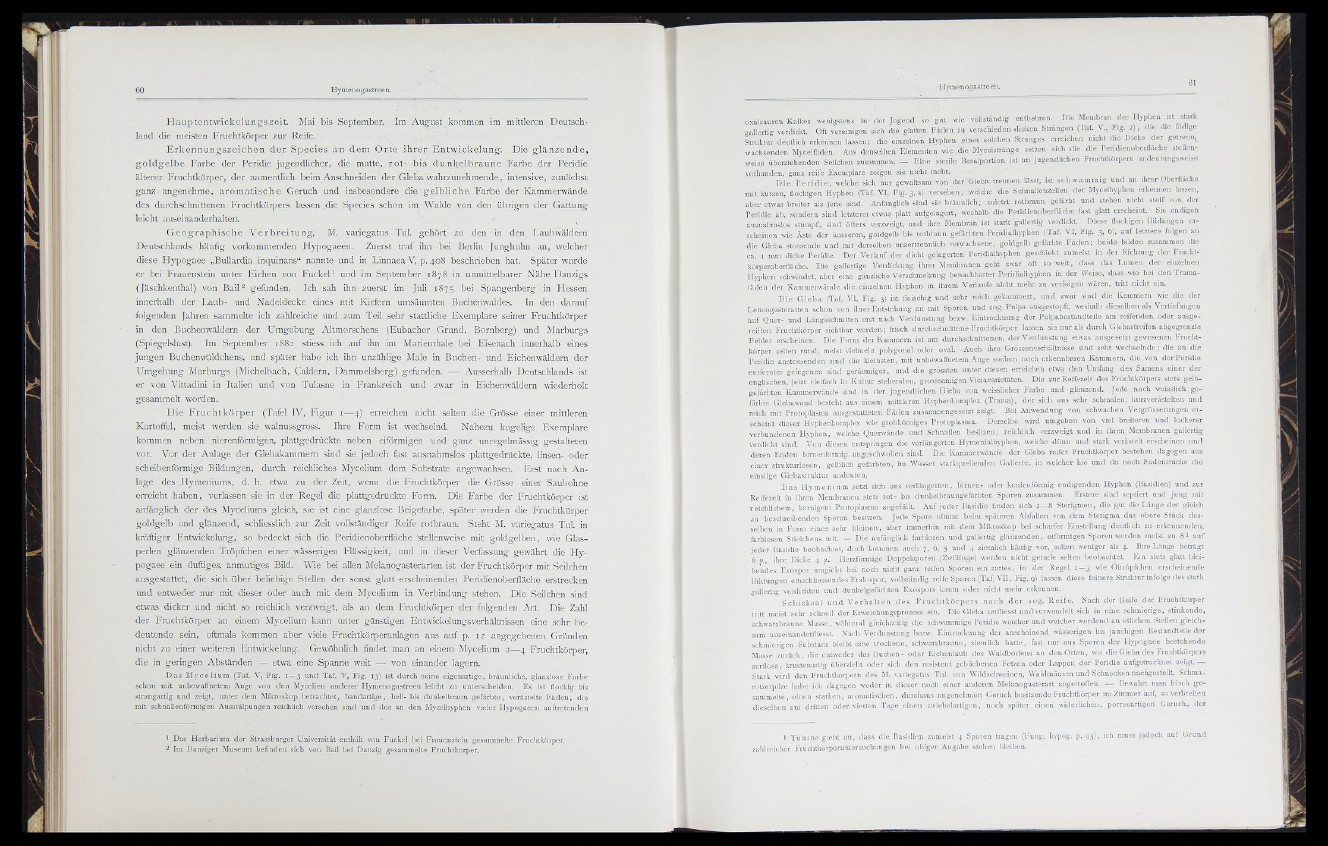
IT au p ten tw ick e lu n g sz e it. Mai bis September, Im August kommen im mittleren Deutschland
die meisten Fruchtkörper zur Reife.
E rk e n n u n g s z e ic h en de r S p e c ie s an dem Or te ih re r E n tw ic k e lu n g . Die g lä n z e n d e ,
g o ld g e lb e Farbe der Peridie jugendlicher, die matte, ro t- b is d u n k e lb ra u n e Farbe der Peridie
älterer Fruchtkörper, der namentlich beim Anschneiden der Gieba wahrzunehmende, intensive, zunächst
ganz angenehme, a rom a tis c h e Geruch und insbesondere d ie ' g e lb lic h e Farbe der Kammerwände
des durchschnittenen Fruchtkörpers lassen die Species schon im Walde von den übrigen der Gattung
leicht auseinanderhalten. ^
G e o g r a p h i s c h e V e r b r e itu n g , M. variegatus Tul. gehört zu den in den Laubwäldern
Deutschlands häufig vorkommenden Hypogaeen. Zuerst traf ihn bei Berlin Junghuhn an, welcher
diese Hypogaee „Bullardia inquinans“ nannte und in Linnaea V, p. 408 beschrieben hat. Später wurde
er bei Frauenstein unter Eichen von FuckeH und im September 1878 in unmittelbarer Nähe Danzigs
(Jäschkenthal) von BaiH gefunden. Ich sah ihn zuerst im Juli 1875 bei Spangenberg in Flessen
innerhalb der Laub- und Nadeldecke eines mit Kiefern umsäumten Buchenwaldes. In den darauf
folgenden Jahren sammelte ich zahlreiche und zum Teil sehr stattliche Exemplare seiner Fruchtkörper
in den Buchenwäldern der Umgebung Altmorschens (Eubacher Grund, Bornberg) und Marburgs
(Spiegelslust). Im September 1882 stiess ich auf ihn im Marienthale bei Eisenach innerhalb eines
jungen Buchenwäldchens, und später habe ich ihn unzählige Male in Buchen- und Eichenwäldern der
Umgebung Marburgs (Michelbach, Caldern, Dammeisberg), gefunden. — Ausserhalb Deutschlands ist
er von Vittadini in Italien und von Tulasne in Frankreich und zwar in Eichenwäldern wiederholt
gesammelt worden,
D ie F ru c h tk ö rp e r (Tafel IV, Figur i—4) erreichen nicht selten die Grösse einer mittleren
Kartoffel, meist werden sie walnussgross. Ihre Form ist wechselnd. Nahezu kugelige Exemplare
kommen neben nierenförmigen, plattgedrückte neben eiförmigen und ganz unregelmässig gestalteten
vor. Vor der Anlage der Giebakammern sind sie jedoch fast ausnahmslos plattgedrückte, linsen- oder
scheibenförmige Bildungen, durch reichliches Mycelium dem Substrate angewachsen. Erst nach Anlage
des Hymeniums, d, h. etwa zu der Zeit, wenn die Fruchtkörper die Grösse einer Saubohne
erreicht haben, verlassen sie in der Regel die plattgedrückte Form. Die Farbe der Fruchtkörper ist
anfänglich der des Myceliums gleich, sie ist eine glanzlose Beigefarbe, später werden die Fruchtkörper
goldgelb und glänzend, schliesslich zur Zeit vollständiger Reife rotbraun. Steht-M. variegatus Tul. in
kräftiger Entwickelung, so bedeckt sich die Peridienoberfläche stellenweise mit goldgelben, wie GLs-
perlen glänzenden Tröpfchen einer wässerigen Flüssigkeit, und in dieser Verfassung gewährt die Plypogaee
ein duftiges, anmutiges Bild. Wie bei allen Melanogasterarten ist der Fruchtkörper mit Seilchen
ausgestattet, die sich über beliebige Stellen der sonst glatt erscheinenden Peridienoberfläche erstrecken
und entweder nur mit dieser oder auch mit dem Mycelium in Verbindung stehen. Die Seilchen sind
etwas dicker und nicht so reichlich verzweigt, als an dem Fruchtkörper der folgenden Art. Die Zahl
der Fruchtkörper an einem Mycelium kann unter gün.stigen Entwickelungsverhältnissen eine sehr bedeutende
sein, oftmals kommen aber viele Fruehtkörperanlagen aus auf p. 1 2 angegebenen Gründen
nicht zu einer weiteren Entwickelung. Gewöhnlich findet man an einem Mycelium 2—4 Fruchtkörper,
die in geringen Abständen — etwa eine Spanne weit — von einander lagern.
D a s M y c e lium (Taf. V, Fig, 1 - - 3 und Taf. V, Fig. 13) ist durch seine eigenartige, bräunliche, glanzlose Farbe
schon mit unbetvaffnetera Auge von den Mycelien anderer Hymenogastreen leicht zu unterscheiden. Es ist flockig bis
strangartig und zeigt, unter dem Mikroskop betrachtet, bandartige, hell-bis dunkelbraun gefärbte, verästelte Fäden, die
mit schnallenförmigen Ausstülpungen reichlich versehen sind und des an den Mycelhyphcn vieler Hypogaeen auftretenden
1 Das Herbarium der Strassburger Universität enthält von Fuckel bei Frauenstein gesammelte Fruchtkörper.
2 Im Danziger Museum befinden sich von Bail bei Danzig gesammelte Fruchtkörper.
oxalsauren Kalkes wenigstens in der Jugend so gut a
gallertig verdickt. Oft vereinigen sich die glatten Fäden
vollständig entbehren. Die Membran der Hyphen ist stark
gauiü...- ....w...... - o_____ /erschieden dicken Strängen (Taf. V., Fig. 2 ). die die HLdige
smktar dkuRh erkenn'LiässräV'tlre emrelnen Hyphen eines solchen Stranges erreichen nicl.t die Dicke der getrennt
wachsenden Myeeltaden. Aus denselben Elementen wie die Myeelstränge setacn sich die die Peridienobernache stellenweise
überziehenden Seilchen zusammen. - Eine sterile Basalporlion Ist an jugendlichen Ftuchtkörpern andeutungsweise
nzelnen
bei den Trama-
tritt nicht ein.
vorhanden, ganz reife Exemplare zeigen sie nicht mehr.
Die P e r id ie , welche sich nur gewaltsam von der Gieba trennen lässt, ist schw ammig und an ihrer Oberfläche
mit kurzen, flockigen Hyphen (Taf. VI, Fig. 3, a) versehen, welche die Schnallenzellen der Mycelhyphen erkennen lassen,
aber etwas breiter als jene sind. Anfänglich sind sie bräunlich, zuletzt rotbraun gefärbt und stehen nicht steif von der
Peridie ab, sondern sind letzterer etwas platt aufgelagert, weshalb die Peridienoberfläche fast glatt erscheint. Sie endigen
ausnahra.slos stumpf, sind öfters verzweigt, und ihre Membran ist stark gallertig verdickt. Diese flockigen Bildungen erscheinen
wie Äste der äusseren, goldgelb bis rotbraun gefärbten Peridialhyphen (Taf. VI, Fig. 3, 6), auf letztere folgen an
die Gieba stossende und mit derselben unzertrennlich verwachsene, goldgelb gefärbte Fäden; beide bilden zusammen die
ca. 1 mm dicke Peridie. Der Verlauf der dicht gelagerten Peridialhyphen geschieht zumeist in der Richtung der Fruchtkörperoberfläche.
Die gallertige Verdickung ihrer Membranen geht zwar oft so weit, dass das Lumen de
Hyphen schwindet, aber eine gänzliche Verschmelzung benachbarter Peridialhyphen in der Weise, dass
faden der Kammerwände die einzelnen Hiphen in ihrem Verlaufe nicht mehr zu verfolgen
Die G ieb a (Taf. VI, Fig. 3) ist fleischig und sehr reich gekammert, und zwar sind die Kammern wie die der
Leucogasterarten schon von ihrer Entstehung an mit Sporen und sog. Pulpa ausgestopft, weshalb dieselben als Vertiefungen
auf Quer- und Längsschnitten erst nach Verdunstung bezw. Eintrocknung der Pulpabestandteile am reifenden oder ausgereiften
Fruchtkörper sichtbar werden ; frisch durchschnittene Fruchtkörper lassen sie nur als durch Glebastieifen abgegrenzte
Felder erscheinen. Die Form der Kammern ist am durchschnittenen, der Verdunstung etwas ausgesetzt gewesenen Fruchtkörper
selten rund, meist vielmehr polygonal oder oval. Auch ihre Grössenverhältnisse sind sehr wechselnde; die an die
Peridie anstossendcn sind die kleinsten, mit unbewaffnetem Auge soeben noch erkennbaren Kammern, die von der Peridie
entfernter gelegenen sind geräumiger, und die grössten unter diesen erreichen etwa den Umfang des Samens einer der
englischen, jetzt vielfach in Kultur stehenden, grosssamigen Viciavarietäten. Die zur Reifezeit des l'ruchtkörpers stets gelb-
gefärbten Kammerwände sind in der jugendlichen Gieba von weisslicher Farbe und glänzend. Jede noch weisslich ge-
färbte Giebawand besteht aus einem mittleren Hyphenkoraplex (Trama), der sich aus sehr schmalen, kurzverästelten uml
reich mit Protoplasma ausgestatteten Fäden zusammengesetzt zeigt. Bei Anwendung von schwachen Vergrösserungen erscheint
dieser Hyphenkomplex wie grobkörniges Protoplasma. Derselbe wird umgeben von viel breiteren und lockerer
verbundenen Hyphen, welche Querwände und Schnallen besitzen, reichlich verzweigt und in ihren Membranen gallertig
verdickt sind. Von diesen entspringen die verlängerten Hymenialhyphen, welche dünn und stark verästelt erscheinen und
deren Enden birnenförmig angeschwollen sind. Die Kammerwände der Gieba reifer Fruchtkörper bestehen dagegen aus
einer strukturlosen, gelblich gefärbten, im Wasser starkquellenden Gallerte, in welcher hie und da noch Fadenstiicke die
einstige Giebastruktur andeuten.
D as Hymenium setzt sich aus verlängerten, birnen- oder keulenförmig endigenden Hyphen (Basidien) und zur
Reifezeit in ihren Jlembranen stets rot- bis dunkelbraungefilrbtcn Sporen zusammen. Erstere sind septiert und jung mit
reichlichem, körnigem Protoplasma angefüllt. Auf jeder Basidie finden sich 2 - 8 Sterigmen, die gut die Länge der gleich
zu beschreibenden Sporen, besitzen. Jede Spore nimmt beim späteren Abfallen von dem Sterigma das obere Stück desselben
in Form eines sehr kleinen, aber immerhin mit dem Mikroskop bei scharfer Einstellung deutlich zu erkennenden,
farblosen Stielchcns mit. — Die anfänglich farblosen und galleitig glänzenden, eiförmigen Sporen werden meist zu 81 auf
jeder Basidie beobachtet, doch kommen auch 7, 6, 5 und 4 ziemlich häufig vor, selten weniger als 4. Ihre Länge betragt
6 a, ihre Dicke 4 y.. Herzförmige Doppelsporen {Zwillinge} werden nicht gerade selten beobachtet. Ein stets glatt blei-
bencles Exospor umgiebt bei noch nicht ganz reifen Sporen ein zartes, in der Regel 2 - 3 wie Öltröpfchen erscheinende
Bildungen einschliessendcs Endospor, vollständig reife Sporen (Taf. VII, Fig. 9) lassen diese feinere Struktur infolge des stark
gallertig verdickten und dunkclgefärbtcn Exospors kaum oder nicht mehr erkennen.
Sch ick sa l und V e rh a lte n des F ru ch tk ö rp e rs nach der sog. Re ife. Nach der Reife der Fruchtkörper
tritt meist sehr schnell der Eiweichungsprozcss ein. Die Gieba zerfliesst und verwandelt sich in eine schmierige, stinkende,
schwarzbraune Masse, während gleichzeitig djo schwammige Peridie weicher und weicher werdend an etlichen Stellen gleichsam
auseinanderfliesst. Nach \’erdunstung bezw. Eintrocknung der anscheinend wässerigen bis jauchigen Bestandteile der
schmierigen Substanz bleibt eine trockene, scbwarzbvaune, ziemlich harte, fast nur aus Sporen der Hypogaee bestehende
Masse zurück, dio entweder das Buchen- oder Eichenlaub des Waldbodens an den Orten, wo die Gieba des Pruchtkörpers
zerfloss, kruslcnartig überzieht oder sich den resistent gebliebenen Fetzen oder Lappen der Peridie aufgetrocknet zeigt.—
Stark wird den Friichtkörperii des M. variegatus Tul. von Wildschweinen, Waldmäusen und Schnecken nachgestellt, Schmarotzerpilze
liabe ich dagegen weder in <lieser noch einer anderen Melanogasterart angetroffen. — Bewalirt man frisch g e sammelte
, einen starken, niomatischen, durchaus angenehmen Geruch besitzende Fruchtkörper im Zimmer auf, so verbreiten
dieselben am dritten oder vierten Tage einen zwicbclavtigen, noch später einen widerlichen, porreeartigen Geruch, <ler
1 Tulasne giebt an, dass die Basidien zumeist j Sporen tragen (Fung. hypog. p. 93), ich muss jedoch auf (jrund
zahlreicher Fruchtkörperuntcrsuchungen bei obiger Angabe stehen bleiben.