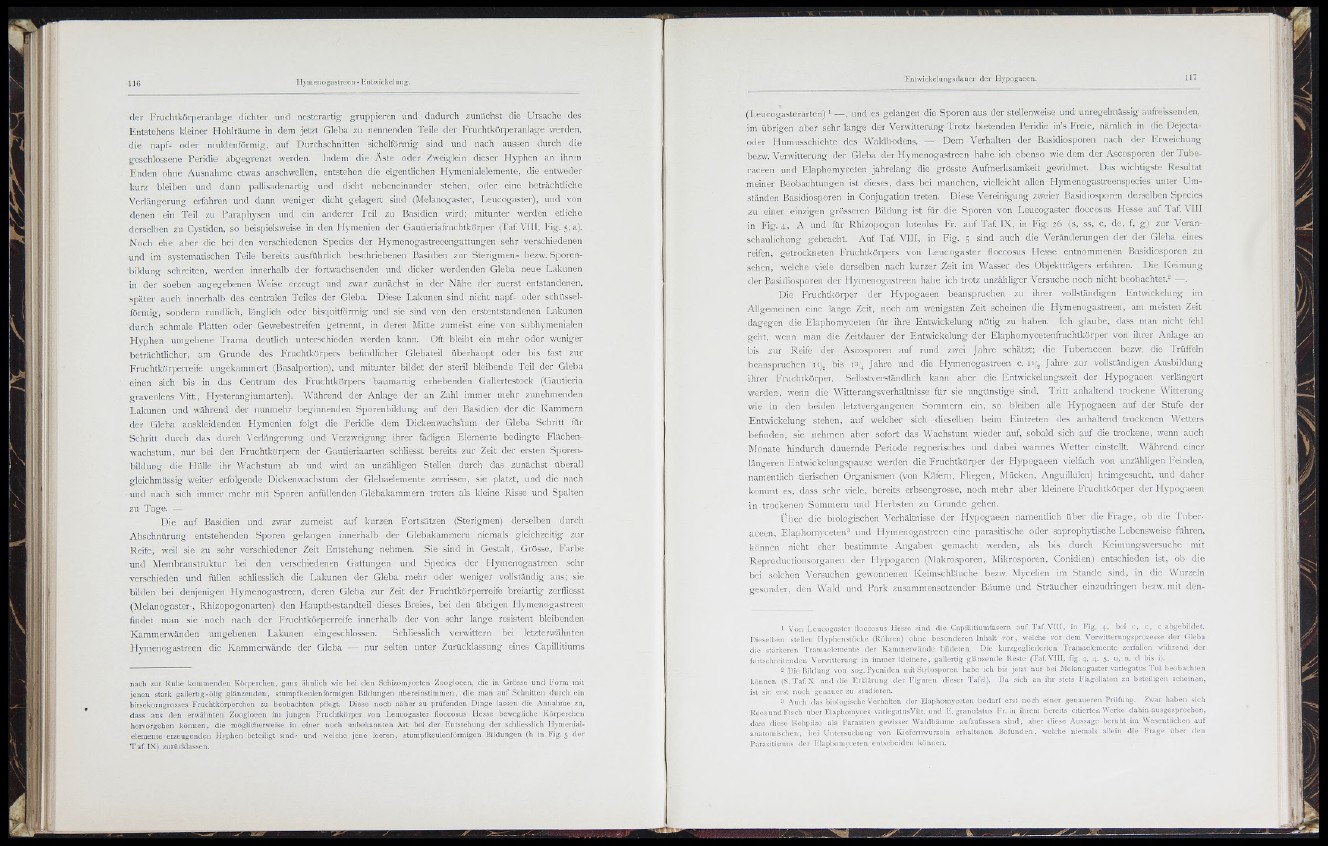
der Fruchtkörperanlage dichter und nesterartig gruppieren und dadurch zunächst die Ursache des
Entstehens kleiner Ilohlräume in dem jetzt Gleba zu nennenden Teile der Fruchtkörperanlage werden,
die napf- oder muldenförmig, auf Durchschnitten sichelförmig sind und nach aussen durch die
geschlossene Peridie abgegrenzt werden. Indem die Äste oder Zweiglein dieser Hyphen an ihren
Enden ohne Ausnahme etwas anschwellen, entstehen die eigentlichen Hymenialelemente, die entweder
kurz bleiben und dann pallisadenartig und dicht nebeneinander stehen, oder eine beträchtliche
Verlängerung erfahren und dann weniger dicht gelagert sind (Melanogaster, Leucogaster), und von
denen ein Teil zu Paraphysen und ein anderer Teil zu Basidien wird; mitunter werden etliche
derselben zu Cystiden, so beispielsweise in den Hymenien der Gautieriafruchtkörper (Taf VIII, Fig. 5, a).
Noch ehe aber die bei den verschiedenen Species der Hymenogastreeengattungen sehr verschiedenen
und im .systematischen Teile bereits ausführlich beschriebenen Basidien zur Sterigmen- bezw. Sporenbildung
schreiten, werden innerhalb der fortwachsenden und dicker werdenden Gleba neue Lakunen
in der soeben angegebenen AVeise erzeugt und zwar zunächst in der Nähe der zuerst entstandenen,
später auch innerhalb des centralen Teiles der Gleba. Diese Lakunen sind nicht napf- oder schüssel-
förmio-, sondern rundlich, länglich oder bis<iuitfÖrmig und sie sind von den erstentstandenen Lakunen
durch schmale Platten oder Gewebestreifen getrennt, in deren Alitte zumeist eine von subhymenialen
Hyphen umgebene Trama deutlich unterschieden werden kann. Oft bleibt ein mehr oder weniger
beträchtlicher, am Grunde des Fruchtkörpers befindlicher Giebateil überhaupt oder bis fast zur
Fruchtkörperreife ungekammert (Basalportion), und mitunter bildet der steril bleibende Teil der Gleba
einen sich bis in das Centrum des Fruchtkörpers baumartig erhebenden Gallertestock (Gautieria
graveolens A'itt., Hysterangiumarten). AA'ährend der Anlage der an Zahl immer mehr zunehmenden
I,akunen und während der nunmehr beginnenden Sporenbildung auf den Basidien der die Kammern
der Gleba auskleidenden Hymenien folgt die Peridie dem Dickenwachstum der Gleba Schritt für
Schritt durch das durch A'erlängerung und Verzweigung ihrer fädigen Elemente bedingte Flächenwachstum,
nur bei den Fruchtkörpern der Gautieriaarten schliesst bereits zur Zeit der ersten Sporenbildung
die Hülle ihr AVachstum ab und wird an unzähligen Stellen durch das zunächst überall
gleichmässig weiter erfolgende Dickenwachstum der Glebaelemente zerrissen, sie platzt, und die nach
und nach sich immer mehr mit Sporen anfüllenden Glebakammern treten als kleine Risse und Spalten
zu Tage. —
Die auf Basidien und zwar zumeist auf kurzen Fortsätzen (Sterigmen) derselben durch
Abschnümng entstehenden Sporen gelangen innerhalb der Glebakammern niemals gleichzeitig zur
Reife, weil sie zu sehr verschiedener Zeit Entstehung nehmen. Sie sind in Gestalt, Grösse, Farbe
und Membranstruktur bei den verschiedenen Gattungen und Species der Hymenogastreen sehr
verschieden und füllen schliesslich die Lakunen der Gleba mehr oder weniger vollständig aus; sie
bilden bei denjenigen Flymenogastreen, deren Gleba zur Zeit der Fruchtkörperreife breiartig zerfliesst
(Melanogaster-, Rhizopogonarten) den Hauptbestandteil dieses Breies, bei den übrigen Hymenogastreen
findet man sie noch nach der Fruchtkörperreife innerhalb der von sehr lange resistent bleibenden
Kammerwänden umgebenen Lakunen eingeschlossen. Schliesslich verwittern bei letzterwähnten
Hymenogastreen die Kammerwände der Gleba — nur selten unter Zurücklassung eines Capillitiums
nach zur Ruhe komruenden Körperchen, ganz ähnlich wie bei den Schizomyceten Zoogloeen, die in Grösse und Form mit
jenen stark gallertig-ölig glänzenden, stumpfkeulenförmigen Bildungen übereinstimmen, die man auf Schnitten durch ein
hirsekorngrosses Fruchtkörperchen zu beobachten pflegt. Diese noch näher zu prüfenden Dinge lassen die Annahme zu,
dass aus den erwähnten Zoogloeen im jungen Fruchtkörper von Leucogaster floccosus Hesse bewegliche Körperchen
hervorgehen können, die möglicherweise in einer noch unbekannten Art bei der Entstehung der schliesslich Hymoniai-
elemente erzeugenden Hyphen beteiligt sind’ und welche jene leeren, stumpfkeulenförmigen Bildungen (h in Fig. 5 der
T af.IX) zurücklassen.
(Leucogasterarten) ’ — , und es gelangen die Sporen aus der stellenweise und unregelmässig aufreissenden,
im übrigen aber sehr lange der Verwitterung Trotz bietenden Peridie in’s Freie, nämlich in die Dejecta-
oder Humusschichte des AValdbodens. — Dem Verhalten der Basidiosporen nach der Erweichung
bezw. A'erwitterung der Gleba der Hymenogastreen habe ich ebenso wie dem der Ascosporen der Tuberaceen
und Elaphomyceten jahrelang die grösste Aufmerksamkeit gewidmet. Das wichtigste Resultat
meiner Beobachtungen ist dieses, dass bei manchen, vielleicht allen Hymenogastreenspecies unter Umständen
Basidiosporen in Conjugation treten. Diese Vereinigung zweier Basidiosporen derselben Species
zu einer einzigen grösseren Bildung ist für die Sporen von Leucogaster floccosus Hesse auf T a f VIII
in Fig. 4, A und für Rhizopogon luteolus Fr. auf T a f IX , in Fig. 26 (s, ss, c, de, f, g) zur Veranschaulichung
gebracht. Auf Taf. VIII, in Fig. 5 sind auch die Veränderungen der der Gleba eines
reifen, getrockneten Fruchtkörpers von Leucogaster floccosus Hesse entnommenen Basidiosporen zu
sehen, welche viele derselben nach kurzer Zeit im Wasser des Objektträgers erfahren. Die Keimung
der Basidiosporen der Hymenogastreen habe ich trotz unzähliger A'ersuche noch nicht beobachtet.® —.
Die Fruchtkörper der Hypogaeen beanspruchen zu ihrer vollständigen Entwickelung im
Allgemeinen eine lange Zeit, noch am wenigsten Zeit scheinen die Hymenogastreen, am meisten Zeit
dagegen die Elaphomyceten für ihre Entwickelung nötig zu haben. Ich glaube, dass man nicht fehl
geht, wenn man die Zeitdauer der Entwickelung der Elaphomycetenfruchtkörper von ihrer Anlage an
bis zur Reife der Ascosporen auf rund zwei Jahre schätzt; die Tuberaceen bezw, die Trüffeln
beanspruchen n/g bis i'sq Jahre und die Hymenogastreen c. u/.^ Jahre zur vollständigen Ausbildung
ihrer Fruchtkörper, Selbstverständlich kann aber die Entwickelungszeit der Hypogaeen verlängert
werden, wenn die AAÜtterungsverhältnisse für sie ungünstige sind. Tritt anhaltend trockene Witterung
wie in den beiden letztvergangenen Sommern ein, so bleiben alle Hypogaeen auf der Stufe der
Entwickelung stehen, auf welcher sich dieselben beim Eintreten des anhaltend trockenen AVetters
befinden, sie nehmen aber sofort das AA'achstum wieder auf, sobald sich auf die trockene, wenn auch
Monate hindurch dauernde Periode regnerisches und dabei warmes AVetter einstellt. AA'ährend einer
läno-eren Entwickelung.spause werden die Fruchtkörper der Hypogaeen vielfach von unzähligen Feinden,
namentlich tierischen Organismen (von Käfern, Fliegen, Alücken, Anguillulen) heimgesucht, und daher
kommt es, dass sehr viele, bereits erbsengrosse, noch mehr aber kleinere Fruchtkörper der Hypogaeen
in trockenen Sommern und Herbsten zu Grunde gehen.
Über die biologischen A'erhältnisse der Hypogaeen namentlich über die Frage, ob die Tuberaceen,
Elaphomyceten® und TI)-menogastreen eine parasitische oder saprophytische Lebensweise führen,
können nicht eher bestimmte Angaben gemacht werden, als bis durch Keimungsversuche mit
Reproductionsorganen der Hypogaeen (Makrosporen, Alikrosporen, Conidien) entschieden ist, ob die
bei solchen A'ersuchen gewonnenen Keimschläuche bezw. Alycelien im Stande sind, in die AA'urzeln
gesunder, den AVald und Park zusammensetzender Bäume und Sträucher einzudringen bezw. mit den-
1 Von Leucogaster floccosus Hesse sind die Capillitiurafasern auf Taf. VIII, in Fig. 4, bei c, c , c abgebildet.
Dieselben stellen Hypbenstücke (Röhren) ohne besonderen Inhalt vor, welche vor dem Verwitterungsprozesse der Gleba
die stärkeren Trainaelemcnte der Kammerwände bildeten. Die kurzgegliedertcn Tramaelemente zerfallen während der
fovtschreiteiulen Verwitterung in immer kleinere, gallertig glänzende Reste (Taf. Vlll, fig. 4, 4. 5, u, n, d bis i).
2 Die Bildung von sog. Pycniden mit Stylosporen habe ich bis jetzt nur bei Melanogaster variegatus Tul. beobachten
können (S. Taf.X und die Erklärung der Figuren dieser Tafel). Da sich an ihr stets Flagellaten zu beteiligen scheinen,
ist sie erst noch genauer zu studieren.
3 Auch das biologische Verhalten der Elaphomyceten bedarf erst noch einer genaueren Prüfung. Zwar haben sich
Rees und Fisch über Elaphomyces variegatusVitt. und E. granulatus Fr. in ihrem bereits citierten Werke dahinausgesprochen,
dass diese Rehpilze als Parasiten gewisser Waldbäuine aufzufassen sind, aber diese .-Vussage beruht
auatomisdien, bei Untersuchung von Kiefernwurzeln erhaltenen Befunden,
Parasitismus der Elaphomyceten entscheiden können.
Wesentlichen auf
’eiche niemals allein die Frage über den