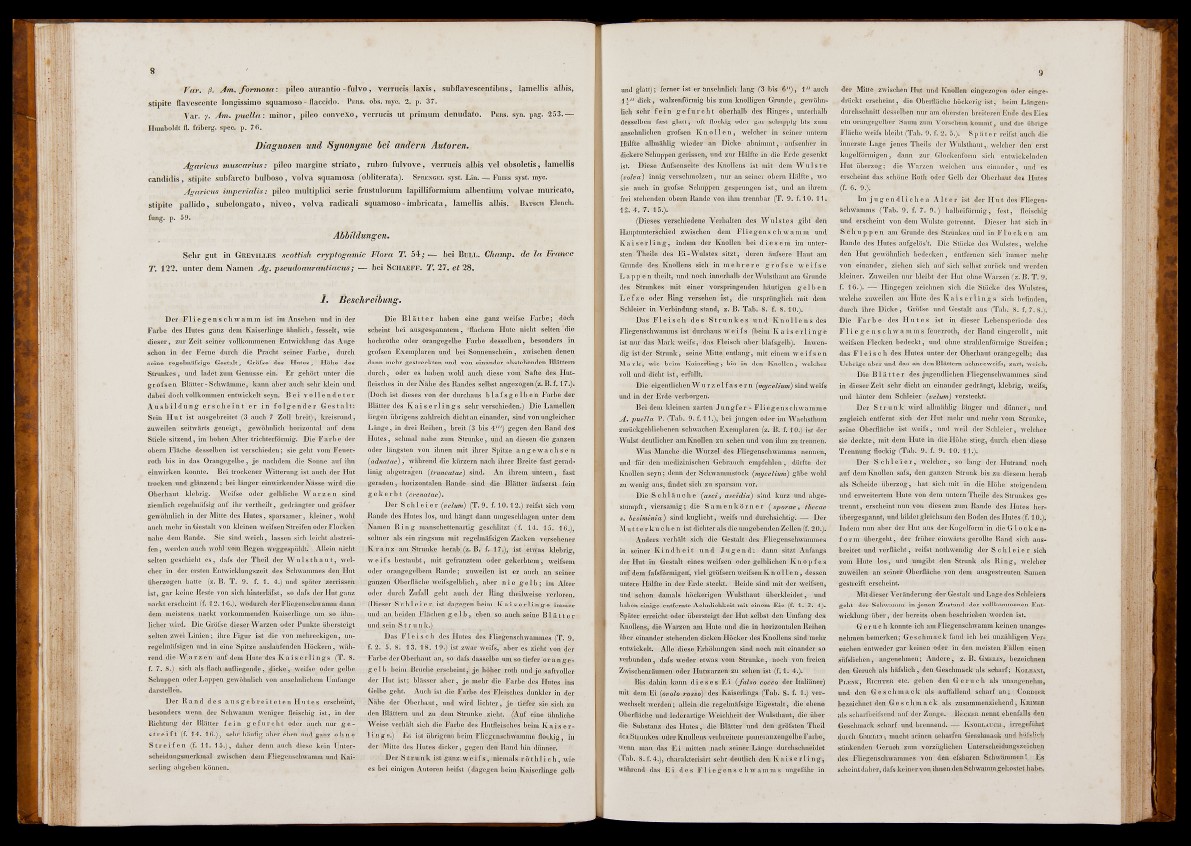
Var. ß. Am. formosa : pileo aurantio - fulvo, verrucis laxis, subflavescentibns, lamellis albis,
stìpite flavescente longissimo squamoso - flaccido. PERS. óbs. myc. 2. p. 37.
Var. y. Am. puella: minor, pileo convexo, verrucis ut primum denudato. PERS. syn. pag. 253.—
Humboldt fl. friberg. spec. p. 76.
Diagnosen und Synonyme bei andern Autoren.
Agariciis muscaria: pileo margine striato, rubro fulvove, verrucis albis vel obsoletas, lamellis
candiclis, stipite subfarcto bulboso, volva squamosa (obliterata). SPRENGEL syst. Lin FRIES syst. myc.
AgariMM imperialis : pileo multiplici serie frustulorum lapilliformium albentium volvae muricato,
stipite pallido, subelongato, niveo, volva radicali squamoso-imbricata, lamellis albis. BATSCH Elench.
fung. p. 59.
Abbildungen.
Sehr gut in GREVILLES scottish cryptogamic Flora T. 54; -— bei BULL. Champ. de la France
T. 122. unter dem Namen Ag. pseudoaiirantiacus; <— bei SCHAEFF. T. 27. et 28.
1. Beschreibung.
Der F l i e g e n s c hwamm ist im Ansehen und in der
Farbe des Hutes ganz dem Kaiserlinge ähnlich, fesselt, wie
dieser, zur Zeit seiner vollkommenen Entwicklung das Auge
schon in der Ferne durch die Pracht seiner Farbe, durch
seine regelmäfsige Gestalt, Gröfse des Hutes, Höhe des
Strunkes, und ladet zum Genüsse ein. Er gehört unter die
g r o f s e n Blätter-Schwämme, kann aber auch sehr klein und
dabei doch vollkommen entwickelt seyn. Bei vollendeter
A u s b i l d u n g erscheint er in folgender Gestalt:
Sein Hut ist ausgebreitet (3 auch 7 Zoll breit)*, kreisrund,
zuweilen seitwärts geneigt, gewöhnlich horizontal auf dem
Stiele sitzend, im hohen Alter trichterförmig. Die F a rbe der
obern Fläche desselben ist verschieden; sie geht vom Feuer?
roth bis in das Orangegelbe, je nachdem die Sonne auf ihn
einwirken konnte. Bei trockener Witterung ist auch \der Hut
trocken und glänzend; bei länger einwirkender Nässe wird die
Oberhaut klebrig. Weifse oder gelbliche W a r z e n sind
ziemlich regelmäfsig auf ihr vertheilt, gedrängter und gröfser
gewöhnlich in der Mitte des Hutes, sparsamer, kleiner, wohl
auch mehr in Gestalt von kleinen weifsen Streifen oder Flocken
nahe dem Rande. Sie sind weich, lassen sich leicht abstreifen
, werden auch wohl vom Regen weggespühlt." Allein nicht
selten geschieht es, dafs der Theil der W u l s t h a u t , welcher
in der ersten Entwicklungszeit des Schwammes den Hut
überzogen hatte (z. B. T. 9. f. 1. 4.) und später zerrissen
ist, gar keine Reste von sich hinterläfst, so dafs der Hut ganz
nackt erscheint (f. 12.16.), wodurch derFliegenschwämm dann
dem meistens nackt vorkommenden Kaiserlinge um so ähnlicher,
wird. Die .Gröfse dieser Warzen oder Punkte übersteigt
selten zwei Linien; ihre Figur ist die von mehreckigen, unregebnäfsigen
und in eine Spitze auslaufenden Höckern, während
die W-a r z e n auf dem Hütendes K a i s e r 1 i n g s (T. 8.
f. 7. 8.) sich als flach aufliegende,.idicke^^veifse oder gelbe
Schuppen oder Lappen gewöhnlich von ansehnlichem Umfange
darstellen.
Der Rand des ausgebrei teten Hutes erscheint^
besonders wenn der Schwamm weniger fleischig ist, in der
Richtung der Blätter fei n gefurcht oder auch nur ges
t r e i f t ' (f. 14. 16.), sehr häufig aber eben Und ganz ohne
S t r e i f e n (f. 11. 15.), daher denn auch diese kein Unterscheidungsmerkmal
zwischen dem Fliegenschwamm und Kaiserling
abgeben können.
Die Blät ter haben eine ganz weifse Farbe; doch
scheint bei ^ausgespanntem, 'flachem Hute nicht selten die
hochrothe oder orangegelbe Farbe desselben, besonders in
grofsen Exemplaren und bei Sonnenschein, zwischen denen
dann mehr gestreckten und von einander abstehenden Blättern
durch, oder es haben wohl auch diese vom Safte des Hutfleisches
in der Nähe des Randes selbst angezogen (z. B. f. 17.)i
(Doch ist dieses von der durchaus b l a f s g e l b e n Farbe der
Blätter des K a i s e r l i n g s sehr verschieden.) Die Lamellen
liegen übrigens zahlreich dicht an einander, sind von ungleicher
Länge, in drei Reihen, breit (3 bis 4'") gegen den Rand des
Hutes, schmal nahe zum Strünke, und an diesen die ganzen
oder längsten von ihnen mit ihrer Spitze angewachsen
(ädnatae), während die kürzern nach ihrer Breite fast geradlinig
abgetragen (trimcatae) sind. An ihrem untern, fast
geraden, horizontalen Rande sind die Blätter äufserst fein
gekerbt (crenatae).
Der S c h l e i e r (velum) (T. 9. f. 10.12.) reifst sich vom
Rande des Hutes los, und hängt dann umgeschlagen unter dem
Namen R ing manschettenartig geschlitzt (f. .14. 15. 16.),
seltner als ein ringsum mit regelmäfsigen Zacken versehener
K r a n z am Strünke herab (z. B. f. 17.), ist etwas klebrig,
w e i f s bestaubt, mit gefranztem oder gekerbtem, weifsem
oder orangegelbem Rande; zuweilen ist er auch an seiner
ganzen Oberfläche weifsgelblich, aber nie gelb; im Alter
oder durch Zufall geht auch der Ring theilweise verloren.
(Dieser S c h l e i e r ist dagegen beim K a i s e r l i n g e immer
und an, beiden Flächen g efl b , eben so auch seine B1 ä 11 e r
und sein >Str u n k X ,
Das F l e i s c h des Hutes des Fliegenschwammes (T. 9.
f. 2. 5. 8°. 13. 18. 10.) ist ztyar weifsTaber es zieht von der
Farbe der Oberhaut an, so dafs dasselbe um so tiefer *or a n g egelb
beim Bruche erschein|;£ j e höher roth und j e saftvoller
der Hut ist; blässer aber, je mehr die Farbe des Hutes ins
Gelbe geht. Auch ist die Farbe des Fleisches dunkler in der
Nähe der Oberhaut, und wird lichter, je tiefer sie sich zu
den Blättern und zu .dem Strünke rzieht. (Auf eine ähnliche
W eise verhält sich die Farbe des Hutfleisclres beim Kai ser -
l i n g e . ) Es ist übrigens beim Fliegenschwamme flockig, in
der Mitte des Hutes dicker, gegen-den Rand hin dünner.
; Der S t r u n k ist g;a"nz. w e i f s , niemals r ö t h l i c h , wie
es bei einigen Autoren heifst (dagegen beim Kaiserlinge gel;b
und glatt) ; ferner ist er ansehnlich lang (3 bis 6"), 1 " auch
1 d i c k , walzenförmig bis zum knolligen Grunde, gewöhnlich
seht f e i n gefurcht oberhalb des Ringes, unterhalb
desselben fast glatt ^ oft flockig oder gar schuppig bis zum
ansehnlichen grofsen K n o l l e n , welcher in seiner untern
Hälfte allmählig wieder" an Dicke abnimmt, aufsenher in
dickere Schuppen gerissen, und zur Hälfte in die Erde gesenkt
ist. Diese Aufsenseite des Knollens ist mit dem Wulst©
(volva) innig verschmolzen, nur an seiner obern Hälfte, wo
sie auch in gröfse Schuppen gesprungen ist, und an ihrem
frei stehenden obern Rande von ihm trennbar (T. 9. f. 10. 11.
(Dieses verschiedene "Verhalten des Wulstes gibt den
Hauptunterschied zwischen dem Fliegenschwamm und
K a i s e r l i n g , indem der Knollen bei d i e s e m im untersten
Theile des Ei-Wulstes sitzt, deren äufsere Haut am
Grunde' des Knollens sich in m e h r e r e grofse w 6 i f s e
L a p p e n theilt, und noch innerhalb der Wulsthaut am Grunde
des Strunkes mit einer vorspringenden häutigen gelben
L e f z e oder Ring versehen ist, die ursprünglich mit dem
Schleier in Verbindung stand, z. B. Tab. 8. f. 8. 1 ().).'
Das F1 e i s c h - d e s S t runkes und Knol lens des
Fliegenschwamms ist durchaus w e'i f s (beim K a i s e r l inge
ist nur das Mark weifs, das Fleisch aber Maisgelb);1 Inwendig
ist der Strunk, seine Mitte entlang, mit einem w e i f s e n
M a r k , wie beim Kaiserling, bis in den Knollen, welcher
voll und dicht ist, erfüllt.
Die eigentlichen W u r z e l f a s e r n (mycélium) sind weifs
und in der Erde verborgen.
iBei dem Ideinen zarten Jungfer - F l i e g e n s c hwamm e
A. puella P. (Tab. 9. f. 11.), bei jungen oder im Wachsthum
zurückgebliebenen schwächen Exemplaren (z. B. f. 10.) ist der
•Wulst deutlicher am Knollen zu sehen und von ihm zu trennen.
Was -Manche die Wurzel dès Fliegenschwamms nennen,
und für den medizinischen Gebrauch empfehlen, dürfte der
Knollen seyn; denn der Schwammstock (myceliwn) gäbe wohl
zu wenig aus, findet sich zu sparsam vor.
r Die;iS c l i läuCihe (asci, ascidia) sind kurz und abgestumpft
, viersamig ; die S ame n k ö r n e r ( sporae, thecae
s. besiminia) sind kuglicht, weifs und durchsichtig. —H- Der
M u t t e r k u c h e n ist dichter als diè umgebenden Zellen (f. 20.).
Anders verhält sich die "Gestalt des Fliegenschwammes
in seiner K i n d h e i t und Jugend: dann sitzt Anfangs
,der Hut ; in Gestalt eines weifsen oder gelblichen Knopfes
auf dem fafsförmigerf', viel gröfsern wei f senKh o;ll'en, dessen
untere Hälfte in der Erde steckt. Beide sind mit der weifsen,
und schon damals höckerigen Wulsthaut überkleidet, und
haben einige entfernte Aehnliclikeit mit einem Eie (f. 1. 3J.4).
Später erreicht oder übersteigt der Hut. selbst den Umfang des
Knollens, die Warzen am Hute und die in horizontalen Reihen
über einander stehenden dickén Höcker des Knollens sind mehr
entwickelt. Alle 'diese Erhöhungen sind noch mit einander so
Verbunden, dafs weder etwas vom Strünke, noch von freien
Zwischenräumen oder Hutwarzen zu sehen ist (f. 1. 4.);'T
Bis daliin kann d i e s e s Ei {falso cocco der Italiäner)
mit dem Ei (òvpfo rosso)- des Kaiserlings (Tab. 8. f. 1.) verwechselt
werden ; allein die regelmäfsige Eigestalt, die ebene
Oberfläche und lederartige, Weichheit der Wulsthaut, die über
die Substanz des Hutes, die Blätter und den gröfsten Theil
deSiStrunkes. oder Knollens verbreitete pomeranzengelbe Farbe,
Wenn man das Ei mitten iiacli'seiner Länge, durchschneidet
(Tab. 8. f. 4;),-' ch
arakterisixt seh;- deutlich deruKais e r 1 i ng,
"Während das. E i d e i s 'T l i e g e n s c h w a m TU S ungefähr in
dèr sMlttè zwischen' Hut und Knüllen eingezogen oder eingedrückt
erscheint, die Oberfläche höckerig ist, beim Längendm'dhschnitf
desselben nur am obersten breiteren Ende des Eies
ein bräh jegelber Saum zum "Vorschein kommt, und die übrige
Fläche 'weifs bËibt (Tab. 9. f. 2. '5;)Î'E Spätem reifst auch die
innerste Läge jenes Theils d'er Wulsthant „ welcher den erst
B%e«8nriigen, dann zur Glockenform sich entwickelnden
Hut iibe'rzo'g; die AV'arzen weichen aus einander, und es
erschÄS fas; schöne Roth bder Gelb der Oberhaut des Hutes JgpMM
Im j u g e n d l i c h e n Alter''ist der H u t des Fliegen-
Sckvainms ( T a b ! f . 7. ötf^fialbeiförttiig, fest, fleischig
Wd£MjjpSjhti von dem Wulste getrennt. Dieser, hat sich in
S™hu p-p'ett am gründe des Strunkes und in F l o cke n am
Rande des Hute.s aufgelös't. Hie' Stücke des Wulstes, welche
den Hut; gewöhnlich btedeiäjiöi, entfernen 8icS*immer mehr
Von einahder, 'Meh|n''sich1 auf sich"èélbst zurück und werden
Héinér'. ''Zufeëilen nur bleibt der Hut ohne Warzen (zl'B. T. 9.
ifi l#^^B' 'Hing%efi' 'zeichnen sich die Stücke des Wulstes,
welche zuweilen am Hîitê des K a i s e rT i n g'*s sich befinden,
durch Sfafee Dicke j 'Gföfse und Gestalt aus (Tab. 8. f. 7. 8.).
Die '"Bar b e • des Ä Ä t Ä ^ i ist in diesei Lebensperiode des
F l i e g ! a ^ j n ^ . i j j u e r r o t h , der Rand eingerollt, mit
weifsen Flecken bedeckt, und ohne strahlenförmige Streifen;
das F l e i s c h des;Hutes unter der Oberhaut prangegelb; das
XJebrig'e, aber und 'das; an den Müttern schneeweifs,; zart, weich,
'.'¿•Die B l ä t t e r des jugendlichen FJir'genschwarmnes sind
in dicSer Zeiti sehr ;dicht an einander, gedrängt, klebrig, weifs,
und hinter dem Sdhleieri: (»eZ«w»|#ersteokt.
Der S t r uTn?kj wird allmählig. länger und dünner-, und
zugleich entfernt sich der Hut mehr und mehr vom Strünke,
seine ObérflâchftfSSfrweifs, und weil der Schleier, welcher
sie'deckte, mit. demi ¡Hute iii dieHöhe stieg, durch eben diese
Trennung lWckig früh: 9.'jf...9. 10. . 1 l | S |
:iAi®ér S chleierynsSlcher , ' •soiftngh der: Hutrand noch
auf dem Iihollen safs,'den gaüzen Strunk bis zn diesem herab
als Scheide überzog, hat sibh mit in ;die Höhe steigendem
und . erweiteifeJn Hute von dem untern Theile des Strunkes ges
trennt,'.«erscheint nun.yöu diesem zum Rande des Hut.es heriibèrgesjpannt,
und bildet gleichsam den Boden des Hutes (f. 10.).
jîftdem Hun aber der Hut aus derKrigelforuTin die G l o c k e n?
f ô*m'Hiïbergeht|pder' früher einwärts gerollte Rand sich ausbreitet
und verflacht;,^reifst, nothwendig der S c h l e i e r sich
vom Hute los>,5 und umgibt .den Strunk als Ring, welcher
zuweilen, an"! seine'r Oberfläche von dem ausgestreuten Samen
'gestreift erscheint.
,-jifMit dieser Veränderung der Gestalt undLage des Schleiers
-geht' der-Schwamm in jenen Zustand der vollkommenen Entwicklung
über, der bereits • obeHj beschrieben worden ist,
G e r u c h konnte ich am Fliegenschwamm keinen unangenehmen
bemerken; Geschmack fand ich bei unzähjigen Ver-,
suchen entweder gar keinen oder, in den meisten Fällen einen
SÜfslicheny angenehmen ; Andere , z. B. GMELIN,? bezeichnen
den Geruch als häfsliSh, den Geschmack als scharf; KOLBAXI,
PLENK, RICHTER etc. -geben den G e r u c h als unangenehm,
und- den G e s c hma c k als auffallend scharf an; ? CORDIER
bezeichnet den G e s c)im a c k ALS zusammenziehend, KHIMEB
AFC scharfbeifsend auf der Zunge. BECKER nennt ebenfalls den
Geschmack scharf und b r ennend. ^ ¡KSOBLAUCH,, irregeführt
durch GMELIN, macht seinen scharfen Geschmack und häfslich
-stinkenden Geruch zum vorzüglichen Unterscheidungszeichen
dés .Fliegenschwammes von den efsbaren Schwämmen ! Es
scheint daher, dafs keiner von ihnen den Schwamm gekostet habe,