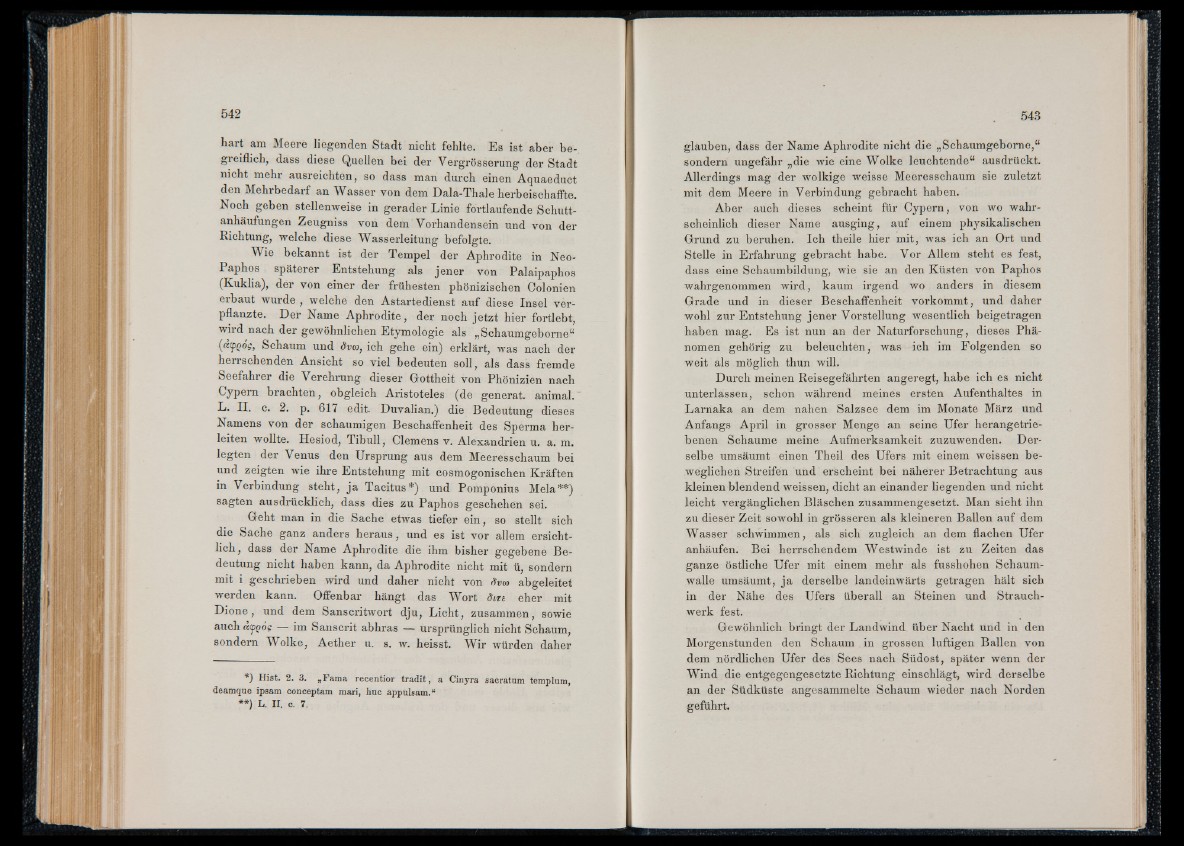
hart am Meere liegenden Stadt nicht fehlte. Es ist aber begreiflich,
dass diese Quellen bei der Vergrösserung der Stadt
nicht mehr ausreichten, so dass man durch einen Aquaeduct
den Mehrbedarf an Wasser von dem Dala-Thale herbeischaffte.
Noch geben stellenweise in gerader Linie fortlaufende Schuttanhäufungen
Zeugniss von dem Vorhandensein und von der
Richtung, welche diese Wasserleitung befolgte.
Wie bekannt ist der Tempel der Aphrodite in Neo-
Paphos späterer Entstehung als jen e r von Palaipaphos
(Kuklia), der von einer der frühesten phönizischen Colonien
erbaut wurde , welche den Astartedienst auf diese Insel verpflanzte.
De r Name Aphrodite, der noch je tz t hier fortlebt,
wird nach der gewöhnlichen Etymologie als „Schaumgebome“
(dfgos, Schaum und ävm, ich gehe ein) erklärt, was nach der
herrschenden Ansicht so viel bedeuten soll, als dass fremde
Seefahrer die Verehrung dieser Gottheit von Phönizien nach
Cypern bra chten, obgleich Aristoteles (de generat. animal.
L. ü . c. 2. p. 617 edit. Duvalian.) die Bedeutung dieses
Namens von der schaumigen Beschaffenheit des Sperma herleiten
wollte. Hesiod, Tibull, Clemens v. Alexandrien u. a. m.
legten der Venus den Ursprung aus dem Meeresschaum bei
und zeigten wie ihre Entstehung mit cosmogonischen Kräften
in Verbindung steh t, j a T a c itu s*) und Pomponius Mela**)
sagten ausdrücklich, dass dies zu Paphos geschehen sei.
Geht man in die Sache etwas tiefer e in , so stellt sich
die Sache ganz anders h e rau s, und es ist vor allem ersichtlich
, dass der Name Aphrodite die ihm bisher gegebene Bedeutung
nicht haben kann, da Aphrodite nicht mit ü, sondern
mit i geschrieben wird und daher nicht von övco abgeleitet
werden kann. Offenbar hängt das Wort dne eher mit
D io n e , und dem Sanseritwort dju, L ich t, zusammen, sowie
auch aygos — im Sanscrit abhras — ursprünglich nicht Schaum,
sondern Wolke, Aether u. s. w. heisst. Wir würden daher
*) Hist. 2. 3. „Fama reeentior tr a d ii, a Cinyra sacratam templum,
deamqne ipsam conceptam mari, huc appulsam.“
**) L. II. c. 7.
glauben, dass der Name Aphrodite nicht die „Schaumgeborne,“
sondern ungefähr „die wie eine Wolke leuchtende“ ausdrückt.
Allerdings mag der wolkige weisse Meeresschaum sie zuletzt
mit dem Meere in Verbindung gebracht haben.
Aber auch dieses scheint für Cypern, von wo wahrscheinlich
dieser Name ausging, auf einem physikalischen
Grund zu beruhen. Ich theile hier mit, was ich an Ort und
Stelle in Erfahrung gebracht habe. Vor Allem steht es fest,
dass eine Schaumbildung, wie sie an den Küsten von Paphos
wahrgenommen wird, kaum irgend wo anders in diesem
Grade und in dieser Beschaffenheit vorkommt, und daher
wohl zur Entstehung jen e r Vorstellung wesentlich beigetragen
haben mag. Es ist nun an der Naturforschung, dieses Phänomen
gehörig zu beleuchten, was ich im Folgenden so
weit als möglich thun will.
Durch meinen Reisegefährten angeregt, habe ich es nicht
unterlassen, schon während meines ersten Aufenthaltes in
L arn ak a an dem nahen Salzsee dem im Monate März und
Anfangs April in grösser Menge an seine Ufer herangetriebenen
Schaume meine Aufmerksamkeit zuzuwenden. De rselbe
umsäumt einen Theil des Ufers mit einem weissen b e weglichen
Streifen und erscheint bei näherer Betrachtung aus
kleinen blendend weissen, dicht an einander liegenden und nicht
leicht vergänglichen Bläschen zusammengesetzt. Man sieht ihn
zu dieser Zeit sowohl in grösseren als kleineren Ballen auf dem
Wasser schwimmen, als sich zugleich an dem flachen Ufer
anhäufen. Bei herrschendem Westwinde ist zu Zeiten das
ganze östliche Ufer mit einem mehr als fusshohen Schaumwalle
umsäumt, j a derselbe landeinwärts getragen hält sich
in der Nähe des Ufers überall an Steinen und Strauchwerk
fest.
Gewöhnlich bringt der Landwind über Nacht und in den
Morgenstunden den Schaum in grossen luftigen Ballen von
dem nördlichen Ufer des Sees nach Südost, später wenn der
Wind die entgegengesetzte Richtung einschlägt, wird derselbe
an der Südküste angesammelte Schaum wieder nach Norden
geführt.