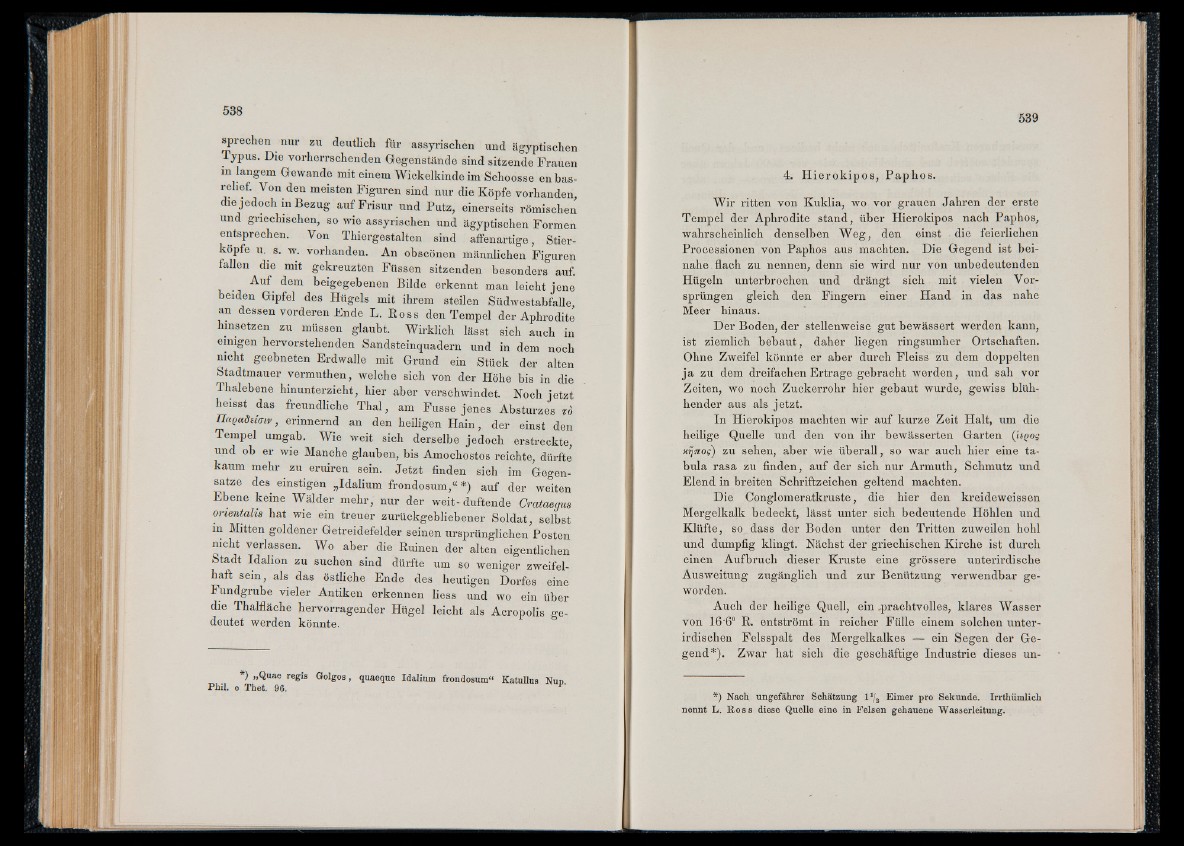
sprechen nur zu deutlich für assyrischen und ägyptischen
Typus. Die vorherrschenden Gegenstände sind sitzende Frauen
m langem Gewände mit einem Wickelkinde im Schoosse enbas-
relief. Von den meisten Figuren sind nur die Köpfe vorhanden,
die jedoch in B ezug auf Frisur und Putz, einerseits römischen
und griechischen, so wie assyrischen und ägyptischen Formen
entsprechen. Von Thiergestalten sind affenartige, Stierköpfe
u. s. w. vorhanden. An obscönen männlichen Figuren
fallen die mit gekreuzten Füssen sitzenden besonders auf.
Auf dem beigegebenen Bilde erkennt man leicht jene
beiden Gipfel des Hügels mit ihrem steilen Südwestabfalle,
an dessen vorderen Ende L. Ross den Tempel der Aphrodite
hinsetzen zu müssen glaubt. Wirklich lässt sich auch in
einigen hervorstehenden Sandsteinquadern und in dem noch
nicht geebneten Erdwalle mit Grund ein Stück der alten
Stadtmauer vermuthen, welche sich von der Höhe bis in die
Thalebene hinunterzieht, hier aber verschwindet. Noch je tz t
heisst das freundliche T h a l, am Fusse jenes Absturzes to
IlaQuddcnv, erinnernd an den heiligen H a in , der einst den
Tempel umgab. Wie weit sich derselbe jedoch erstreckte,
und ob er wie Manche glauben, bis Amochostos reichte, dürfte
kaum mehr zu eruiren sein. Je tz t finden sich im Gegensätze
des einstigen „Idalium frondosum,“ *) auf der weiten
Ebene keine Wälder mehr, nur der weit-duftende Crataegus
orientalis hat wie ein treue r zurückgebliebener Soldat, selbst
in Mitten goldener Getreidefelder seinen ursprünglichen Posten
nicht verlassen. Wo aber die Ruinen der alten eigentlichen
Stadt Idalion zu suchen sind dürfte um so weniger zweifelhaft
sein, als das östliche Ende des heutigen Dorfes eine
Fundgrube vieler Antiken erkennen liess und wo ein über
die Thalfläche hervorragender Hügel leicht als Acropolis gedeutet
werden könnte.
*) „Quae regís Golgos, quaeque Idalium frondosum“ Katullus Nud
Phil, e Thet. 96.
4. Hi e r ok i p o s , Papho s .
Wir ritten von Kuklia, wo vor grauen Jah ren der erste
Tempel der Aphrodite stan d , über Hierokipos nach Paphos,
wahrscheinlich denselben W eg , den einst die feierlichen
Processionen von Paphos aus machten. Die Gegend ist beinahe
flach zu nennen, denn sie wird nur von unbedeutenden
Hügeln unterbrochen und drängt sich mit vielen Vorsprüngen
gleich den Fingern einer Hand in das nahe
Meer hinaus.
Der Boden, der stellenweise gut bewässert werden kann,
ist ziemlich b eb au t, daher liegen ringsumher Ortschaften.
Ohne Zweifel könnte er aber durch Fleiss zu dem doppelten
j a zu dem dreifachen Ertrage gebracht werden, und sah vor
Zeiten, wo noch Zuckerrohr hier gebaut wurde, gewiss blüh-
hender aus als jetzt.
In Hierokipos machten wir auf kurze Zeit Halt, um die
heilige Quelle und den von ihr bewässerten Garten (ieQog
xijizog) zu sehen, aber wie ü b erall, so war auch hier eine ta bula
rasa zu finden, auf der sich nur Armuth, Schmutz und
Elend in breiten Schriftzeichen geltend machten.
Die Conglomeratkruste, die hier den kreideweissen
Mergelkalk bedeckt, lässt unter sich bedeutende Höhlen und
Klüfte, so dass der Boden unter den Tritten zuweilen hohl
und dumpfig klingt. Nächst der griechischen Kirche ist durch
einen Aufbruch dieser Kruste eine grössere unterirdische
Ausweitung zugänglich und zur Benützung verwendbar geworden.
Auch der heilige Quell, ein .prachtvolles, klares Wasser
von 16'6° R. entströmt in reicher Fülle einem solchen u n te rirdischen
Felsspalt des Mergelkalkes — ein Segen der Gegend*).
Zwar hat sich die geschäftige Industrie dieses un*)
Nach ungefährer Schätzung MM Eimer pro Sekunde. Irrthümlich
nennt L. l i o s s diese Quelle eine in Felsen gehauene Wasserleitung.