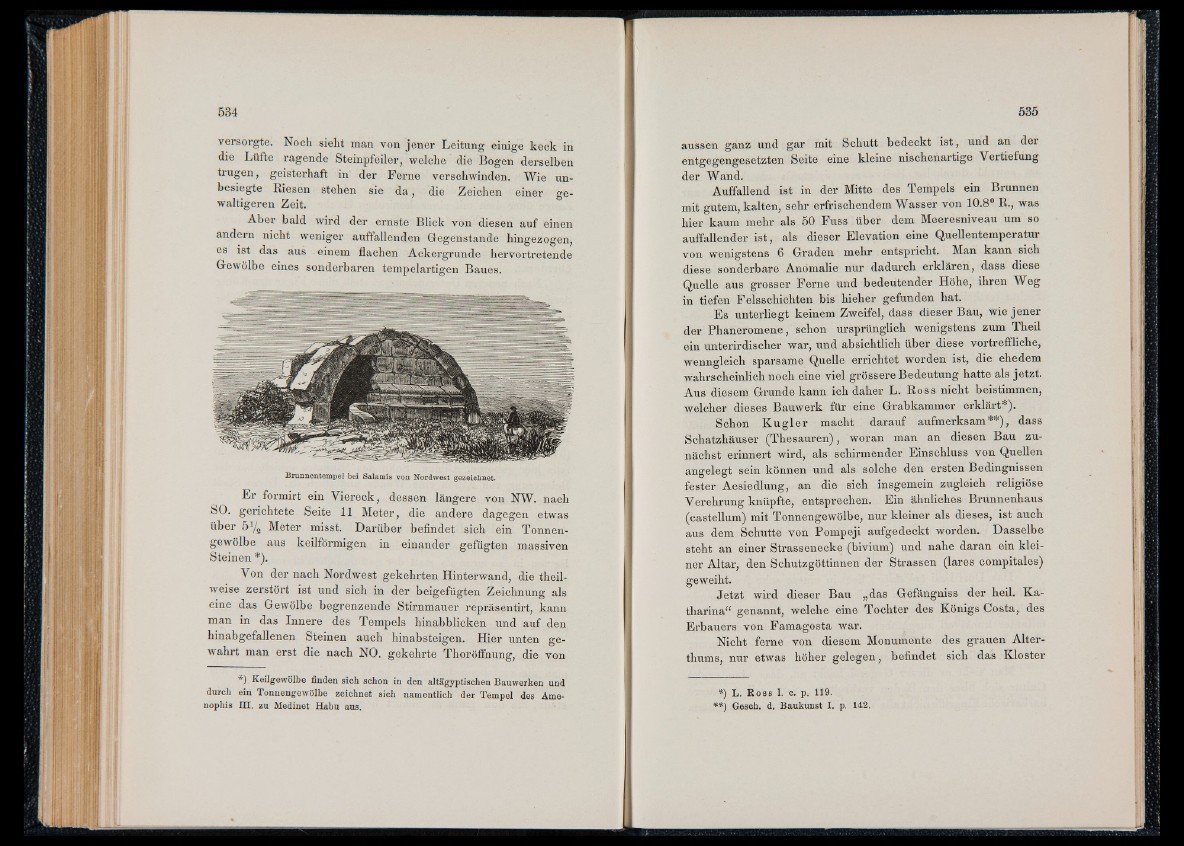
versorgte. Noch sieht man von jen e r Leitung einige keck in
die Lüfte ragende Steinpfeiler, welche die Bogen derselben
tru g en , geisterhaft in der Ferne verschwinden. Wie unbesiegte
Riesen stehen sie d a , die Zeichen einer gewaltigeren
Zeit.
Aber bald wird der ernste Blick von diesen auf einen
ändern nicht weniger auffallenden Gegenstände hingezogen,
es ist das aus einem flachen Ackergrunde hervortretende
Gewölbe eines sonderbaren tempelartigen Baues.
Brunnentempel bei Salamis von Nordwest gezeichnet.
E r formirt ein Viereck, dessen längere von NW. nach
SO. gerichtete Seite 11 Meter, die andere dagegen etwas
über 5 y 2 Meter misst. Darüber befindet sich ein Tonnengewölbe
aus keilförmigen in einander gefügten massiven
Steinen *).
Von der nach Nordwest gekehrten Hinterwand, die theil-
weise zerstört ist und sich in der beigefügten Zeichnung als
eine das Gewölbe begrenzende Stirnmauer repräsentirt, kann
man in das Innere des Tempels hinabblicken und auf den
hinabgefallenen Steinen auch hinabsteigen. Hier unten gewahrt
man erst die nach NO. gekehrte Thoröffnung, die von
*) Keilgewölbe finden sich schon in den altägyptischen Bauwerken und
durch ein Tonnengewölbe zeichnet sich namentlich der Tempel des Ame-
nophis III. zu Medinet Habu aus.
aussen ganz und gar mit Schutt bedeckt i s t , und an der
entgegengesetzten Seite eine kleine nischenartige Vertiefung
der Wand.
Auffallend ist in der Mitte des Tempels ein Brunnen
mit gutem, kalten, sehr erfrischendem W asser von 10.8° R., was
hier kaum mehr als 50 Fuss über dem Meeresniveau um so
auffallender is t, als dieser Elevation eine Quellentemperatur
von wenigstens 6 Graden mehr entspricht. Man kann sich
diese sonderbare Anomalie nur dadurch erk lä ren , dass diese
Quelle aus grösser Ferne und bedeutender Höhe, ihren Weg
in tiefen Felsschichten bis hieher gefunden hat.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser Bau, wie jen e r
der Phaneromene, schon ursprünglich wenigstens zum Theil
ein unterirdischer war, und absichtlich über diese vortreffliche,
wenngleich sparsame Quelle errichtet worden ist, die ehedem
wahrscheinlich noch eine viel grössere Bedeutung hatte als jetzt.
Aus diesem Grunde kann ich daher L. Ross nicht beistimmen,
welcher dieses Bauwerk für eine Grabkammer erklärt*).
Schon Ku g l e r macht darauf aufmerksam**), dass
Schatzhäuser (Thesauren), woran man an diesen Bau zunächst
erinnert wird, als schirmender Einschluss von Quellen
angelegt seih können und als solche den ersten Bedingnissen
fester Aesiedlung, an die sich insgemein zugleich religiöse
Verehrung knüpfte, entsprechen. Ein ähnliches Brunnenhaus
(castellum) mit Tonnengewölbe, nur kleiner als dieses, ist auch
aus dem Schutte von Pompeji aufgedeckt worden. Dasselbe
steht an einer Strassenecke (bivium) und nahe daran ein kleiner
Altar, den Schutzgöttinnen der Strassen (lares compitales)
geweiht.
Je tz t wird dieser Bau „das Gefängniss der heil. K a tharina“
genannt, welche eine Tochter des Königs Costa, des
Erbauers von Famagosta war.
Nicht ferne von diesem Monumente des grauen Alterthums,
nur etwas höher g eleg en , befindet sich das Kloster
*) L. R o s s 1. c. p. 119.
**) Gesch. d, Baukunst I. p. 142.