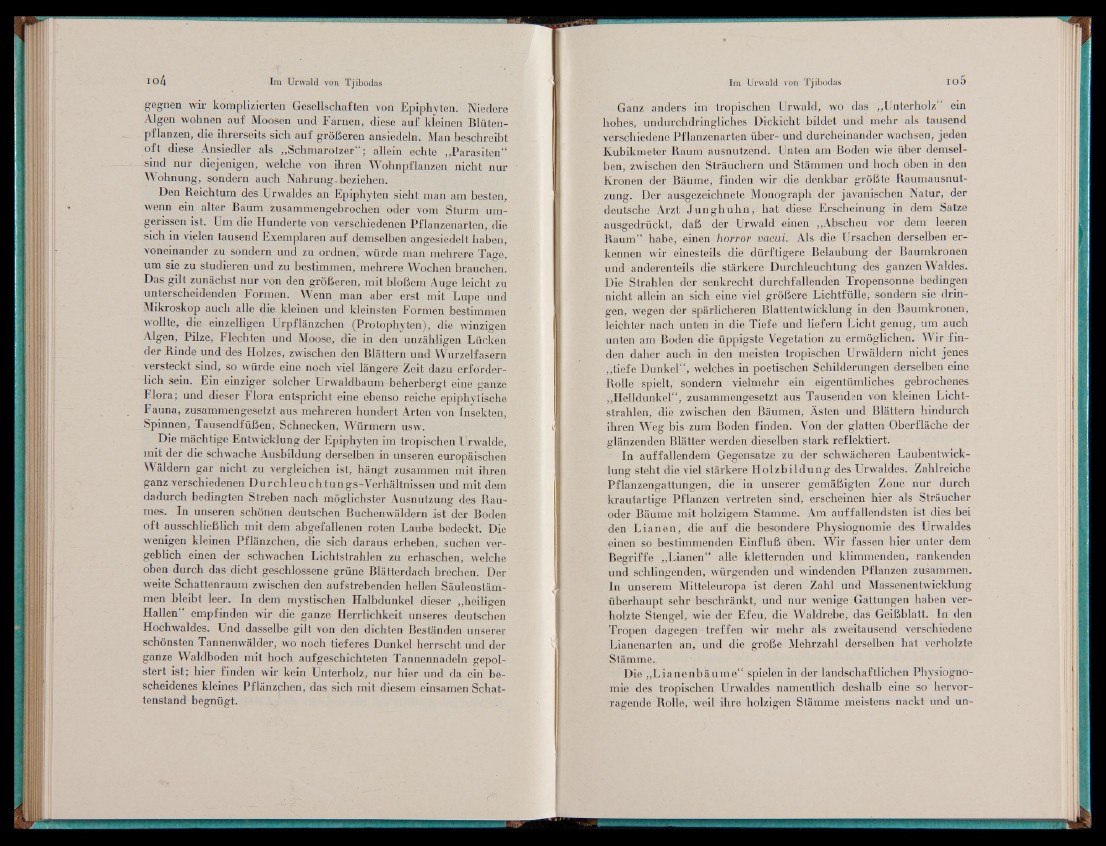
gegnen wir komplizierten Gesellschaften von Epiphyten. Niedere
Algen wohnen auf Moosen und Farnen, diese auf kleinen Blütenpflanzen,
die ihrerseits sich auf größeren ansiedeln. Man beschreibt
oft diese Ansiedler als „Schmarotzer“ ; allein echte „Parasiten“
sind nur diejenigen, welche von ihren Wohnpflanzen nicht nur
Wohnung, sondern auch Nahrung-beziehen.
Den Reichtum des Urwaldes an Epiphyten sieht man am besten,
wenn ein alter Baum zusammengebrochen oder vom Sturm umgerissen
ist. Um die Hunderte von verschiedenen Pflanzenarten, die
sich in vielen tausend Exemplaren auf demselben angesiedelt haben,
voneinander zu sondern und zu ordnen, würde man mehrere Tage,
um sie zu studieren und zu bestimmen, mehrere W ochen brauchen.
Das gilt zunächst nur von den größeren, mit bloßem Auge leicht zu
unterscheidenden Formen. Wenn man aber erst mit Lupe und
Mikroskop auch alle die kleinen und kleinsten Formen bestimmen
wollte, die einzelligen Urpflänzchen (Protophyten), die winzigen
Algen, Pilze, Flechten und Moose, die in den unzähligen Lücken
der Rinde und des Holzes, zwischen den Blättern und Wurzelfasern
versteckt sind, so würde eine noch viel längere Zeit dazu erforderlich
sein. Ein einziger solcher Urwaldbaum beherbergt eine ganze
Flora; und dieser Flora entspricht eine ebenso reiche epiphytische
Fauna, zusammengesetzt aus mehreren hundert Arten von Insekten,
Spinnen, Tausendfüßen, Schnecken, Würmern usw.
Die mächtige Entwicklung der Epiphyten im tropischen Urwalde,
mit der die schwache Ausbildung derselben in unseren europäischen
Wäldern gar nicht zu vergleichen ist, hängt zusammen mit ihren
ganz verschiedenen Durchleuchtungs-Verhältnissen und mit dem
dadurch bedingten Streben nach möglichster Ausnutzung des Raumes.
In unseren schönen deutschen Buchenwäldern ist der Boden
oft ausschließlich mit dem abgefallenen roten Laube bedeckt. Die
wenigen kleinen Pflänzchen, die sich daraus erheben, suchen vergeblich
einen der schwachen Lichtstrahlen zu erhaschen, welche
oben durch das dicht geschlossene grüne Blätterdach brechen. Der
weite Schattenraum zwischen den aufstrebenden hellen Säulenstämmen
bleibt leer. In dem mystischen Halbdunkel dieser „heiligen
Hallen empfinden wir die ganze Herrlichkeit unseres deutschen
Hochwaldes. Und dasselbe gilt von den dichten Beständen unserer
schönsten Tannenwälder, wo noch tieferes Dunkel herrscht und der
ganze Waldboden mit hoch auf geschichteten Tannennadeln gepolstert
ist; hier finden wir kein Unterholz, nur hier und da- ein bescheidenes
kleines Pflänzchen, das sich mit diesem einsamen Schattenstand
begnügt.
Ganz anders im tropischen Urwald, wo das „Unterholz“ ein
hohes, undurchdringliches Dickicht bildet und mehr als tausend
verschiedene Pflanzenarten über- und durcheinander wachsen, jeden
Kubikmeter Raum ausnutzend. Unten am Boden wie über demselben,
zwischen den Sträuchern und Stämmen und hoch oben in den
Kronen der Bäume, finden wir die denkbar größte Raumausnutzung.
Der ausgezeichnete Monograph der javanischen Natur, der
deutsche Arzt Junghuhn, hat diese Erscheinung in dem Satze
ausgedrückt, daß der Urwald einen „Abscheu vor dem leeren
Raum“ habe, einen horror vacui. Als die Ursachen derselben erkennen
wir einesteils die dürftigere Belaubung der Baumkronen
und anderenteils die stärkere Durchleuchtung des ganzen Waldes.
Die Strahlen der senkrecht durchfallenden Tropensonne bedingen
nicht allein an sich eine viel größere Lichtfülle, sondern sie dringen,
wegen der spärlicheren Blattentwicklung in den Baumkronen,
leichter nach unten in die Tiefe und liefern Licht genug, um auch
unten am Boden die üppigste Vegetation zu ermöglichen. Wir finden
daher auch in den meisten tropischen Urwäldern nicht jenes
„tiefe Dunkel“ , welches in poetischen Schilderungen derselben eine
Rolle spielt, sondern vielmehr ein eigentümliches gebrochenes
„Helldunkel“ , zusammengesetzt aus Tausenden von kleinen Lichtstrahlen,
die zwischen den Bäumen, Ästen und Blättern hindurch
ihren Weg bis zum Boden finden. Von der glatten Oberfläche der
glänzenden Blätter werden dieselben stark reflektiert.
In auffallendem Gegensätze zu der schwächeren Laubentwicklung
steht die viel stärkere H o lzb ild u n g des Urwaldes. Zahlreiche
Pflanzengattungen, die in unserer gemäßigten Zone nur durch
krautartige Pflanzen vertreten sind, erscheinen hier als Sträucher
oder Bäume mit holzigem Stamme. Am auffallendsten ist dies bei
den Lianen, die auf die besondere Physiognomie des Urwaldes
einen so bestimmenden Einfluß üben. Wir fassen hier unter dem
Begriffe „Lianen“ alle kletternden und klimmenden, rankenden
und schlingenden, würgenden und windenden Pflanzen zusammen.
In unserem Mitteleuropa ist deren Zahl und Massenentwicklung
überhaupt sehr beschränkt, und nur wenige Gattungen haben verholzte
Stengel, wie der Efeu, die Waldrebe, das Geißblatt. In den
Tropen dagegen treffen wir mehr als zweitausend verschiedene
Lianenarten an, und die große Mehrzahl derselben hat verholzte
Stämme.
Die „Lianenb äume“ spielen in der landschaftlichen Physiognomie
des tropischen Urwaldes namentlich deshalb eine so hervorragende
Rolle, weil ihre holzigen Stämme meistens nackt und un