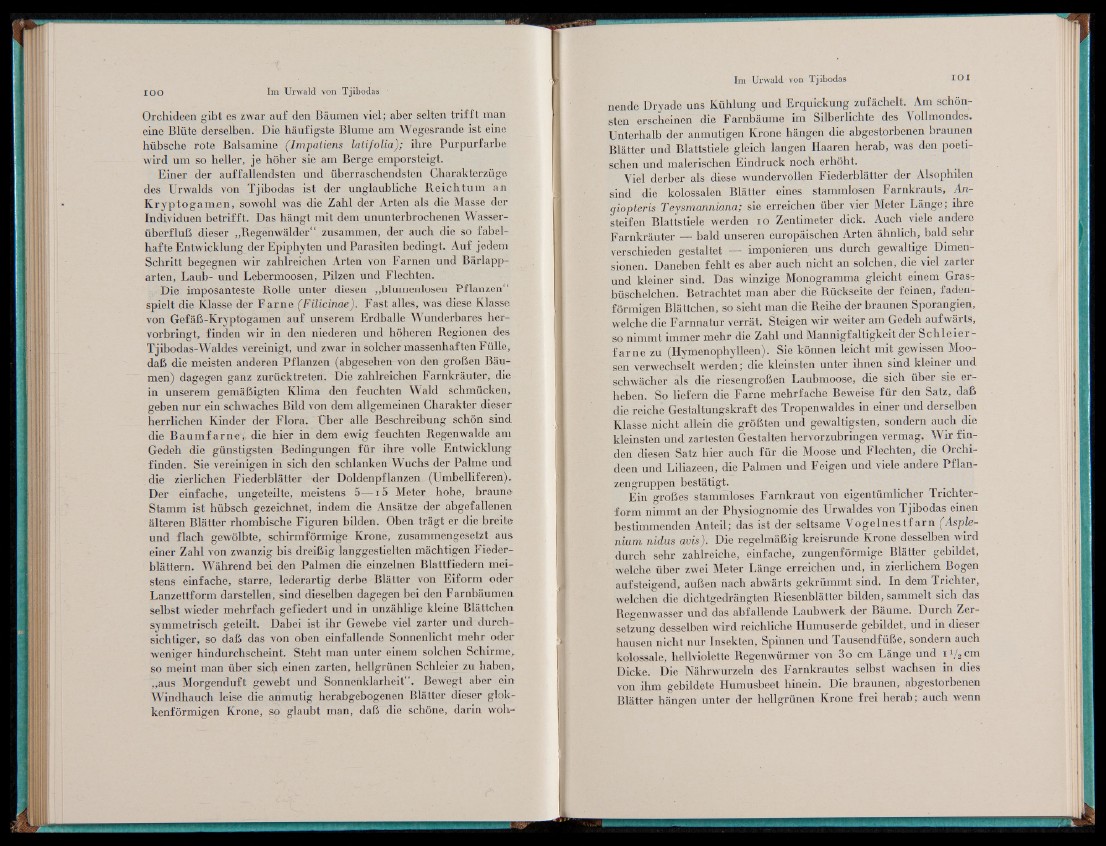
IOO Im Urwald von Tjibodas
Orchideen gibt es zwar auf den Bäumen viel; aber selten trifft man
eine Blüte derselben. Die häufigste Blume am Wegesrande ist eine
hübsche rote Balsamine (Impatiens latifolia); ihre Purpurfarbe
wird um so heller, je höher sie am Berge emporsteigt.
Einer der auffallendsten und überraschendsten Charakterzüge
des Urwalds von Tjibodas ist der unglaubliche Reichtum an
K ryp to g am en, sowohl was die Zahl der Arten als die Masse der
Individuen betrifft. Das hängt mit dem ununterbrochenen Wasserüberfluß
dieser „Regenwälder“ zusammen, der auch die so fabelhafte
Entwicklung der Epiphyten und Parasiten bedingt. Auf jedem
Schritt begegnen wir zahlreichen Arten von Farnen und Bärlapparten,
Laub- und Lebermoosen, Pilzen und Flechten.
Die imposanteste Rolle unter diesen „blumenlosen Pflanzen“
spielt die Klasse der Farne (Filicinae). Fast alles, was diese Klasse
von Gefäß-Kryptogamen auf unserem Erdbälle Wunderbares hervorbringt,
finden wir in den niederen und höheren Regionen des
Tjibodas-Waldes vereinigt, und zwar in solcher massenhaften Fülle,
daß die meisten anderen Pflanzen (abgesehen von den großen Bäumen)
dagegen ganz zurücktreten. Die zahlreichen Farnkräuter, die
in unserem gemäßigten Klima den feuchten Wald schmücken,
geben nur ein schwaches Bild von dem allgemeinen Charakter dieser
herrlichen Kinder der Flora. Über alle Beschreibung schön sind
die Baumfarne> die hier in dem ewig feuchten Regenwalde am
Gedeh die günstigsten Bedingungen für ihre volle Entwicklung
finden. Sie vereinigen in sich den schlanken Wuchs der Palme und
die zierlichen Fiederblätter der Doldenpflanzen (Umbelliferen).
Der einfache, ungeteilte, meistens 5—15 Meter hohe, braune
Stamm ist hübsch gezeichnet, indem die Ansätze der abgefallenen
älteren Blätter rhombische Figuren bilden. Oben trägt er die breite
und flach gewölbte, schirmförmige Krone, zusammengesetzt aus
einer Zahl von zwanzig bis dreißig langgestielten mächtigen Fiederblättern.
Während bei den Palmen die einzelnen Blattfiedern meistens
einfache, starre, lederartig derbe Blätter von Eiform oder
Lanzettform darstellen, sind dieselben dagegen bei den Farnbäumen
selbst wieder mehrfach gefiedert und in unzählige kleine Blättchen
symmetrisch geteilt. Dabei ist ihr Gewebe viel zarter und durchsichtiger,
so daß das von oben einfallende Sonnenlicht mehr oder
weniger hindurchscheint. Steht man unter einem solchen Schirme,
so meint man über sich einen zarten, hellgrünen Schleier zu haben,
„aus Morgenduft gewebt und Sonnenklarheit“ . Bewegt aber ein
Windhauch leise die anmutig herabgebogenen Blätter dieser glok-
kenförmigen Krone, so glaubt man, daß die schöne, darin wohnende
Dryade uns Kühlung und Erquickung zufächelt. Am schönsten
erscheinen die Farnbäume im Silberlichte des Vollmondes,
Unterhalb der anmutigen Krone hängen die abgestorbenen braunen
Blätter und Blattstiele gleich langen Haaren herab, was den poetischen
und malerischen Eindruck noch erhöht.
Viel derber als diese wundervollen Fiederblätter der Alsophilen
sind die kolossalen Blätter eines stammlosen Farnkrauts, An-
giopteris Teysmanniana; sie erreichen über vier Meter Länge; ihre
steifen Blattstiele werden io Zentimeter dick. Auch viele andere
Farnkräuter — bald unseren europäischen Arten ähnlich, bald sehr
verschieden gestaltet — imponieren uns durch gewaltige Dimensionen.
Daneben fehlt es aber auch nicht an solchen, die viel zarter
und kleiner sind. Das winzige Monogramma gleicht einem Gras-
büschelchen. Betrachtet man aber die Rückseite der feinen, fadenförmigen
Blättchen, so sieht man die Reihe der braunen Sporangien,
welche die Farnnatur verrät. Steigen wir weiter am Gedeh aufwärts,
so nimmt immer mehr die Zahl und Mannigfaltigkeit der S ch le ie r fa
rn e zu (Hymenophylleen). Sie können leicht mit gewissen Moosen
verwechselt werden; die kleinsten unter ihnen sind kleiner und
schwächer als die riesengroßen Laubmoose, die sich über sie erheben.
Sn liefern die Farne mehrfache Beweise für den Satz, daß
die reiche Gestaltungskraft des Tropenwaldes in einer ünd derselben
Klasse nicht allein die größten und gewaltigsten, sondern auch die
kleinsten und zartesten Gestalten hervorzubringen vermag. Wir finden
diesen Satz hier auch für die Moose und Flechten, die Orchideen
und Liliazeen, die Palmen und Feigen und viele andere Pflanzengruppen
bestätigt.
Ein großes stammloses Farnkraut von eigentümlicher Trichterform
nimmt an der Physiognomie des Urwaldes von Tjibodas einen
bestimmenden Anteil; das ist der seltsame V o g e ln e s tfa rn (Asple-
nium nidus avis). Die regelmäßig kreisrunde Krone desselben wird
durch sehr zahlreiche, einfache, zungenförmige Blätter gebildet,
welche über zwei Meter Länge erreichen und, in zierlichem Bogen
aufsteigend, außen nach abwärts gekrümmt sind. In dem Trichter,
welchen die dichtgedrängten Riesenblätter bilden, sammelt sich das
Regenwasser und das abfallende Laubwerk der Bäume. Durch Zersetzung
desselben wird reichliche Humuserde gebildet, und in dieser
hausen nicht nur Insekten, Spinnen und Tausendfüße, sondern auch
kolossale, hellviolette Regenwürmer von 3o cm Länge und i V2 cm
Dicke. Die Nährwurzeln des Farnkrautes selbst wachsen in dies
von ihm gebildete Humusbeet hinein. Die braunen, abgestorbenen
Blätter hängen unter der hellgrünen Krone frei herab; auch wenn