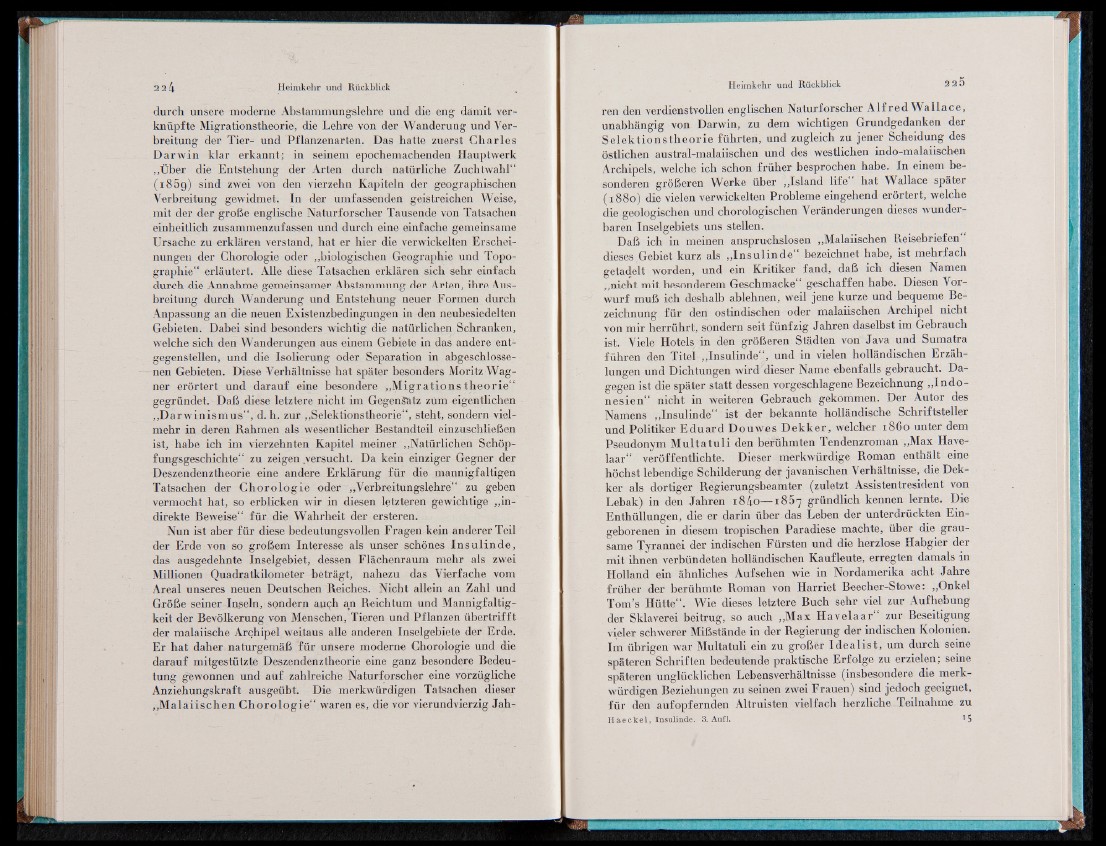
durch unsere moderne Abstammungslehre und die eng damit verknüpfte
Migrationstheorie, die Lehre von der Wanderung und Verbreitung
der Tier- und Pflanzenarten. Das hatte zuerst Charles
Darwin klar erkannt; in seinem epochemachenden Hauptwerk
„Über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“
(1859) sind zwei von den vierzehn Kapiteln der geographischen
Verbreitung gewidmet. In der umfassenden geistreichen Weise,
mit der der große englische Naturforscher Tausende von Tatsachen
einheitlich zusammenzufassen und durch eine einfache gemeinsame
Ursache zu erklären verstand, hat er hier die verwickelten Erscheinungen
der Chorologie oder „biologischen Geographie und Topographie“
erläutert. Alle diese Tatsachen erklären sich sehr einfach
durch die Annahme gemeinsamer Abstammung der Arten, ihre Ausbreitung
durch Wanderung und Entstehung neuer Formen durch
Anpassung an die neuen Existenzbedingungen in den neubesiedelten
Gebieten. Dabei sind besonders wichtig die natürlichen Schranken,
welche sich den Wanderungen aus einem Gebiete in das andere entgegenstellen,
und die Isolierung oder Separation in abgeschlossenen
Gebieten. Diese Verhältnisse hat später besonders Moritz Wagner
erörtert und darauf eine besondere „M ig r a t io n s th e o r ie “
gegründet. Daß diese letztere nicht im Gegensatz zum eigentlichen
„D a rw in ism u s “ , d. h. zur „Selektionstheorie“ , steht, sondern vielmehr
in deren Rahmen als wesentlicher Bestandteil einzuschließen
ist, habe ich im vierzehnten Kapitel meiner „Natürlichen Schöpfungsgeschichte“
zu zeigen versucht. Da kein einziger Gegner der
Deszendenztheorie eine andere Erklärung für die mannigfaltigen
Tatsachen der C h o ro lo g ie oder „Verbreitungslehre“ zu geben
vermocht hat, so erblicken wir in diesen letzteren gewichtige „indirekte
Beweise“ für die Wahrheit der ersteren.
Nun ist aber für diese bedeutungsvollen Fragen kein anderer Teil
der Erde von so großem Interesse als unser schönes In su lind e ,
das ausgedehnte Inselgebiet, dessen Flächenraum mehr als zwei
Millionen Quadratkilometer beträgt, nahezu das Vierfache vom
Areal unseres neuen Deutschen Reiches. Nicht allein an Zahl und
Größe seiner In.seln, sondern au$h an Reichtum und Mannigfaltigkeit
der Bevölkerung von Menschen, Tieren und Pflanzen übertrifft
der malaiische Archipel weitaus alle anderen Inselgebiete der Erde.
Er hat daher naturgemäß für unsere moderne Chorologie und die
darauf mitgestützte Deszendenztheorie eine ganz besondere Bedeutung
gewonnen und auf zahlreiche Naturforscher eine vorzügliche
Anziehungskraft ausgeübt. Die merkwürdigen Tatsachen dieser
„M a la iisch en C h o ro lo g ie “ waren es, die vor vierundvierzig JahHeimkehr
und Rückblick
ren den verdienstvollen englischen Naturforscher A lf r e dW a lla c e ,
unabhängig von Darwin, zu dem wichtigen Grundgedanken der
S e lek tion s th e o r ie führten, und zugleich zu jener Scheidung des
östlichen austral-malaiischen und des westlichen indo-malaiischen
Archipels, welche ich schon früher besprochen habe. In einem besonderen
größeren Werke über ,,Island life hat Wallace später
(1880) die vielen verwickelten Probleme eingehend erörtert, welche
die geologischen und chorologischen Veränderungen dieses wunderbaren
Inselgebiets uns stellen.
Daß ich in meinen anspruchslosen „Malaiischen Reisebriefen
dieses Gebiet kurz als „ In su lin d e “ bezeichnet habe, ist mehrfach
getadelt worden, und ein Kritiker fand, daß ich diesen Namen
„nicht mit besonderem Geschmacke“ geschaffen habe. Diesen Vorwurf
muß ich deshalb ab lehnen, weil jene kurze und bequeme Bezeichnung
für den ostindischen oder malaiischen Archipel nicht
von mir herrührt, sondern seit fünfzig Jahren daselbst im Gebrauch
ist. Viele Hotels in den größeren Städten von Java und Sumatra
führen den Titel ,,Insulinde , und in vielen holländischen Erzählungen
und Dichtungen wird dieser Name ebenfalls gebraucht. Dagegen
ist die später statt dessen vorgeschlagene Bezeichnung „ In d o nesien“
nicht in weiteren Gebrauch gekommen. Der Autor des
Namens ,,Insulinde“ ist der bekannte holländische Schriftsteller
und Politiker Eduard Douwes D ek k er, welcher 1860 unter dem
Pseudonym M u lta tu li den berühmten Tendenzroman „Max Havelaar“
veröffentlichte. Dieser merkwürdige Roman enthält eine
höchst lebendige Schilderung der javanischen Verhältnisse, die Dekker
als dortiger Regierungsbeamter (zuletzt Assistentresident von
Lebak) in den Jahren i 84o— 1857 gründlich kennen lernte. Die
Enthüllungen, die er darin über das Leben der unterdrückten Eingeborenen
in diesem tropischen Paradiese machte, über die grausame
Tyrannei der indischen Fürsten und die herzlose Habgier der
mit ihnen verbündeten holländischen Kaufleute, erregten damals in
Holland ein ähnliches Aufsehen wie in Nordamerika acht Jahre
früher der berühmte Roman von Harriet Beecher-Stowe: „Onkel
Tom’s Hütte“ . Wie dieses letztere Buch sehr viel zur Aufhebung
der Sklaverei beitrug, so auch „Max H a ve laa r“ zur Beseitigung
vieler schwerer Mißstände in der Regierung der indischen Kolonien.
Im übrigen war Multatuli ein zu großer Id e a lis t, um durch seine
späteren Schriften bedeutende praktische Erfolge zu erzielen; seine
späteren unglücklichen Lebensverhältnisse (insbesondere die merkwürdigen
Beziehungen zu seinen zwei Frauen) sind jedoch geeignet,
für den aufopfernden Altruisten vielfach herzliche Teilnahme zu
H a e c k e 1, Insulinde. 3. Auf 1.