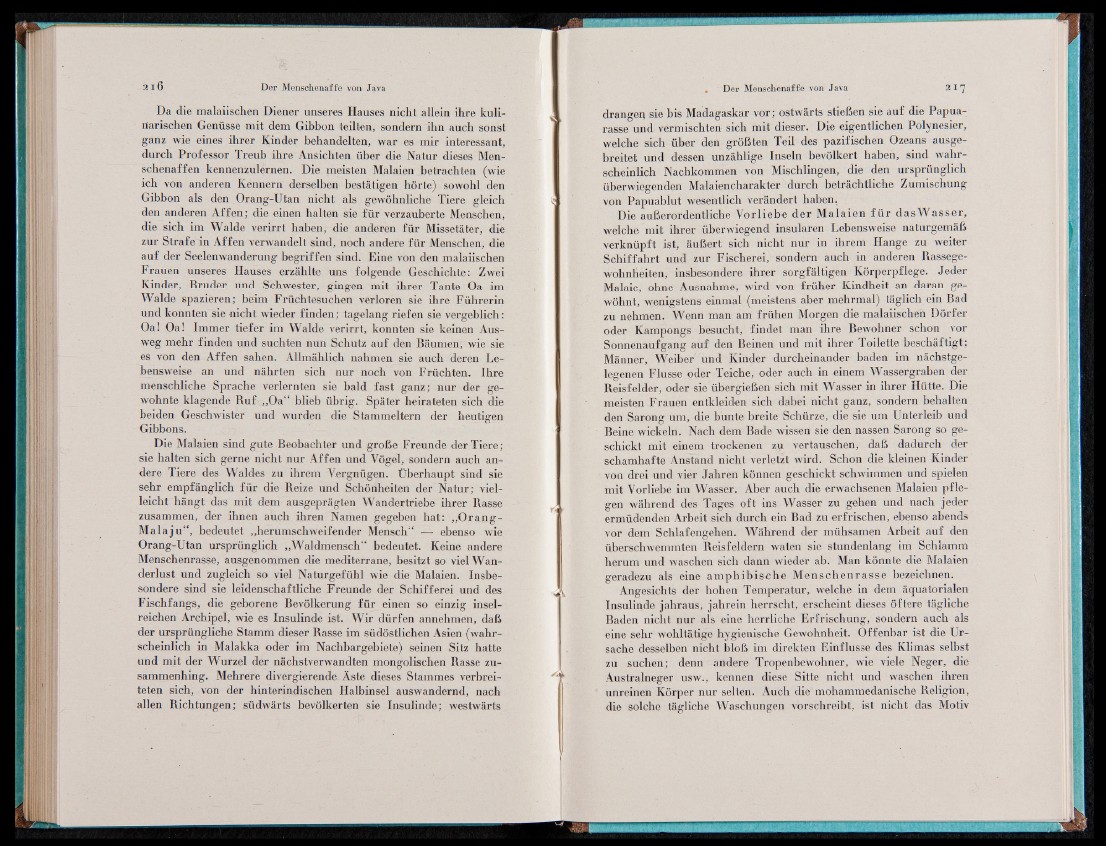
Der Menschenaffe von Java
Da die malaiischen Diener unseres Hauses nicht allein ihre kulinarischen
Genüsse mit dem Gibbon teilten, sondern ihn auch sonst
ganz wie eines ihrer Kinder behandelten, war es mir interessant,
durch Professor Treub ihre Ansichten über die Natur dieses Menschenaffen
kennenzulernen. Die meisten Malaien betrachten (wie
ich von anderen Kennern derselben bestätigen hörte) sowohl den
Gibbon als den Orang-Utan nicht als gewöhnliche Tiere gleich
den anderen Affen; die einen halten sie für verzauberte Menschen,
die sich im Walde verirrt haben, die anderen für Missetäter, die
zur Strafe in Affen verwandelt sind, noch andere für Menschen, die
auf der Seelenwanderung begriffen sind. Eine von den malaiischen
Frauen unseres Hauses erzählte uns folgende Geschichte: Zwei
Kinder, Bruder und Schwester, gingen mit ihrer Tante Oa im
Walde spazieren; beim Früchtesuchen verloren sie ihre Führerin
und konnten sie nicht wieder finden; tagelang riefen sie vergeblich:
Oa! Oa! Immer tiefer im Walde verirrt, konnten sie keinen Ausweg
mehr finden und suchten nun Schutz auf den Bäumen; wie sie
es von den Affen sahen. Allmählich nahmen sie auch deren Lebensweise
an und nährten sich nur noch von Früchten. Ihre
menschliche Sprache verlernten sie bald fast ganz; nur der gewohnte
klagende Buf „Oa“ blieb übrig. Später heirateten sich die
beiden Geschwister und wurden die Stammeltern der heutigen
Gibbons.
Die Malaien sind gute Beobachter und große Freunde der Tiere;
sie halten sich gerne nicht nur Affen und Vögel, sondern auch andere
Tiere des Waldes zu ihrem Vergnügen. Überhaupt sind sie
sehr empfänglich für die Reize und Schönheiten der Natur; vielleicht
hängt das mit dem ausgeprägten Wandertriebe ihrer Rasse
zusammen, der ihnen auch ihren Namen gegeben hat: „Orang -
M a la ju “ , bedeutet „herumschweifender Mensch“ — ebenso wie
Orang-Utan ursprünglich „Waldmensch“ bedeutet. Keine andere
Menschenrasse, ausgenommen die mediterrane, besitzt so viel Wanderlust
und zugleich so viel Naturgefühl wie die Malaien. Insbesondere
sind sie leidenschaftliche Freunde der Schifferei und des
Fischfangs, die geborene Bevölkerung für einen so einzig insel-
reichen Archipel, wie es Insulinde ist. Wir dürfen annehmen, daß
der ursprüngliche Stamm dieser Rasse im südöstlichen Asien (wahrscheinlich
in Malakka oder im Nachbargebiete) seinen Sitz hatte
und mit der Wurzel der nächstverwandten mongolischen Rasse zusammenhing.
Mehrere divergierende Äste dieses Stammes verbreiteten
sich, von der hinterindischen Halbinsel auswandernd, nach
allen Richtungen; südwärts bevölkerten sie Insulinde; westwärts
Der Menschenaffe von Java
drangen sie bis Madagaskar vor; ostwärts stießen sie auf die Papuarasse
und vermischten sich mit dieser. Die eigentlichen Polynesier,
welche sich über den größten Teil des pazifischen Ozeans ausgebreitet
und dessen unzählige Inseln bevölkert haben, sind wahrscheinlich
Nachkommen von Mischlingen, die den ursprünglich
überwiegenden Malaiencharakter durch beträchtliche Zumischung
von Papuablut wesentlich verändert haben.
Die außerordentliche Vorliebe der Malaien fü r das Wasser,
welche mit ihrer überwiegend insularen Lebensweise naturgemäß
verknüpft ist, äußert sich nicht nur in ihrem Hange zu weiter
Schiffahrt und zur Fischerei, sondern auch in anderen Rassegewohnheiten,
insbesondere ihrer sorgfältigen Körperpflege. Jeder
Malaie, ohne Ausnahme, wird von früher Kindheit an daran gewöhnt,
wenigstens einmal (meistens aber mehrmal) täglich ein Bad
zu nehmen. Wenn man am frühen Morgen die malaiischen Dörfer
oder Kampongs besucht, findet man ihre Bewohner schon vor
Sonnenaufgang auf den Beinen und mit ihrer Toilette beschäftigt;
Männer, Weiber' und Kinder durcheinander baden im nächstgelegenen
Flusse oder Teiche, oder auch in einem Wassergraben der
Reisfelder, oder sie übergießen sich mit Wasser in ihrer Hütte. Die
meisten Frauen entkleiden sich dabei nicht ganz, sondern behalten
den Sarong um, die bunte breite Schürze, die sie um Unterleib und
Beine wickeln. Nach dem Bade wissen sie den nassen Sarong so geschickt
mit einem trockenen zu vertauschen, daß dadurch der
schamhafte Anstand nicht verletzt wird. Schon die kleinen Kinder
von drei und vier Jahren können geschickt schwimmen und spielen
mit Vorliebe im Wasser. Aber auch die erwachsenen Malaien pflegen
während des Tages oft ins Wasser zu gehen und nach jeder
ermüdenden Arbeit sich durch ein Bad zu erfrischen, ebenso abends
vor dem Schlafengehen. Während der mühsamen Arbeit auf den
überschwemmten Reisfeldern waten sie stundenlang im Schlamm
herum und waschen sich dann wieder ab. Man könnte die Malaien
geradezu als eine amphibische Menschenrasse bezeichnen.
Angesichts der hohen Temperatur, welche in dem äquatorialen
Insulinde jahraus, jahrein herrscht, erscheint dieses öftere tägliche
Baden nicht nur als eine herrliche Erfrischung, sondern auch als
eine sehr wohltätige hygienische Gewohnheit. Offenbar ist die Ursache
desselben nicht bloß im direkten Einflüsse des Klimas selbst
zu suchen; denn andere Tropenbewohner, wie viele Neger, die
Australneger usw., kennen diese Sitte nicht und waschen ihren
unreinen Körper nur selten. Auch die mohammedanische Religion,
die solche tägliche Waschungen vorschreibt, ist nicht das Motiv