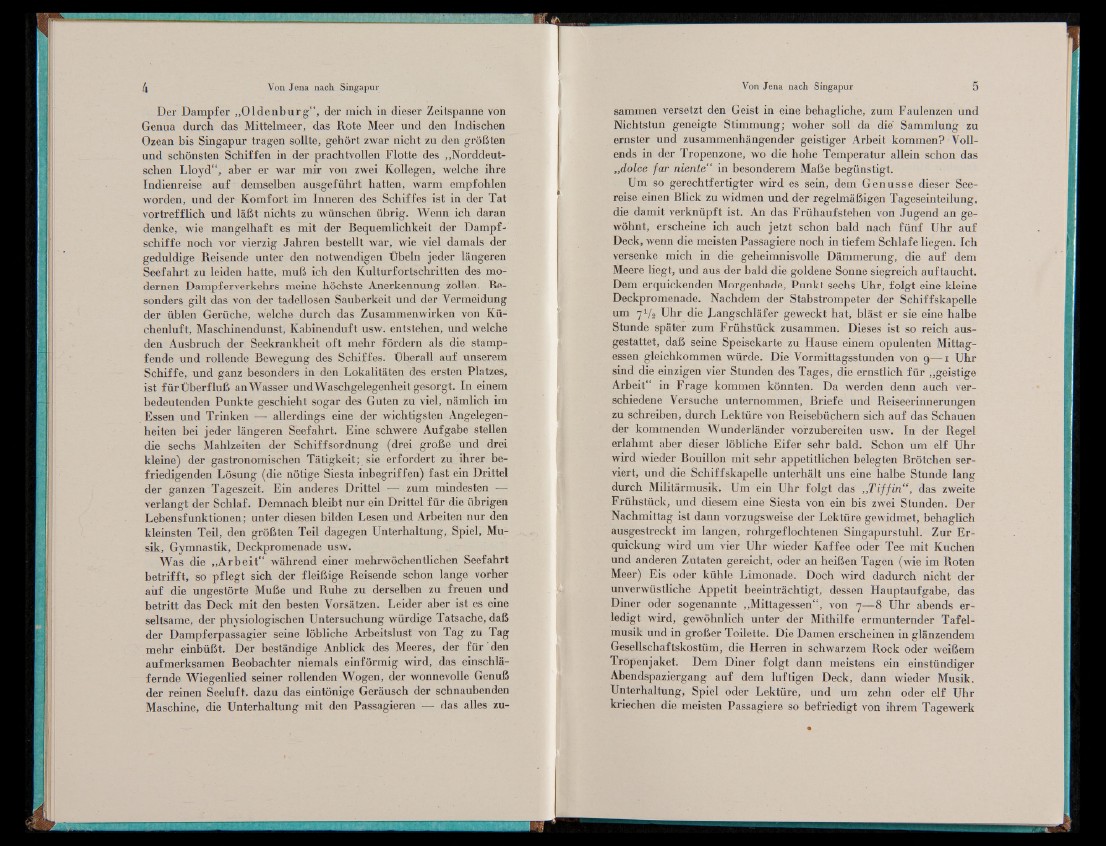
Der Dampfer „O ld en b u rg “ , der mich in dieser Zeitspanne von
Genua durch das Mittelmeer, das Rote Meer und den Indischen
Ozean bis Singapur tragen sollte, gehört zwar nicht zu den größten
und schönsten Schiffen in der prachtvollen Flotte des „Norddeutschen
Lloyd“ , aber er war mir von zwei Kollegen, welche ihre
Indienreise auf demselben ausgeführt hatten, warm empfohlen
worden, und der Komfort im Inneren des Schiffes ist in der Tat
vortrefflich und läßt nichts zu wünschen übrig. Wenn ich daran
denke, wie mangelhaft es mit der Bequemlichkeit der Dampfschiffe
noch vor vierzig Jahren bestellt war, wie viel damals der
geduldige Reisende unter den notwendigen Übeln jeder längeren
Seefahrt zu leiden hatte, muß ich den Kulturfortschritten des modernen
Dampferverkehrs meine höchste Anerkennung zollen. Besonders
gilt das von der tadellosen Sauberkeit und der Vermeidung
der üblen Gerüche, welche durch das Zusammenwirken von Küchenluft,
Maschinendunst, Kabinenduft usw. entstehen, und welche
den Ausbruch der Seekrankheit oft mehr fördern als die stampfende
und rollende Bewegung des Schiffes. Überall auf unserem
Schiffe, und ganz besonders in den Lokalitäten des ersten Platzes,
ist für Überfluß an Wasser undWaschgelegenheit gesorgt. In einem
bedeutenden Punkte geschieht sogar des Guten zu viel, nämlich im
Essen und Trinken —* allerdings eine der wichtigsten Angelegenheiten
bei jeder längeren Seefahrt. Eine schwere Aufgabe stellen
die sechs Mahlzeiten der Schiffsordnung (drei große und drei
kleine) der gastronomischen Tätigkeit; sie erfordert zu ihrer befriedigenden
Lösung (die nötige Siesta inbegriffen) fast ein Drittel
der ganzen Tageszeit. Ein anderes Drittel §l||zum mindesten —
verlangt der Schlaf. Demnach bleibt nur ein Drittel für die übrigen
Lebensfunktionen; unter diesen bilden Lesen und Arbeiten nur den
kleinsten Teil, den größten Teil dagegen Unterhaltung, Spiel, Musik,
Gymnastik, Deckpromenade usw.
Was die „A rb e it “ während einer mehrwöchentlichen Seefahrt
betrifft, so pflegt sich der fleißige Reisende schon lange vorher
auf die ungestörte Muße und Ruhe zu derselben zu freuen und
betritt das Deck mit den besten Vorsätzen. Leider aber ist es eine
seltsame, der physiologischen Untersuchung würdige Tatsache, daß
der Dampferpassagier seine löbliche Arbeitslust von Tag zu Tag
mehr einbüßt. Der beständige Anblick des Meeres, der für den
aufmerksamen Beobachter niemals einförmig wird, das einschläfernde
Wiegenlied seiner rollenden Wogen, der wonnevolle Genuß
der reinen Seeluft, dazu das eintönige Geräusch der schnaubenden
Maschine, die Unterhaltung mit den Passagieren — das alles zusammen
versetzt den Geist in eine behagliche, zum Faulenzen und
Nichtstun geneigte Stimmung; woher soll da die Sammlung zu
ernster und zusammenhängender geistiger Arbeit kommen? Vollends
in der Tropenzone, wo die hohe Temperatur allein schon das
„ dolce far niente“ in besonderem Maße begünstigt.
Um so gerechtfertigter wird es sein, dem Genüsse dieser Seereise
einen Blick zu widmen und der regelmäßigen Tageseinteilung,
die damit verknüpft ist. An das Frühaufstehen von Jugend an gewöhnt,
erscheine ich auch jetzt schon bald nach fünf Uhr auf
Deck, wenn die meisten Passagiere noch in tiefem Schlafe liegen. Ich
versenke mich in die geheimnisvolle Dämmerung, die auf dem
Meere liegt, und aus der bald die goldene Sonne siegreich auftaucht.
Dem erquickenden Morgenbade, Punkt sechs Uhr, folgt eine kleine
Deckpromenade. Nachdem der Stabstrompeter der Schiffskapelle
um 7V2 Uhr die Langschläfer geweckt hat, bläst er sie eine halbe
Stunde später zum Frühstück zusammen. Dieses ist so reich ausgestattet,
daß seine Speisekarte zu Hause einem opulenten Mittagessen
gleichkommen würde. Die Vormittagsstunden von 9-S1 Uhr
sind die einzigen vier Stunden des Tages, die ernstlich für „geistige
Arbeit“ in Frage kommen könnten. Da werden denn auch verschiedene
Versuche unternommen, Briefe und Reiseerinnerungen
zu schreiben, durch Lektüre von Reisebüchern sich auf das Schauen
der kommenden Wunderländer vorzubereiten usw. In der Regel
erlahmt aber dieser löbliche Eifer sehr bald. Schon um elf Uhr
wird wieder Bouillon mit sehr appetitlichen belegten Brötchen serviert,
und die Schiffskapelle unterhält uns eine halbe Stunde lang
durch Militärmusik. Um ein Uhr folgt das „Tiffin“ , das zweite
Frühstück, und diesem eine Siesta von ein bis zwei Stunden. Der
Nachmittag ist dann vorzugsweise der Lektüre gewidmet, behaglich
ausgestreckt im langen, rohrgeflochtenen Singapurstuhl. Zur Erquickung
wird um vier Uhr wieder Kaffee oder Tee mit Kuchen
und anderen Zutaten gereicht, oder an heißen Tagen (wie im Roten
Meer) Eis oder kühle Limonade. Doch wird dadurch nicht der
unverwüstliche Appetit beeinträchtigt, dessen Hauptaufgabe, das
Diner oder sogenannte „Mittagessen“ , von 7— 8 Uhr abends erledigt
wird, gewöhnlich unter der Mithilfe ermunternder Tafelmusik
und in großer Toilette. Die Damen erscheinen in glänzendem
Gesellschaftskostüm, die Herren in schwarzem Rock oder weißem
Tropenjaket. Dem Diner folgt dann meistens ein einstündiger
Abendspaziergang auf dem luftigen Deck, dann wieder Musik.
Unterhaltung, Spiel oder Lektüre, und um zehn oder elf Uhr
kriechen die meisten Passagiere so befriedigt von ihrem Tagewerk