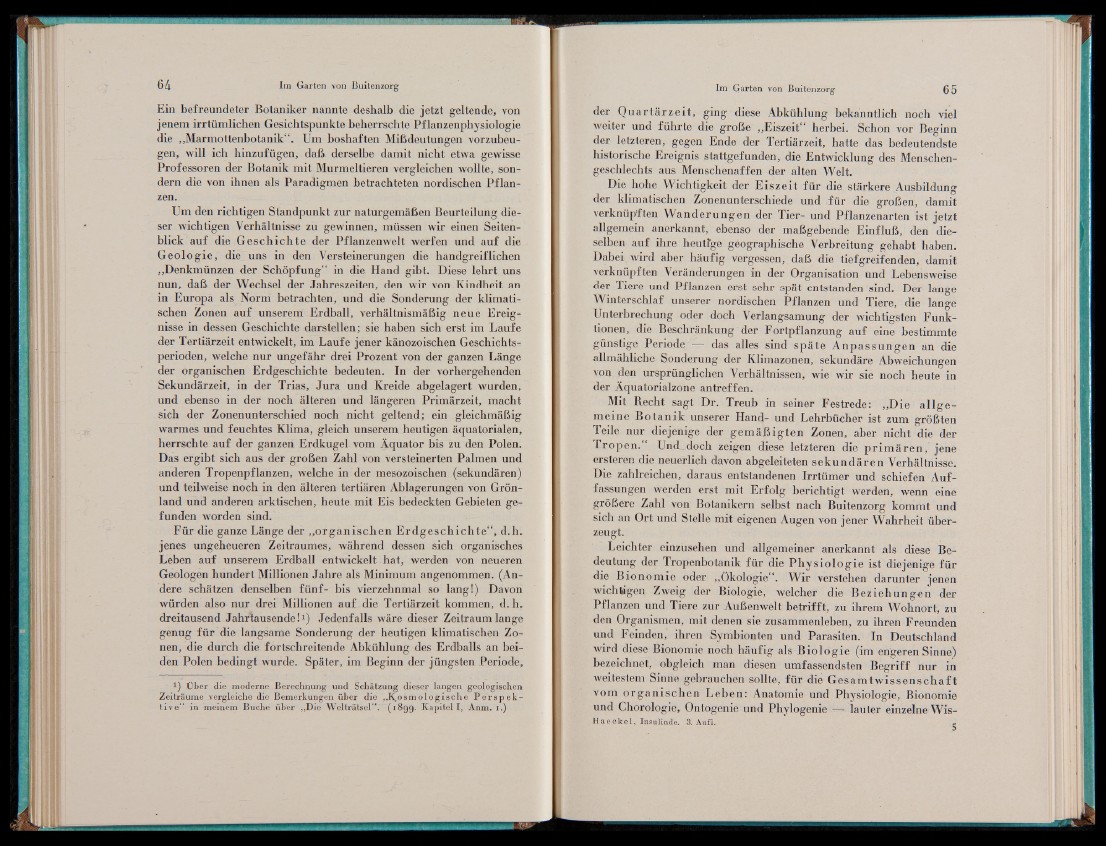
Ein befreundeter Botaniker nannte deshalb die jetzt geltende, von
jenem irrtümlichen Gesichtspunkte beherrschte Pflanzenphysiologie
die „Marmottenbotanik“ . Um boshaften Mißdeutungen vorzubeugen,
will ich hinzufügen, daß derselbe damit nicht etwa gewisse
Professoren der Botanik mit Murmeltieren vergleichen wollte, sondern
die von ihnen als Paradigmen betrachteten nordischen Pflanzen.
Um den richtigen Standpunkt zur naturgemäßen Beurteilung dieser
wichtigen Verhältnisse zu gewinnen, müssen wir einen Seitenblick
auf die Ges ch ich te der Pflanzenwelt werfen und auf die
G eo lo g ie , die uns in den Versteinerungen die handgreiflichen
„Denkmünzen der Schöpfung“ in die Hand gibt. Diese lehrt uns
nun, daß der Wechsel der Jahreszeiten, den wir von Kindheit an
in Europa als Norm betrachten, und die Sonderung der klimatischen
Zonen auf unserem Erdball, verhältnismäßig neue Ereignisse
in dessen Geschichte darstellen; sie haben sich erst im Laufe
der Tertiärzeit entwickelt, im Laufe jener känozoischen Geschichtsperioden,
welche nur ungefähr drei Prozent von der ganzen Länge
der organischen Erdgeschichte bedeuten. In der vorhergehenden
Sekundärzeit, in der Trias, Jura und Kreide abgelagert wurden,
und ebenso in der noch älteren und längeren Primärzeit, macht
sich der Zonenunterschied noch nicht geltend; ein gleichmäßig
warmes und feuchtes Klima, gleich unserem heutigen äquatorialen,
herrschte auf der ganzen Erdkugel vom Äquator bis zu den Polen.
Das ergibt sich aus der großen Zahl von versteinerten Palmen und
anderen Tropenpflanzen, welche in der mesozoischen (sekundären)
und teilweise noch in den älteren tertiären Ablagerungen von Grönland
und anderen arktischen, heute mit Eis bedeckten Gebieten gefunden
worden sind.
Für die ganze Länge der „o rg an isch en E rd g e s ch ich te “ , d.h.
jenes ungeheueren Zeitraumes, während dessen sich organisches
Leben auf unserem Erdball entwickelt hat, werden von neueren
Geologen hundert Millionen Jahre als Minimum angenommen. (Andere
schätzen denselben fünf- bis vierzehnmal so lang!) Davon
würden also nur drei Millionen auf die Tertiärzeit kommen, d.h.
dreitausend Jahrlausende!1) Jedenfalls wäre dieser Zeitraum lange
genug für die langsame Sonderung der heutigen klimatischen Zonen,
die durch die fortschreitende Abkühlung des Erdballs an beiden
Polen bedingt wurde. Später, im Beginn der jüngsten Periode,
!) Übei- die moderne Berechnung und Zeiträume vergleiche die Bemerkungen überS cdhiäet zu„nKg. odsimeseorl olagnisgcenh eg ePoelorgsispcehken
tive“ in meinem Buche über „Die Welträtsel“. (1899. Kapitell, Anm. 1.)
der Q u a r tä r ze it, ging diese Abkühlung bekanntlich noch viel
weiter und führte die große „Eiszeit“ herbei. Schon vor Beginn
der letzteren, gegen Ende der Tertiärzeit, hatte das bedeutendste
historische Ereignis stattgefunden, die Entwicklung des Menschengeschlechts
aus Menschenaffen der alten Welt.
Die hohe Wichtigkeit der E is ze it für die stärkere Ausbildung
der klimatischen Zonenunterschiede und Tür die großen, damit
verknüpften Wanderungen der Tier- und Pflanzenarten ist jetzt
allgemein anerkannt, ebenso der maßgebende Einfluß, den dieselben
auf ihre heutige geographische Verbreitung gehabt haben.
Dabei wird aber häufig vergessen, daß die tiefgreifenden, damit
verknüpften Veränderungen in der Organisation Und Lebensweise
der Tiere und Pflanzen erst sehr spät entstanden sind. Der lange
Winterschlaf unserer nordischen Pflanzen und Tiere, die lange
Unterbrechung oder doch Verlangsamung der wichtigsten Funktionen,
die Beschränkung der Fortpflanzung auf eine bestimmte
günstige Periode/-^ das alles sind späte Anpassungen an die
allmähliche Sonderung der Klimazonen, sekundäre Abweichungen
von den ursprünglichen Verhältnissen, wie wir sie noch heute in
der Äquatorialzone antreffen.
Mit Recht sagt Dr. Treub in seiner Festrede: „Die a llg e meine
B o tan ik unserer Hand- und Lehrbücher ist zum größten
Teile nur diejenige der g em äß igten Zonen, aber nicht die der
Tropen.“ Und doch zeigen diese letzteren die pr imären , jene
ersteren die neuerlich davon abgeleiteten sekundären Verhältnisse.
Die zahlreichen, daraus entstandenen Irrtümer und schiefen Auffassungen
werden erst mit Erfolg berichtigt werden, wenn eine
größere Zahl von Botanikern selbst nach Buitenzorg kommt und
sich an Ort. und Stelle mit eigenen Augen von jener Wahrheit überzeugt.
Leichter einzusehen und allgemeiner anerkannt als diese Bedeutung
der Tropenbotanik für die P h y s io lo g ie ist diejenige für
die Bionömie oder „Ökologie“ . Wir verstehen darunter jenen
wichtigen Zweig der Biologie, welcher die Beziehungen der
Pflanzen und Tiere zur Außenwelt betrifft, zu ihrem Wohnort, zu
den Organismen, mit denen sie Zusammenleben, zu ihren Freunden
und Feinden, ihren Symbionten und Parasiten. In Deutschland
wird diese Bionomie noch häufig als B io lo g ie (im engeren Sinne)
bezeichnet, obgleich man diesen umfassendsten Begriff nur in
weitestem Sinne gebrauchen sollte, für die G e sam tw is sen sch a ft
vom organischen Leben: Anatomie und Physiologie, Bionomie
und Chorologie, Ontogenie und Phylogenie -— lauter einzelne Wis-
H aeokel, Insulinde. 3. Aufl. -