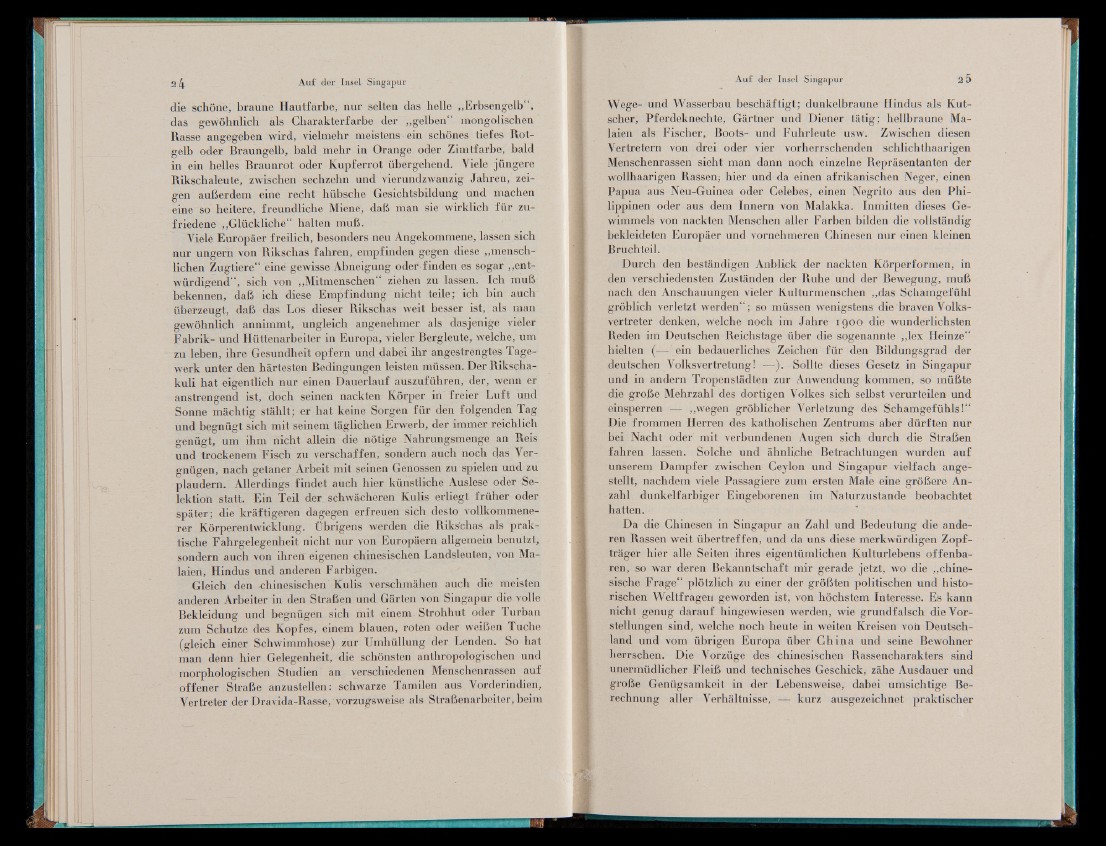
die schöne, braune Hautfarbe, nur selten das helle „Erbsengelb“ ,
das gewöhnlich als Charakterfarbe der „gelben“ mongolischen
Rasse angegeben wird, vielmehr meistens ein schönes tiefes Rotgelb
oder Braungelb, bald mehr in Orange oder Zimtfarbe, bald
in ein helles Braunrot oder Kupferrot übergehend. Viele jüngere
Rikschaleute, zwischen sechzehn und vierundzwanzig Jahren, zeigen
außerdem eine recht hübsche Gesichtsbildung und machen
eine so heitere, freundliche Miene, daß man sie wirklich für zufriedene
„Glückliche“ halten muß.
Viele Europäer freilich, besonders neu Angekommene, lassen sich
nur ungern von Rikschas fahren, empfinden gegen diese „menschlichen
Zugtiere“ eine gewisse Abneigung oder finden es sogar „entwürdigend“
, sich von „Mitmenschen“ ziehen zu lassen. Ich muß
bekennen, daß ich diese Empfindung nicht teile; ich bin auch
überzeugt, daß das Los dieser Rikschas weit besser ist, als man
gewöhnlich annimmt, ungleich angenehmer als dasjenige vieler
Fabrik- und Hüttenarbeiter in Europa, vieler Bergleute, welche, um
zu leben, ihre Gesundheit opfern und dabei ihr angestrengtes Tagewerk
unter den härtesten Bedingungen leisten müssen. Der Rikschakuli
hat eigentlich nur einen Dauerlauf auszuführen, der, wenn er
anstrengend ist, doch seinen nackten Körper in freier Luft und
Sonne mächtig stählt; er hat keine Sorgen für den folgenden Tag
und begnügt sich mit seinem täglichen Erwerb, der immer reichlich
genügt, um ihm nicht allein die nötige Nahrungsmenge an Reis
und trockenem Fisch zu verschaffen, sondern auch noch das Vergnügen,
nach getaner Arbeit mit seinen Genossen zu spielen und zu
plaudern. Allerdings findet auch hier künstliche Auslese oder Selektion
statt. Ein Teil der schwächeren Kulis erliegt früher oder
später; die kräftigeren dagegen erfreuen sich desto vollkommenerer
Körperentwicklung. Übrigens werden die Riks'chas als praktische
Fahrgelegenheit nicht nur von Europäern allgemein benutzt,
sondern auch von ihren eigenen chinesischen Landsleuten, von Malaien,
Hindus und anderen Farbigen.
Gleich den chinesischen Kulis verschmähen auch die meisten
anderen Arbeiter in den Straßen und Gärten von Singapur die volle
Bekleidung und begnügen sich mit einem Strohhut oder Turban
zum Schutze des Kopfes, einem blauen, roten oder weißen Tuche
(gleich einer Schwimmhose) zur Umhüllung der Lenden. So hat
man denn hier Gelegenheit, die schönsten anthropologischen und
morphologischen Studien an verschiedenen Menschenrassen auf
offener Straße anzustellen: schwarze Tamilen aus Vorderindien,
Vertreter der Dravida-Rasse, vorzugsweise als Straßenarbeiter, beim
Wege- und Wasserbau beschäftigt; dunkelbraune Hindus als Kutscher,
Pferdeknechte, Gärtner und Diener tätig; hellbraune Malaien
als Fischer, Boots- und Fuhrleute usw. Zwischen diesen
Vertretern von drei oder vier vorherrschenden schlichthaarigen
Menschenrassen sieht man dann nach einzelne Repräsentanten der
wollhaarigen Rassen; hier und da einen afrikanischen Neger, einen
Papua aus Neu-Guinea oder Celebes, einen Negrito aus den Philippinen
oder aus dem Innern von Malakka. Inmitten dieses Gewimmels
von nackten Menschen aller Farben bilden die vollständig
bekleideten Europäer und vornehmeren Chinesen nur einen kleinen
Bruchteil.
Durch den beständigen Anblick der nackten Körperformen, in
den verschiedensten Zuständen der Ruhe und der Bewegung, muß
nach den Anschauungen vieler Kulturmenschen „das Schamgefühl
gröblich verletzt werden“ ; so müssen wenigstens die braven Volksvertreter
denken, welche noch im Jahre 1900 die wunderlichsten
Reden im Deutschen Reichstage über die sogenannte „lex Heinze“
hielten (— ein bedauerliches Zeichen für den Bildungsgrad der
deutschen Volksvertretung! — ). Sollte dieses Gesetz in Singapur
und in andern Tropenstädten zur Anwendung kommen, so müßte
die große Mehrzahl des dortigen Volkes sich selbst verurteilen und
einsperren — „wegen gröblicher Verletzung des Schamgefühls!“
Die frommen Herren des katholischen Zentrums aber dürften nur
bei Nacht oder mit verbundenen Augen sich durch die Straßen
fahren lassen. Solche und ähnliche Betrachtungen wurden auf
unserem Dampfer zwischen Ceylon und Singapur vielfach angestellt,
nachdem viele Passagiere zum ersten Male eine größere Anzahl
dunkelfarbiger Eingeborenen im Naturzustände beobachtet
hatten.
Da die Chinesen in Singapur an Zahl und Bedeutung die anderen
Rassen weit übertreffen, und da uns diese merkwürdigen Zopfträger
hier alle Seiten ihres eigentümlichen Kulturlebens offenbaren,
so war deren Bekanntschaft mir gerade jetzt, wo die „chinesische
Frage“ plötzlich zu einer der größten politischen und historischen
Weltfragen geworden ist, von höchstem Interesse. Es kann
nicht genug darauf hingewiesen werden, wie grundfalsch die Vorstellungen
sind, welche noch heute in weiten Kreisen von Deutschland
und vom übrigen Europa über C hina und seine Bewohner
herrschen. Die Vorzüge des chinesischen Rassencharakters sind
unermüdlicher Fleiß und technisches Geschick, zähe Ausdauer und
große Genügsamkeit in der Lebensweise, dabei umsichtige Berechnung
aller Verhältnisse, —- kurz ausgezeichnet praktischer