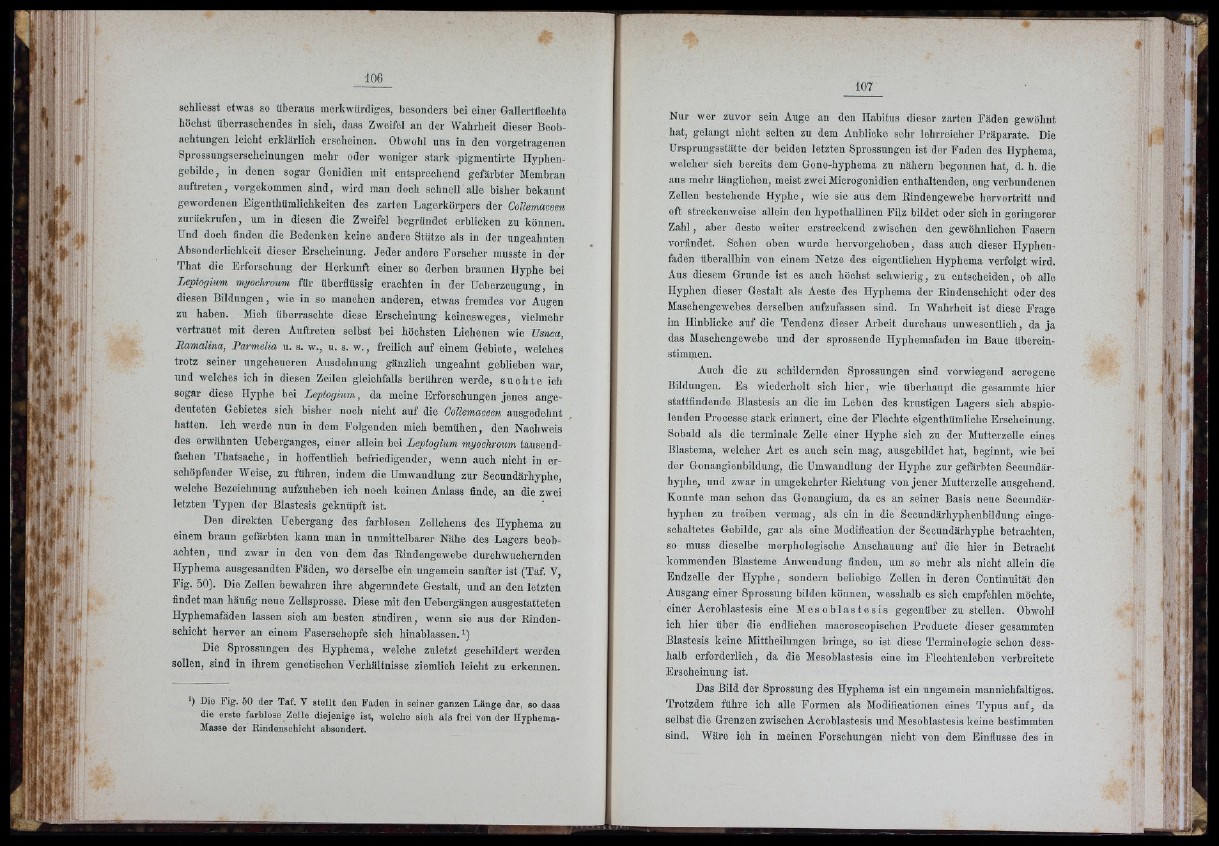
106
schliesst etwas so überaus merkwürdiges, besonders bei einer Gallertflechte
liöchst überraschendes in sich, dass Zweifel an der Wahrheit dieser Beobachtungen
leicht erklärlich erscheinen. Obwohl uns in den vorgetragenen
Sprossungserscheinungen mehr oder weniger stark pigmentirte Hyphengebilde,
in denen sogar Gonidien mit entsprechend gefärbter Membran
auftreten, vorgekommen sind, wird man doch schnell alle bisher bekannt
gewordenen Eigenthümlichkeiten des zarten Lagerkörpers der Collemaceen
znrUckrufen, um in diesen die Zweifel begründet erblicken zu können.
Und doch finden die Bedenken keine andere Stütze als in der ungeahnten
Absonderlichkeit dieser Erscheinung. Jeder andere Forscher musste in der
That die Erforschung der Herkunft einer so derben braunen Hyphe bei
Leptogium myoohroum für überflüssig erachten in der Üeberzeugung, in
diesen Bildungen, wie in so manchen anderen, etwas fremdes vor Augen
zu haben. Mich überraschte diese Erscheinung keinesweges, vielmehr
vertrauet mit deren Auftreten selbst bei höchsten Lichenen wie TJsnea,
Eamalina, Farmelia u. s. w., u. s. w ., freilich auf einem Gebiete, welches
trotz seiner ungeheueren Ausdehnung gänzlich ungeahnt geblieben war,
und welches ich in diesen Zeilen gleiohfalls berühren werde, s u c h t e ich
sogar diese Hyphe bei Leptogium, da meine Erforschungen jenes angedeuteten
Gebietes sich bisher noch nicht auf die Coüemaceen ausgedehnt
hatten. Ich werde nun in dem Folgenden mich bemühen, den Nachweis
des erwähnten Ueberganges, einer allein bei Leptogium myoehroum tausendfachen
Thatsache, in hoffentlich befriedigender, wenn auch nicht in erschöpfender
Weise, zu führen, indem die Umwandlung zur Seoundärhyphe,
welche Bezeichnung aufzuhebon ich noch keinen Anlass finde, an die zwei
letzten Typen der Blastesis geknüpft ist.
Den direkten Uebergang des farblosen Zellchens des Hyphema zu
einem braun gefärbten kann man in unmittelbarer Nähe des Lagers beobachten,
und zwar in den von dem das Rindengewebe durchwuohernden
Hyphema ausgesandten Fäden, wo derselbe ein ungemein sanfter ist (Taf. V,
Fig. 50). Die Zellen bewahren ihre abgerundete Gestalt, und an den letzten
findet man häufig neue Zellsprosse. Diese mit den Uebergängen ausgestatteten
Hyphemafäden lassen sich am besten studiren, wenn sie aus der Rindenschicht
hervor an einem Faserschopfe sieh hinablassen.')
Die Sprossungen des Hyphema, welche zuletzt geschildert werden
sollen, sind in ihrem genetischen Verhältnisse ziemlich leicht zu erkennen.
') Die Fig. 50 der Taf. V stellt den Faden in seiner ganzen Länge dar, so dass
die erste farblose Zelle diejenige ist, welche sich als frei von der Hyphema-
Masse der Rindenschiclit absondert.
' ' I i i
Nur wer zuvor sein Auge an den Habitus dieser zarten Fäden gewöhnt
hat, gelangt nicht selten zu dem Anblicke sehr lehrreicher Präparate. Die
ürsprungsstätte der beiden letzten Sprossungen ist der Faden des Hyphema,
welcher sich bereits dem Gono-hyphema zu nähern begonnen hat, d. h. die
ans mehr länglichen, meist zwei Microgonidien enthaltenden, eng verbundenen
Zellen bestehende Hyphe, wie sie aus dem Rindengewebe hervortritt und
oft streckenweise allein den hypothallinen Filz bildet oder sich in geringerer
Zahl, aber desto weiter erstreckend zwischen den gewöhnlichen Fasern
vorfindet. Schon oben wurde hervorgehoben, dass auch dieser Hyphen-
faden überallhin von einem Netze des eigentlichen Hyphema verfolgt wird.
Aus diesem Grunde ist es auch höchst schwierig, zu entscheiden, ob alle
Hyphen dieser Gestalt als Aeste des Hyphema der Rindensohicht oder des
Maschengewebes derselben anfzufassen sind. In Wahrheit ist diese Frage
im Hinblicke auf die Tendenz dieser Arbeit durchaus unwesentlich, da ja
das Masohengowebe und der sprossende Hyphemafaden im Baue Uberemstimmen.
Auch die zu sohildernden Sprossungen sind vorwiegend acrogene
Bildungen. Es wiederholt sich hier, wie überhaupt die gesammte hier
stattfindende Blastesis an die im Lehen des krustigen Lagers sich abspielenden
Prooesse stark erinnert, eine der Flechte eigenthümliche Erscheinung.
Sobald als die terminale Zelle einer Hyphe sich zu der Mutterzelle eines
Blastema, welcher Art es auch sein mag, ausgebildet hat, beginnt, wie bei
der Gonangienbildung, die Umwandlung der Hyphe zur gefärbten Secundär-
hyphe, und zwar in umgekehrter Richtung von jener Mutterzelle ausgehend.
Konnte man schon das Gonangium, da es an seiner Basis neue Secundär-
hyphen zu treiben vermag, als ein in die Secundärhyphenhildung eingeschaltetes
Gebilde, gar als eine Modification der Seoundärhyphe betrachten,
so muss dieselbe morphologische Anschauung auf die hier in Betracht
kommenden Blasteme Anwendung finden, um so mehr als nicht allein die
Endzeile der Hyphe, sondern beliebige Zellen in deren Continuität den
Ausgang einer Sprossung bilden können, wesshalb es sich empfehlen möchte,
einer Acroblastesis eine Me s o b l a s t e s i s gegenüber zu stellen. Obwohl
ich hier über die endlicheu macroscopischen Producte dieser gesammten
Blastesis keine Mittheilungen bringe, so ist diese Terminologie schon desshalb
erforderlich, da die Mesoblastesis eine im Fleohtenleben verbreitete
Erscheinung ist.
Das Bild der Sprossung des Hyphema ist ein ungemein manniohfaltiges.
Trotzdem führe ich alle Formen als Modificationen eines Typus auf, da
selbst die Grenzen zwischen Acroblastesis und Mesoblastesis keine bestimmten
sind. Wäre ich in meinen Forschungen nicht von dem Einflüsse des in
ii\
•iü
9!"