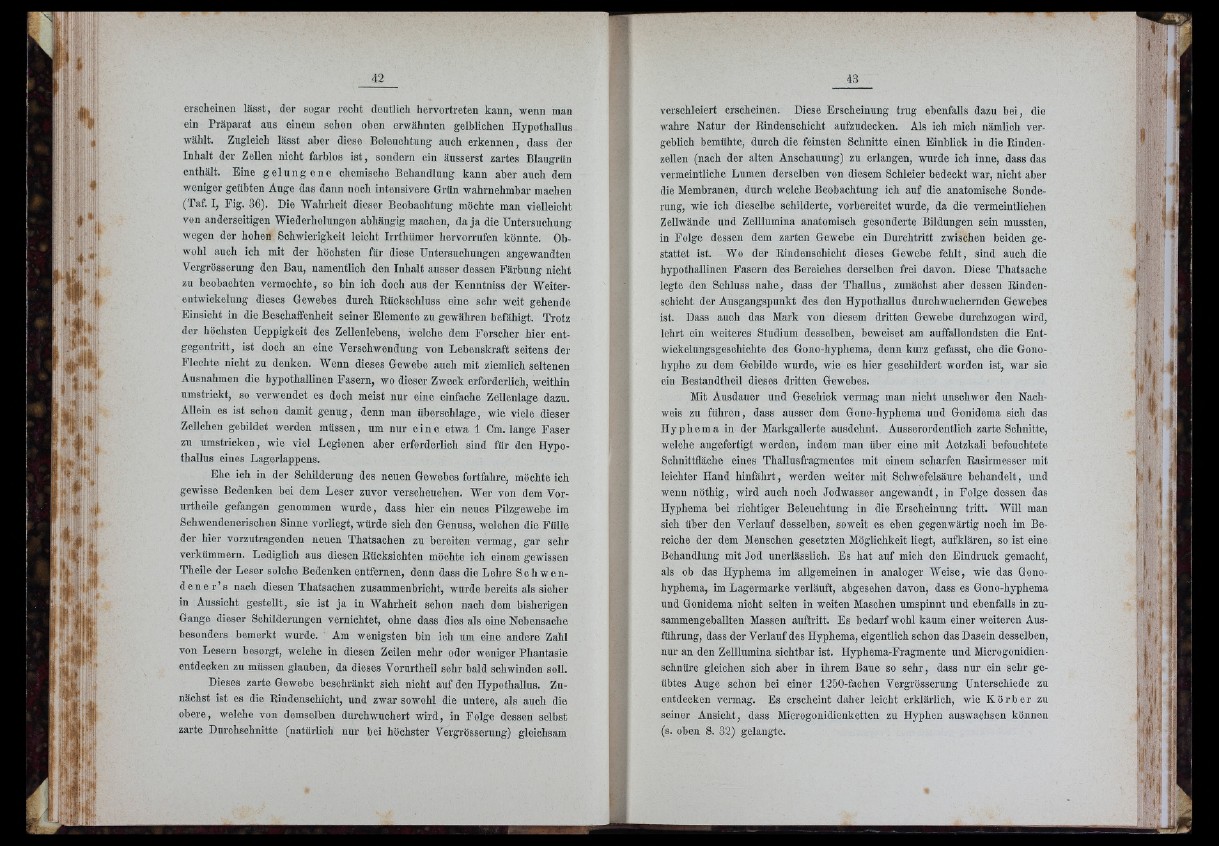
ll' 9''
k ' . m
erscheinen lässt, der sogar recht deutlich hervortreten kann, wenn man
ein Präparat aus einem schon oben erwähnten gelblichen Hypothallus
wählt. Zugleich lässt aber diese Beleuchtung auch erkennen, dass der
Inhalt der Zellen nicht farblos is t , sondern ein äusserst zartes Blaugrün
enthält. Eine g e l u n g e n e chemische Behandlung kann aber auch dem
weniger geübten Auge das dann noch intensivere Grün wahrnehmbar machen
(Taf. I, Fig. 36). Die Wahrheit dieser Beobachtung möchte man vielleicht
von anderseitigen Wiederholungen abhängig machen, da ja die Untersuchung
wegen der hohen Schwierigkeit leicht Irrthümer hervorrufen könnte. Obwohl
auch ich mit der höchsten für diese Untersuchungen angewandten
Vergrösserung den Bau, namentlich den Inhalt ausser dessen Färbung nicht
zu beobachten vermochte, so bin ich doch aus der Kenntniss der Weiter-
entwiokelung dieses Gewebes durch Rückschluss eine sehr weit gehende
Einsicht in die Beschaffenheit seiner Elemente zu gewähren befähigt. Trotz
der höchsten Üeppigkeit des Zellenlebens, welche dem Forscher hier entgegentritt,
ist doch an eine Verschwendung von Lebenskraft seitens der
Flechte nicht zu denken. Wenn dieses Gewebe auch mit ziemlich seltenen
Ausnahmen die hypothallinen Fasern, wo dieser Zweck erforderlich, weithin
umstrickt, so verwendet es doch meist nur eine einfache Zellenlage dazu.
Allein es ist schon damit genug, denn man Überschläge, wie viele dieser
Zellchen gebildet werden müssen, um nur e i n e etwa 1 Cm. lange Faser
zu umstricken, wie viel Legionen aber erforderlich sind für den Hypothallus
eines Lagerlappens.
Ehe ich in der Schilderung des neuen Gewebes fortfahre, möchte ich
gewisse Bedenken bei dem Leser zuvor verscheuchen. Wer von dem Vor-
urtheile gefangen genommen wurde, dass hier ein neues Pilzgewebe im
Sehwendenerischen Sinne vorliegt, würde sich den Genuss, welchen die Fülle
der hier vorzutragenden neuen Thatsachen zu bereiten vermag, gar sehr
verkümmern. Lediglich aus diesen Rücksichten möchte ich einem gewissen
Theile der Leser solche Bedenken entfernen, denn dass die Lehre S c h w e n d
e n e r ’s nach diesen Thatsachen zusammenbrieht, wurde bereits als sicher
in Aussicht gestellt, sie ist ja in Wahrheit schon nach dem bisherigen
Gange dieser Schilderungen vernichtet, ohne dass dies als eine Nebensache
besonders bemerkt wurde. ' Am wenigsten bin ich um eine andere Zahl
von Lesern besorgt, welche in diesen Zeilen mehr oder weniger Phantasie
entdecken zu müssen glauben, da dieses Vorurtheil sehr bald schwinden soll.
Dieses zarte Gewebe beschränkt sich nicht auf den Hypothallus. Zunächst
ist es die Rindensohicht, und zwar sowohl die untere, als auch die
obere, welche von demselben durchwuchert wird, in Folge dessen selbst
zarte Durchschnitte (natürlich nur bei höchster Vergrösserung) gleichsam
verschleiert erscheinen. Diese Erscheinung trug ebenfalls dazu bei, die
wahre Natur der Rindensohicht aufzudecken. Als ich mich nämlich vergeblich
bemühte, durch die feinsten Schnitte einen Einblick in die Rindenzellen
(nach der alten Anschauung) zu erlangen, wurde loh inne, dass das
vermeintliche Lumen derselben vou diesem Schleier bedeckt war, nicht aber
die Membranen, durch welche Beobachtung ich auf die anatomische Sonderung,
wie ich dieselbe schilderte, vorbereitet wurde, da die vermeintlichen
Zellwände und Zelllumina anatomisch gesonderte Bildungen sein mussten,
in Folge dessen dem zarten Gewebe ein Durchtritt zwischen beiden gestattet
ist. Wo der Rindensohicht dieses Gewebe fehlt, sind auch die
hypothallinen Fasern des Bereiches derselben frei davon. Diese Thatsache
legte den Schluss nahe, dass der Thallus, zunächst aber dessen Rindenschicht
der Ausgangspunkt des den Hypothallus durchwuchernden Gewebes
ist. Dass auch das Mark von diesem dritten Gewebe durchzogen wird,
lehrt ein weiteres Studium desselben, beweiset am auffallendsten die Ent-
wiokelungsgeschichte des Gono-hyphema, denn kurz gefasst, ehe die Gono-
hyphe zu dem Gebilde wurde, wie es hier geschildert worden ist, war sie
ein Bestandtheil dieses dritten Gewebes.
Mit Ausdauer und Geschick vermag man nicht unschwer den Nachweis
zu führen, dass ausser dem Gono-hyphema und Gonidema sich das
H y p h e m a in der Markgallerte ausdehnt. Ausserordentlich zarte Schnitte,
welche angefertigt werden, indem man über eine mit Aetzkali befeuchtete
Schnittfläche eines Thallusfragmentes mit einem scharfen Rasirmesser mit
leichter Hand hinfährt, werden weiter mit Schwefelsäure behandelt, und
wenn nöthig, wird auch noch Jodwasser angewandt, in Folge dessen das
Hyphema bei richtiger Beleuchtung in die Erscheinung tritt. Will man
sieh über den Verlauf desselben, soweit es eben gegenwärtig noch im Bereiche
der dem Menschen gesetzten Möglichkeit liegt, aufklären, so ist eine
Behandlung mit Jod unerlässlich. Es hat auf mich den Eindruck gemacht,
als ob das Hyphema im allgemeinen in analoger Weise, wie das Gono-
hyphema, im Lagermarke verläuft, abgesehen davon, dass es Gono-hyphema
und Gonidema nicht selten in weiten Maschen umspinnt und ebenfalls in zusammengeballten
Massen auftritt. Es bedarf wohl kaum einer weiteren Ausführung,
dass der Verlauf des Hyphema, eigentlich schon das Dasein desselben,
nur an den Zelllnmina sichtbar ist. Hyphema-Fragmente und Microgonidien-
schnüre gleichen sich aber in ihrem Baue so sehr, dass nur ein sehr geübtes
Auge schon bei einer 1250-faohen Vergrösserung Unterschiede zu
entdecken vermag. Es erscheint daher leicht erklärlich, wie K o r b e r zu
seiner Ansicht, dass Miorogonidionketten zu Hyphen auswachsen können
(s. oben 8. 32) gelangte.
1^: 9 l|
ly il ‘ AM Iß I ;t ' '
' tf
': ' fei <:*u
I 11
m
I l i ri