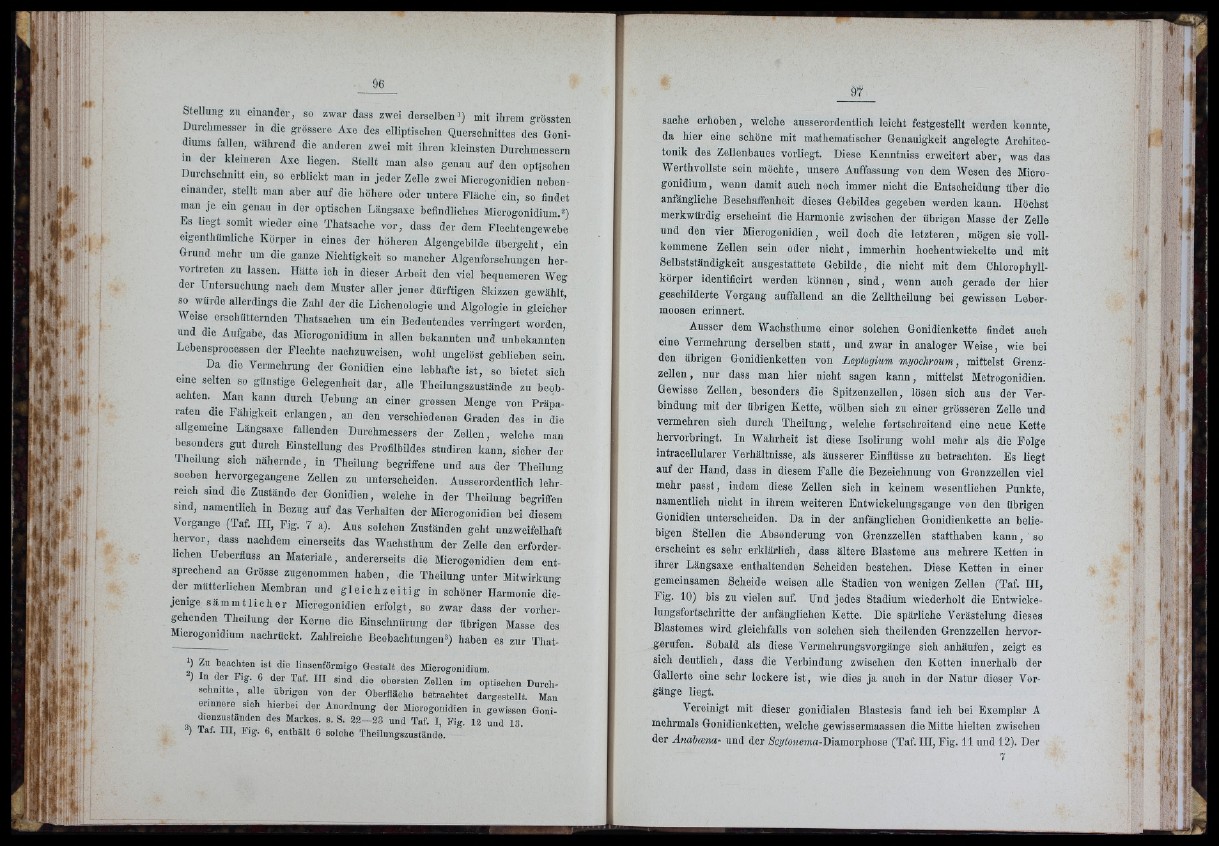
Stellung zu einander, so zwar dass zwei derselben') mit ihrem grössten
Durchmesser iu die grössere Axe des elliptischen Querschnittes des Goni-
diums fallen, während die anderen zwei mit ihren kleinsten Durchmessern
m der kleineren Axe liegen. Stellt man also genau auf den optischen
Durchschnitt ein, so erblickt man in jeder Zeile zwei Microgonidien nebeneinander,
stellt man aber auf die höhere oder untere Fläche ein, so findet
man je ein genau in der optischen Längsaxe befindliches Miorogonidium.®)
Es liegt somit wieder eine Thatsache vor, dass der dem Fleohtengewebe
eigenthümliche Körper in eines der höheren Algengebilde übergeht, ein
Grund mehr um die ganze Nichtigkeit so mancher Algenforschuugen hervortreten
zu lassen. Hätte ich in dieser Arbeit den viel bequemeren Weg
der üntersuchung nach dem Muster aller jener dürftigen Skizzen gewählt
so Würde allerdings die Zahl der die Lichenologie und Algologie in gleicher
Weise erschütternden Thatsachen um ein Bedeutendes verringert worden,
und die Aufgabe, das Microgonidium iu allen bekannten und unbekannten
Lebensprocessen der Flechte nachzuweisen, wohl ungelöst geblieben sein.
Da die Vermehrung der Gonidien eine lebhafte ist, so bietet sich
eine selten so günstige Gelegenheit dar, alle Theilungsznstände zu beobachten.
Man kann durch Uebung an einer grossen Menge von Präparaten
die Fähigkeit erlangen, an den verschiedenen Graden des in die
allgemeine Längsaxe fallenden Durchmessers der Zellen, welche man
besonders gut durch Einstellung des Profilbildes studiren kann, sicher der
Iheilung sich nähernde, in Theilung begriffene und aus der Theilung
soebeiy hervorgegangene Zellen zu unterscheiden. Ausserordentlich lehrreich
sind die Zustände der Gonidien, welche in der Theilung begriffen
smd, namentlich in Bezug auf das Verhalten der Microgonidien bei diesem
Vorgänge (Taf. III, Fig. 7 a). Aus solchen Zuständen geht unzweifelhaft
hervor, dass nachdem einerseits das Wachsthum der Zelle den erforderlichen
Ueberflnss an Materiale, andererseits die Microgonidien dem entsprechend
an Grösse zugenommen haben, die Theilung unter Mitwirkung
der mütterlichen Membran und g l e i c h z e i t i g in schöner Harmonie diejenige
s ämmt l i o h e r Microgonidien erfolgt, so zwar dass der vorhergehenden
Theilung der Kerne die Einschnürung der übrigen Masse des
icrogoiiidium uachrückt. Zalilreicke Beobaclitungen^) haben es zur Tbat-
') Zu beachten ist die linsenförmige Gestalt des Microgonidium.
) In der Fig. 6 der Taf. III sind die obersten Zellen im optischen Durchschnitte,
alle übrigen von der Oberfläche betrachtet dargestellt. Man
erinnere sich hierbei der Anordnung der Microgonidien in gewissen Goni-
dienzuständen des Markes, s. S. 22—23 und Taf. I, Fig. 12 und 13.
®) Taf. III, Fig. 6, enthält 6 solche Theilungsznstände.
Sache erhoben, welche ausserordentlich leicht festgestellt werden konnte,
da hier eine schöne mit mathematischer Genauigkeit angelegte Architec-
tonik des Zellenbaues vorliegt. Diese Kenntniss erweitert aber, was das
Werthvollste sein mochte, unsere Auffassung von dem Wesen des Microgonidium,
wenn damit auch noch immer nicht die Entscheidung über die
anfängliche Beschaffenheit dieses Gebildes gegeben werden kann. Höchst
merkwürdig erscheint die Harmonie zwischen der übrigen Masse der Zelle
und den vier Microgonidien, weil doch die letzteren, mögen sie vollkommene
Zellen sein oder nicht, immerhin hochentwickelte und mit
Selbstständigkeit ausgestattete Gebilde, die nicht mit dem Chlorophyllkörper
identificirt werden können, sin d , wenn auch gerade der hier
geschilderte Vorgang auffallend an die Zelltheilung bei gewissen Lebermoosen
erinnert.
Ausser dem Wachsthume einer solohen Gonidienkette findet auch
eine Vermehrung derselben statt, und zwar in analoger Weise, wie bei
den übrigen Gonidienketten von Leptogium myoohroum, mittelst Grenzz
e llen , nur dass man hier nicht sagen kann, mittelst Metrogonidien.
Gewisse Zellen, besonders die Spitzenzellen, lösen sich aus der Verbindung
mit der übrigen Kette, wölben sich zu einer grösseren Zelle und
vermehren sich durch Theilung, welche fortschreitend eine neue Kette
hervorbringt. In Wahrheit ist diese Isolirung wohl mehr als die Folge
intracellularer Verhältnisse, als äusserer Einflüsse zu betrachten. Es liegt
auf der Hand, dass in diesem Falle die Bezeichnung von Grenzzellen viel
mehr passt, indem diese Zellen sich in keinem wesentiiohen Punkte,
namentlich nicht in ihrem weiteren Entwiokelungsgange von den übrigen
Gonidien unterscheiden. Da in der anfänglichen Gonidienkette an beliebigen
Stellen die Absonderung von Grenzzellen statthaben kann, so
erscheint es sehr erklärlich, dass ältere Blasteme aus mehrere Ketten in
ihrer Längsaxe enthaltenden Scheiden bestehen. Diese Ketten in einer
gemeinsamen Scheide weisen alle Stadien von wenigen Zellen (Taf. HI,
Fig. 10) bis zu vielen auf. Und jedes Stadium wiederholt die Entwickelungsfortschritte
der anfänglichen Kette. Die spärliche Verästelung dieses
Blastemes wird gleichfalls von solchen sich theilenden Grenzzellen hervor-
gernfen. Sobald als diese Vermehrungsvorgänge sich anhäufen, zeigt es
sich deutlich, dass die Verbindung zwischen den Ketten innerhalb der
Gallerte eine sehr lockere ist, wie dies ja auch in der Natur dieser Vorgänge
liegt.
Vereinigt mit dieser gonidialen Blastesis fand ich bei Exemplar A
mehrmals Gonidienketten, welche gewissermaassen die Mitte hielten zwischen
der Anabaina- und der Scytonema-Di&moxphose (Taf. III, Fig. 11 und 12). Der
■ k i a
. i l
ill ?