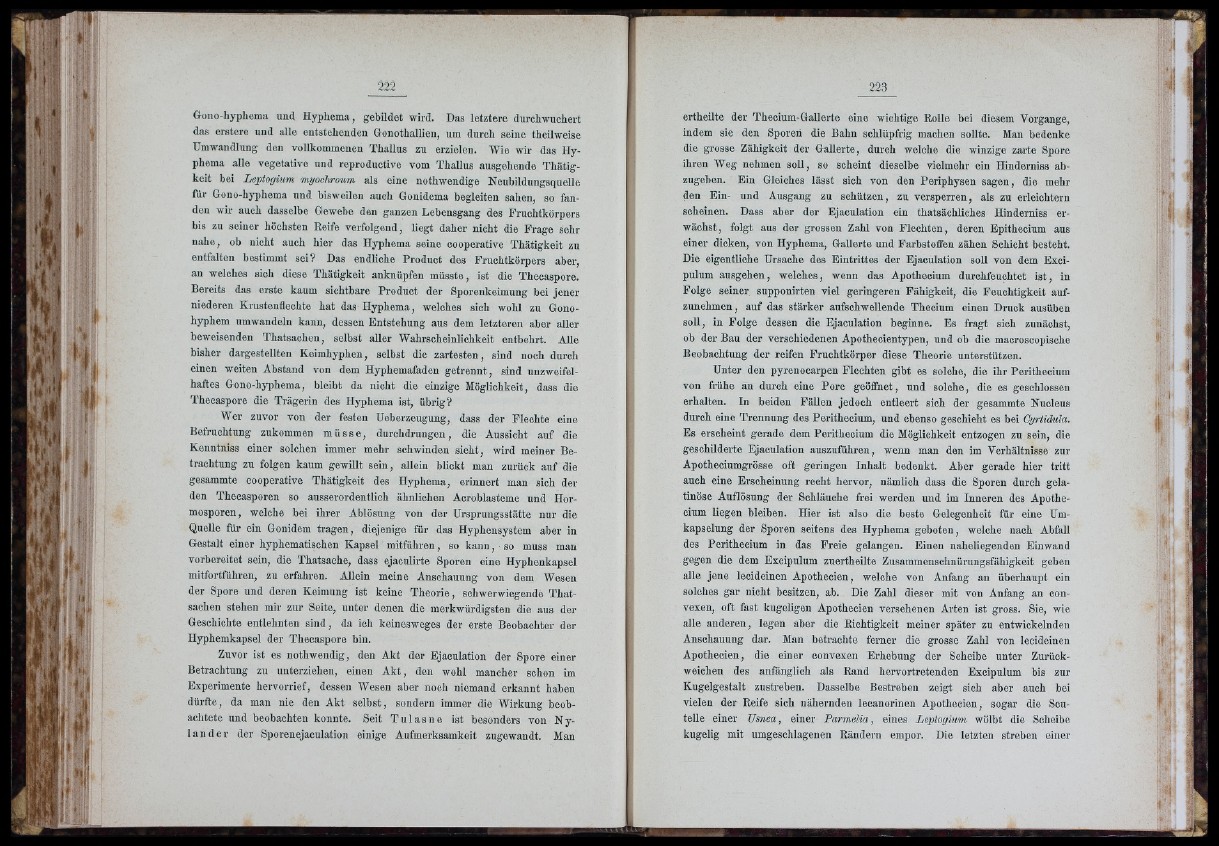
t f
U f#
Gono-hyphema und Hyphema, gebildet wird. Das letztere durehwuchert
das erstere und alle entstehenden Gonothallien, um durch seine theilweise
Umwandlung den vollkommenen Thallus zu erzielen. Wie wir das Hyphema
alle vegetative und reproductive vom Thallus ausgehende Thätigkeit
bei Leptogium myoohroum als eine nothwendige Neubildungsquelle
für Gono-hyphema und bisweilen auch Gonidema begleiten sahen, so fanden
wir auch dasselbe Gewebe deu ganzen Lebensgang des Fruchtkörpers
bis zn seiner höchsten Reife verfolgend, liegt daher nicht die Frage sehr
nahe, ob nicht auch hier das Hyphema seine cooperative Thätigkeit zu
entfalten bestimmt sei? Das endliche Product des Fruohtkörpers aber,
an welches sich diese Thätigkeit anknüpfen müsste, ist die Thecaspore.
Bereits das erste kaum sichtbare Product der Sporenkeimung bei jener
niederen Krustenfleohte hat das Hyphema, welches sich wohl zu Gonohyphem
umwandeln kann, dessen Entstehung aus dem letzteren aber aller
beweisenden Thatsachen, selbst aller Wahrscheinlichkeit entbehrt. Alle
bisher dargestellten Keimhyphen, selbst die zartesten, sind noch durch
einen weiten Abstand von dem Hyphemafaden getrennt, sind unzweifelhaftes
Gono-hyphema, bleibt da nicht die einzige Möglichkeit, dass die
Thecaspore die Trägerin des Hyphema ist, übrig?
Wer zuvor von der festen Üeberzeugung, dass der Flechte eine
Befruchtung zukommen m ü s s e , durchdrungen, die Aussicht auf die
Kenntniss einer solchen immer mehr schwinden sieht, wird meiner Betrachtung
zu folgen kaum gewillt se in, allein blickt man zurück auf die
gesammte cooperative Thätigkeit des Hyphema, erinnert man sich der
den Thecasporen so ausserordentlich ähnlichen Acroblasteme und Hormosporen,
welche bei ihrer Ablösung von der Ursprungsstätte nur die
Quelle für ein Gonidem tragen, diejenige für das Hyphensystem aber in
Gestalt einer hyphematisehen Kapsel mitführen, so kann, so muss man
vorbereitet sein, die Thatsache, dass ejaoulirte Sporen eine Hyphenkapsel
mitfortführen, zu erfahren. Allein meine Anschauung von dem Wesen
der Spore und deren Keimung ist keine Theorie, schwerwiegende Thatsachen
stehen mir zur Seite, unter denen die merkwürdigsten die aus der
Geschichte entlehnten sin d , da ich keinesweges der erste Beobachter der
Hyphemkapsel der Thecaspore bin.
Zuvor ist es nothwendig, den Akt der Ejaculation der Spore einer
Betrachtung zu unterziehen, einen Akt , den wohl mancher schon im
Experimente hervorrief, dessen Wesen aber noch niemand erkannt haben
dürfte, da man nie den Akt se lbst, sondern immer die Wirkung beobachtete
und beobachten konnte. Seit T u l a s n e ist besonders von N y l
a n d e r der Sporeuejaculation einige Aufmerksamkeit zugewandt. Man
ertheilte der Thecium-Gallerte eine wichtige Rolle bei diesem Vorgänge,
indem sie den Sporen die Bahn schlüpfrig machen sollte. Man bedenke
die grosse Zähigkeit der Gallerte, durch welche die winzige zarte Spore
ihren Weg nehmen so ll, so scheint dieselbe vielmehr ein Hiuderniss abzugehen.
Ein Gleiches lässt sich von den Periphysen sagen, die mehr
den Ein- und Ausgang zu schützen, zu versperren, als zu erleichtern
scheinen. Dass aber der Ejaculation ein thatsächliohes Hinderniss erwächst,
folgt aus der grossen Zahl von Flechten, deren Epithecium aus
einer dieken, von Hyphema, Gallerte und Farbstoffen zähen Schicht besteht.
Die eigentliche Ursache des Eintrittes der Ejaculation soll von dem Excipulum
ausgeheu, welches, wenn das Apothecium durchfeuchtet is t , in
Folge seiner supponirteu viel geringeren Fähigkeit, die Feuchtigkeit aufzunehmen,
auf das stärker aufschwellende Thecium einen Druck ausüben
so ll, in Folge dessen die Ejaculation beginne. Es fragt sich zunächst,
ob der Bau der verschiedenen Apotheoientypen, und ob die macroscopische
Beobachtung der reifen Fruchtkörper diese Theorie unterstützen.
ünter den pyrenocarpen Fleohten gibt es solche, die ihr Perithecium
von frühe an durch eine Pore geöffnet, und solche, die es geschlossen
erhalten. In beiden Fällen jedoch entleert sieh der gesammte Nuoleus
durch eine Trennung des Perithecium, und ebenso geschieht es bei Cyrtidula.
Es erscheint gerade dem Perithecium die Möglichkeit entzogen zu sein, die
geschilderte Ejaculation auszuführen, wenn man den im Verhältnisse zur
Apotheciumgrösse oft geringen Inhalt bedenkt. Aber gerade hier tritt
auch eine Erscheinung recht hervor, nämlich dass die Sporen durch gelatinöse
Auflösung der Schläuche frei werden und im Inneren des Apothe-
oium liegen bleiben. Hier ist also die beste Gelegenheit für eine üm-
kapselung der Sporen seitens des Hyphema geboten, welche nach Abfall
des Perithecium in das Freie gelangen. Einen naheliegenden Ein wand
gegen die dem Excipulum zuertheilte Zusammenschuürungsfähigkeit geben
alle jene leeideinen Apothecien, welche von Anfang an überhaupt ein
solches gar nicht besitzen, ah. Die Zahl dieser mit von Anfang an convexen,
oft fast kugeligen Apothecien versehenen Arten ist gross. Sie, wie
alle anderen, legen aber die Richtigkeit meiner später zu entwickelnden
Anschauung dar. Man betrachte ferner die grosse Zahl von leeideinen
Apothecien, die einer convexen Erhebung der Scheibe unter Zurückweichen
des anfänglich als Rand hervortretenden Excipulum bis zur
Kugelgestalt zustreben. Dasselbe Bestreben zeigt sich aber auch bei
vielen der Reife sich nähernden lecanorinen Apothecien, sogar die Soutelle
einer Usnea, einer Parmelia, eines Leptogium wölbt die Scheibe
kugelig mit umgeschlagenen Rändern empor. Die letzten streben einer