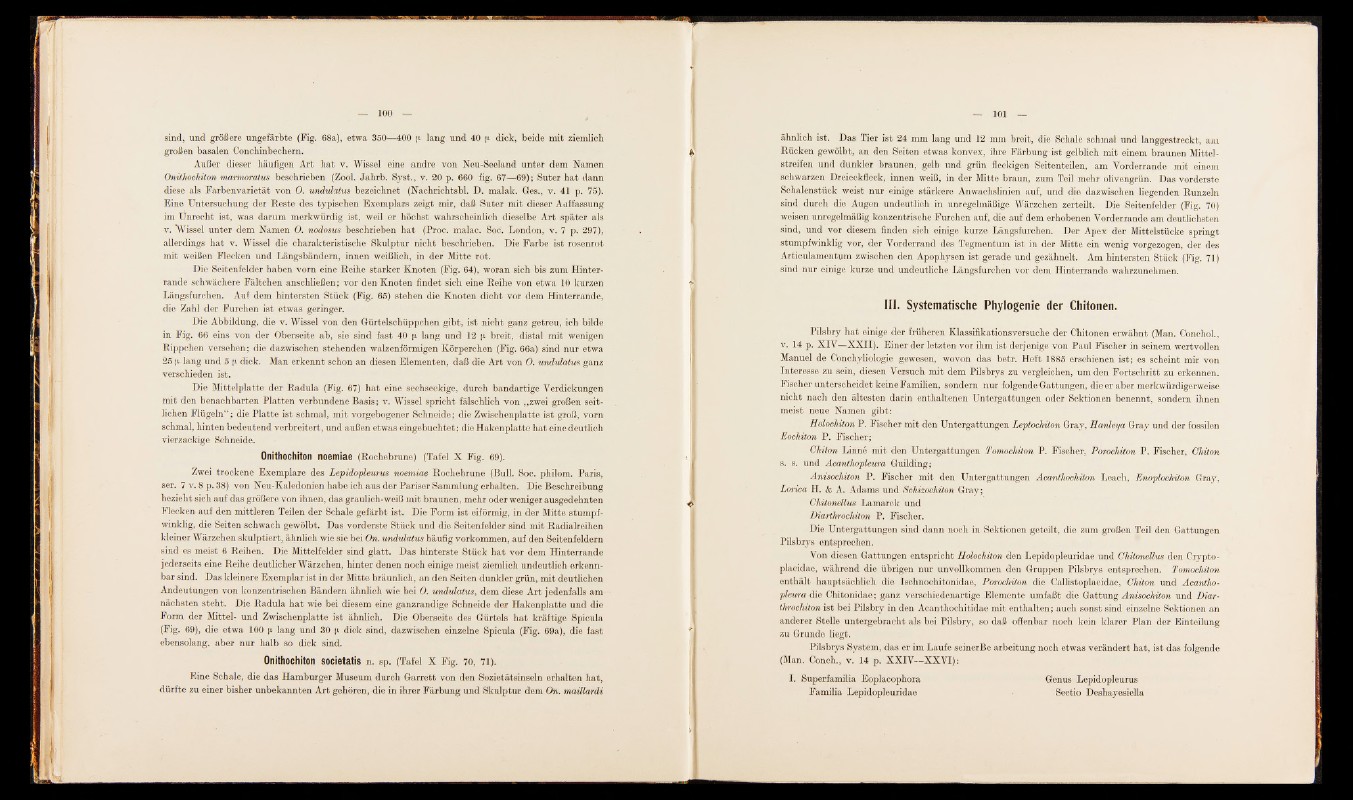
sind, und größere ungefärbte (Fig. 68a), etwa 350—400 [a lang und 40 ja dick, beide mit ziemlich
großen basalen Conchinbechern.
Außer dieser häufigen Art h a t v. Wissel eine andre von Neu-Seeland unter dem Namen
Onithochiton marmoratus beschrieben (Zool. Jahrb. Syst., v. 20 p. 660 fig. 67—69); Suter h a t dann
diese als Farbenvarietät von 0 . undulatus bezeichnet (Nachrichtsbl. D. malak. Ges., v. 41 p. 75).
Eine Untersuchung der Reste des typischen Exemplars zeigt mir, daß Suter mit dieser Auffassung
im Unrecht ist, was darum merkwürdig ist, weil er höchst wahrscheinlich dieselbe Art später als
v. Wissel unter dem Namen 0 . nodosus beschrieben h a t (Proc. malac. Soc. London, v. 7 p. 297),
allerdings h a t v. Wissel die charakteristische Skulptur nicht beschrieben. Die Farbe is t rosenrot
mit weißen Flecken und Längsbändern, innen weißlich, in der Mitte rot.
Die Seitenfelder haben vorn eine Reihe starker Knoten (Fig. 64), woran sich bis zum Hinterrande
schwächere Fältchen anschließen; vor den Knoten findet sich eine Reihe von etwa 10 kurzen
Längsfurchen. Auf dem hintersten Stück (Fig. 65) stehen die Knoten dicht vor dem Hinterrande,
die Zahl der Furchen ist etwas geringer.
Die Abbildung, die v. Wissel von den Gürtelschüppchen gibt, is t nicht ganz getreu, ich bilde
in Fig. 66 eins von der Oberseite ab, sie sind fast 40 ja lang und 12 ja breit, distal mit wenigen
Rippchen versehen; die dazwischen stehenden walzenförmigen Körperchen (Fig. 66a) sind nur etwa
25 ja lang und 5 |a dick. Man erkennt schon an diesen Elementen, daß die Art von 0 . undulatus ganz
verschieden ist.
Die Mittelplatte der Radula (Fig. 67) h a t eine sechseckige, durch bandartige Verdickungen
mit den benachbarten P la tten verbundene Basis; v. Wissel spricht fälschlich von „zwei großen seitlichen
Flügeln“ ; die P la tte is t schmal, mit vorgebogener Schneide; die Zwischenplatte is t groß, vorn
schmal, hinten bedeutend verbreitert, und außen etwas eingebuchtet; die Hakenplatte h a t eine deutlich
vierzackige Schneide.
Onithochiton noemiae (Rochebrune) (Tafel X Fig. 69).
Zwei trockene Exemplare des Lepidopleurus noemiae Rochebrune (Bull. Soc. philom. Paris,
ser. 7 v. 8 p. 38) von Neu-Kaledonien habe ich aus der P ariser Sammlung erhalten. Die Beschreibung
bezieht sich auf das größere von ihnen, das graulich-weiß mit braunen, mehr oder weniger ausgedehnten
Flecken auf den mittleren Teilen der Schale gefärbt ist. Die Form ist eiförmig, in der Mitte stumpfwinklig,
die Seiten schwach gewölbt. Das vorderste Stück und die Seitenfelder sind mit Radialreihen
kleiner W ärzchen skulptiert, ähnlich wie sie bei On. undulatus häufig Vorkommen, auf den Seitenfeldern
sind es meist 6 Reihen. Die Mittelfelder sind glatt. Das hinterste Stück h a t vor dem Hinterrande
jederseits eine Reihe deutlicher Wärzchen, hinter denen noch einige meist ziemlich undeutlich erkennb
a r sind. Das kleinere E xemplar is t in der M itte bräunlich, an den Seiten dunkler grün, mit d eutlichen
Andeutungen von konzentrischen Bändern ähnlich wie bei 0 . undulatus, dem diese Art jedenfalls am
nächsten steht. Die Radula h a t wie bei diesem eine ganzrandige Schneide der Hakenplatte und die
Form der Mittel- und Zwischenplatte is t ähnlich. Die Oberseite des Gürtels h a t kräftige Spicula
(Fig. 69), die etwa 100 |a lang und 30 |a dick sind, dazwischen einzelne Spicula (Fig. 69a), die fast
ebensolang, aber nur halb so dick sind.
Onithochiton societatis n. sp. (Tafel X Fig. 70, 71).
Eine Schale, die das Hamburger Museum durch Ga rre tt von den Sozietätsinseln erhalten hat,
dürfte zu einer bisher unbekannten Art gehören, die in ihrer Färbung und Skulptur dem On. mailla/rdi
ähnlich ist. Das Tier is t 24 mm lang und 12 mm breit, die Schale schmal und langgestreckt, am
Rücken gewölbt, an den Seiten etwas konvex, ihre Färbung ist gelblich mit einem braunen Mittelstreifen
und dunkler braunen, gelb und grün fleckigen Seitenteilen, am Vorderrande mit einem
schwarzen Dreieckfleck, innen weiß, in der Mitte braun, zum Teil mehr olivengrün. Das vorderste
Schalenstück weist nur einige stärkere Anwachslinien auf, und die dazwischen liegenden Runzeln
sind durch die Augen undeutlich in unregelmäßige Wärzchen zerteilt. Die Seitenfelder (Fig. 70)
weisen unregelmäßig konzentrische Furchen auf, die auf dem erhobenen Vorderrande am deutlichsten
sind, und vor diesem finden sich einige kurze Längsfurchen. Der Apex der Mittelstücke springt
stumpfwinklig vor, der Vorderrand des Tegmentum is t in der Mitte ein wenig vorgezogen, der des
Articulamentum zwischen den Apophysen ist gerade und gezähnelt. Am hintersten Stück (Fig. 71)
sind nur einige kurze und undeutliche Längsfurchen vor dem Hinterrande wahrzunehmen.
III. Systematische Phylogenie der Chitonen.
Pilsbry h a t einige der früheren Klassifikationsversuche der Chitonen erwähnt (Man. Conchol.,
v. 14 p. XIV—XXII). Einer der letzten vor ihm ist derjenige von Paul Fischer in seinem wertvollen
Manuel de Conchyliologie gewesen, wovon das betr. Heft 1885 erschienen ist; es scheint mir von
Interesse zu sein, diesen Versuch mit dem Pilsbrys zu vergleichen, um den F ortschritt zu erkennen.
Fischer unterscheidet keine Familien, sondern nur folgende Gattungen, die er aber merkwürdigerweise
n icht nach den ältesten darin enthaltenen Untergattungen oder Sektionen benennt, sondern ihnen
meist neue Namen gibt:
Holochiton P. Fischer mit den U ntergattungen Leptochiton Gray, Hanleya Gray und der fossilen
Eochiton P. Fischer;
Chiton Linné mit den Untergattungen Tomochiton P. Fischer, Porochiton P. Fischer, Chiton
s. s. und Acanthopleura Guilding;
Anisochiton P. Fischer mit den Untergattungen Acanthochiton Leach, Enoplochiton Gray,
Lorica H. & A. Adams und Schizochiton Gray;
Chitonellus Lamarck und
Diarthrochiton P. Fischer.
Die Untergattungen sind dann noch in Sektionen geteilt, die zum großen Teil den Gattungen
Pilsbrys entsprechen.
Von diesen Gattungen entspricht Holochiton den Lepidopleuridae und Chitonellus den Crypto-
placidae, während die übrigen nur unvollkommen den Gruppen Pilsbrys entsprechen. Tomochiton
enthält hauptsächlich die Ischnochitonidae, Porochiton die Callistoplacidae, Chiton und Acanthopleura
die Chitonidae; ganz verschiedenartige Elemente umfaßt die Gattung Anisochiton und Diarthrochiton
is t bei Pilsbry in den Acanthochitidae mit enthalten; auch sonst sind einzelne Sektionen an
anderer Stelle untergebracht als bei Pilsbry, so daß offenbar noch kein klarer Plan der Einteilung
zu Grunde liegt.
Pilsbrys System, das er im Laufe seinerBe arbeitung noch etwas verändert h a t, ist das folgende
(Man. Conch., v. 14 p. XXIV—XXVI):
I. Superfamilia Eoplacophora Genus Lepidopleurus
Familia Lepidopleuridae • Sectio Deshayesiella