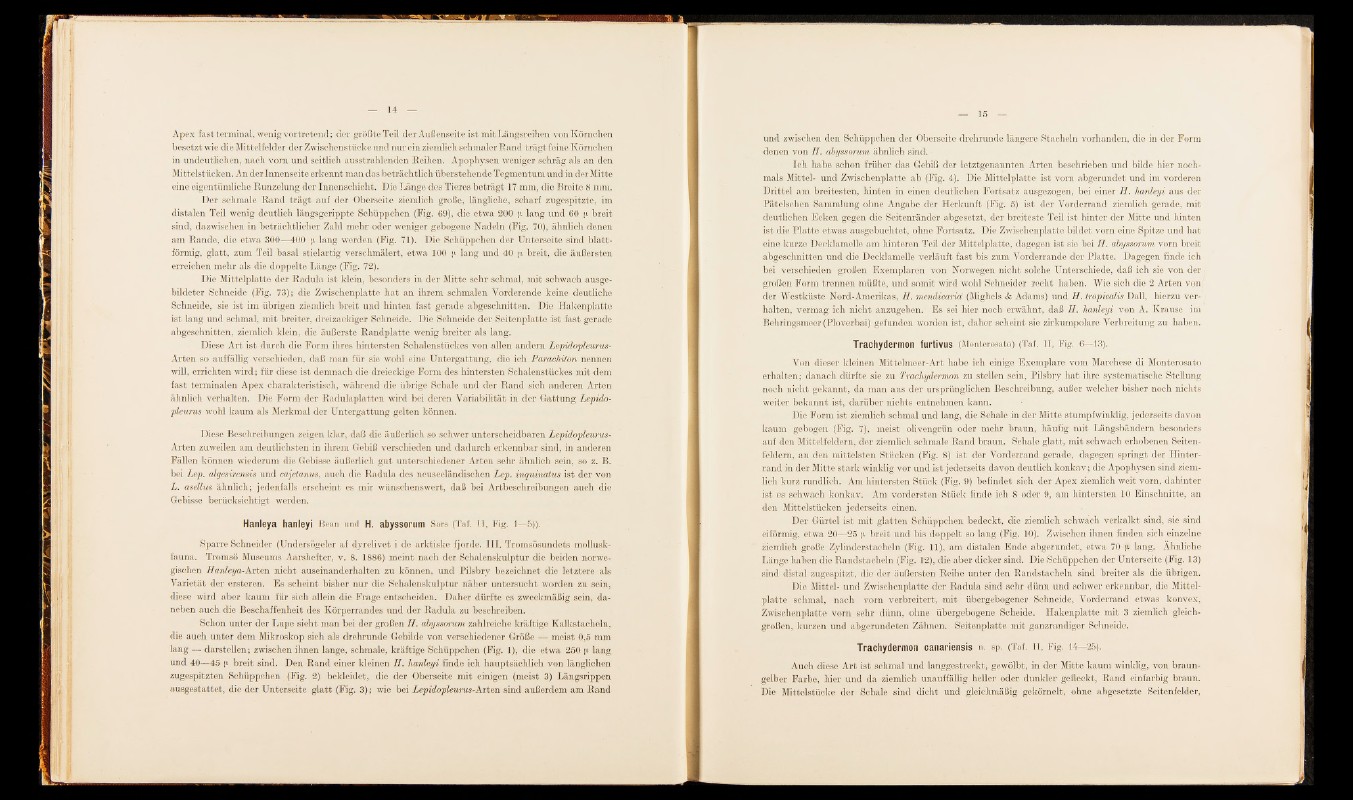
Apex fast terminal, wenig v o rtretend; der größte Teil der Außenseite is t m it Längsreihen von Körnchen
besetzt wie die Mittelfelder der Zwischenstücke und nur ein ziemlich schmaler Rand trä g t feine Körnchen
in undeutlichen, nach vom und seitlich ausstrahlenden Reihen. Apophysen weniger schräg als an den
Mittelstücken. An der Innenseite erkennt man das beträchtlich überstehende Tegmentum und in der Mitte
eine eigentümliche Runzelung der Innenschicht. Die Länge des Tieres b eträgt 17 mm, die Breite 8 mm.
Der schmale Rand trä g t auf der Oberseite ziemlich große, längliche, scharf zugespitzte, im
distalen Teil wenig deutlich längsgerippte Schüppchen (Fig. 69), die etwa 200 p lang und 60 |x breit
sind, dazwischen in beträchtlicher Zahl mehr oder weniger gebogene Nadeln (Fig. 70), ähnlich denen
am Rande, die etwa 300—400 ¡x lang werden (Fig. 71). Die Schüppchen der Unterseite sind b la ttförmig,
glatt, zum Teil basal stielartig verschmälert, etwa 100 |x lang und 40 |x breit, die äußersten
erreichen mehr als die doppelte Länge (Fig. 72).
Die Mittelplatte der Radula ist klein, besonders in der Mitte sehr schmal, mit schwach ausgebildeter
Schneide (Fig. 73); die Zwischenplatte h a t an ihrem schmalen Vorderende keine deutliche
Schneide, sie is t im übrigen ziemlich breit und hinten fa st gerade abgeschnitten. Die Hakenplatte
ist lang und schmal, mit breiter, dreizackiger Schneide. Die Schneide der Seitenplatte is t fast gerade
abgeschnitten, ziemlich klein, die äußerste Randplatte wenig breiter als lang.
Diese Art ist durch die Form ihres hintersten Schalenstückes von allen ändern Lepidopleurus-
Arten so auffällig verschieden, daß man für sie wohl eine Untergattung, die ich Parachiton nennen
will, errichten wird; für diese ist demnach die dreieckige Form des hintersten Schalenstückes mit dem
fast terminalen Apex charakteristisch, während die übrige Schale und der Rand sich anderen Arten
ähnlich verhalten. Die Form der Radulaplatten wird bei deren Variabilität in der Gattung Lepido-
pleurus wohl kaum als Merkmal der Untergattung gelten können.
Diese Beschreibungen zeigen klar, daß die äußerlich so schwer unterscheidbaren Lepidopleurus-
Arten zuweilen am deutlichsten in ihrem Gebiß verschieden und dadurch erkennbar sind, in anderen
Fällen können wiederum die Gebisse äußerlich g u t unterschiedener Arten sehr ähnlich sein, so z. B.
bei Lep. algesirensis und cajetanus, auch die Radula des neuseeländischen Lep. inquinatus is t der von
L. asdlus ähnlich; jedenfalls erscheint es mir wünschenswert, daß bei Artbeschreibungen auch die
Gebisse berücksichtigt werden.
Hanleya hanleyi Bean und H. abyssorum Sars (Taf. n , Fig. 1—5)).
Sparre Schneider (Undersögeler af dyrelivet i de arktiske fjorde. I I I . Tromsösundets mollusk-
fauna. Tromsö Museums Aarshefter, v. 8. 1886) meint nach der Schalenskulptur die beiden norwegischen
Hanleya-Äxten nicht auseinanderhalten zu können, und Pilsbry bezeichnet die letztere als
Varietät der ersteren. Es scheint bisher nur die Schalenskulptur näher untersucht worden zu sein,
diese wird aber kaum für sich allein die Frage entscheiden. Daher dürfte es zweckmäßig sein, d a neben
auch die Beschaffenheit des Körperrandes und der Radula zu beschreiben.
Schon unter der Lupe sieht man bei der großen H. abyssorum zahlreiche kräftige Kalkstacheln,
die auch unter dem Mikroskop sich als drehrunde Gebilde von verschiedener Größe — meist 0,5 mm
lang — darstellen; zwischen ihnen lange, schmale, kräftige Schüppchen (Fig. 1), die etwa 250 |x lang
und 40—45 |x breit sind. Den Rand einer kleinen H. hanleyi Hude ich hauptsächlich von länglichen
zugespitzten Schüppchen (Fig. 2 ) bekleidet, die der Oberseite mit einigen (meist 3) Längsrippen
ausgestattet, die der Unterseite gla tt (Fig. 3); wie bei Lepidopleurus-Arten sind außerdem am Rand
und zwischen den Schüppchen der Oberseite drehrunde längere Stacheln vorhanden, die in der Form
denen von H. abyssorum ähnlich sind.
Ich habe schon früher das Gebiß der letztgenannten Arten beschrieben und bilde hier nochmals
Mittel- und Zwischenplatte ab (Fig. 4). Die Mittelplatte ist vorn abgerundet und im vorderen
Drittel am breitesten, hinten in einen deutlichen Fortsatz ausgezogen, bei einer H. hanleyi aus der
Pätelschen Sammlung ohne Angabe der Herkunft (Fig. 5) ist der Vorderrand ziemlich gerade, mit
deutlichen Ecken gegen die Seitenränder abgesetzt, der breiteste Teil ist hinter der Mitte und hinten
ist die P la tte etwas ausgebuchtet, ohne Fortsatz. Die Zwischenplatte bildet vorn eine Spitze und h a t
eine kurze Decklamelle am hinteren Teil der Mittelplatte, dagegen ist sie bei H. abyssorum vorn breit
abgeschnitten und die Decklamelle verläuft fast bis zum Vorderrande der Platte. Dagegen finde ich
bei verschieden großen Exemplaren von Norwegen nicht solche Unterschiede, daß ich sie von der
großen Form trennen müßte, und somit wird wohl Schneider recht haben. Wie sich die 2 Arten von:
der Westküste Nord-Amerikas, H. mendicaria (Mighels & Adams) und H. tropicalis Dali, hierzu verhalten,
vermag ich nicht anzugeben. Es sei hier noch erwähnt, daß H. hanleyi von A. Krause im
Behringsmeer (Ploverbai) gefunden worden ist, daher scheint sie zirkumpolare Verbreitung zu haben.
Trachydermon furtivus (Monterosato) (Taf. II, Fig. :S—13).
Von dieser kleinen Mittelmeer-Art habe ich einige Exemplare vom Marchese di Monterosato
erhalten; danach dürfte sie zu Trachydermon zu stellen sein, Pilsbry h a t ihre systematische Stellung
noch nicht gekannt, da man aus der ursprünglichen Beschreibung, außer welcher bisher noch nichts
weiter bekannt ist, darüber nichts entnehmen kann.
Die Form ist ziemlich schmal und lang, die Schale in der Mitte stumpfwinklig, jederseits davon
kaum gebogen (Fig. 7), meist olivengrün oder mehr braun, häufig mit Längsbändern besonders
auf den Mittelfeldern, der ziemlich schmale Rand braun. Schale glatt, mit schwach erhobenen Seitenfeldern,
an den mittelsten Stücken (Fig. 8) ist der Vorderrand gerade, dagegen springt der Hinterrand
in d er M itte s tark winklig vor und ist jederseits d avon deutlich konkav; die Apophysen sind ziemlich
kurz rundlich. Am hintersten Stück (Fig. 9) befindet sich der Apex ziemlich weit vorn, dahinter
ist es schwach konkav. Am vordersten Stück finde ich 8 oder 9, am hintersten 10 Einschnitte, an
den Mittelstücken jederseits einen.
Der Gürtel is t mit glatten Schüppchen bedeckt, die ziemlich schwach verkalkt sind, sie sind
eiförmig, etwa 20—25 |x breit und bis doppelt so lang (Fig. 10). Zwischen ihnen finden sich einzelne
ziemlich große Zylinderstacheln (Fig. 11), am distalen Ende abgerundet, etwa 70 fx lang. Ähnliche
Länge haben die Randstacheln (Fig. 12), die aber dicker sind. Die Schüppchen der Unterseite (Fig. 13)
sind distal zugespitzt, die der äußersten Reihe unter den Randstacheln sind breiter als die übrigen.
Die Mittel- und Zwischenplatte der Radula sind sehr dünn und schwer erkennbar, die Mittelplatte
schmal, nach vorn verbreitert, mit übergebogener Schneide, Vorderrand etwas konvex,
Zwischenplatte vorn sehr dünn, ohne übergebogene Scheide. Hakenplatte mit 3 ziemlich gleichgroßen,
kurzen und abgerundeten Zähnen. Seitenplatte mit ganzrandiger Schneide.
Trachydermon canariensis n. sp. (Taf. II, Fig. 14—25).
Auch diese Art ist schmal und langgestreckt* gewölbt, in der Mitte kaum winklig, von braungelber
Farbe, hier und da ziemlich unauffällig heller oder dunkler gefleckt, Rand einfarbig braun.
Die Mittelstücke der Schale sind dicht und gleichmäßig gekörnelt, ohne abgesetzte Seitenfelder,