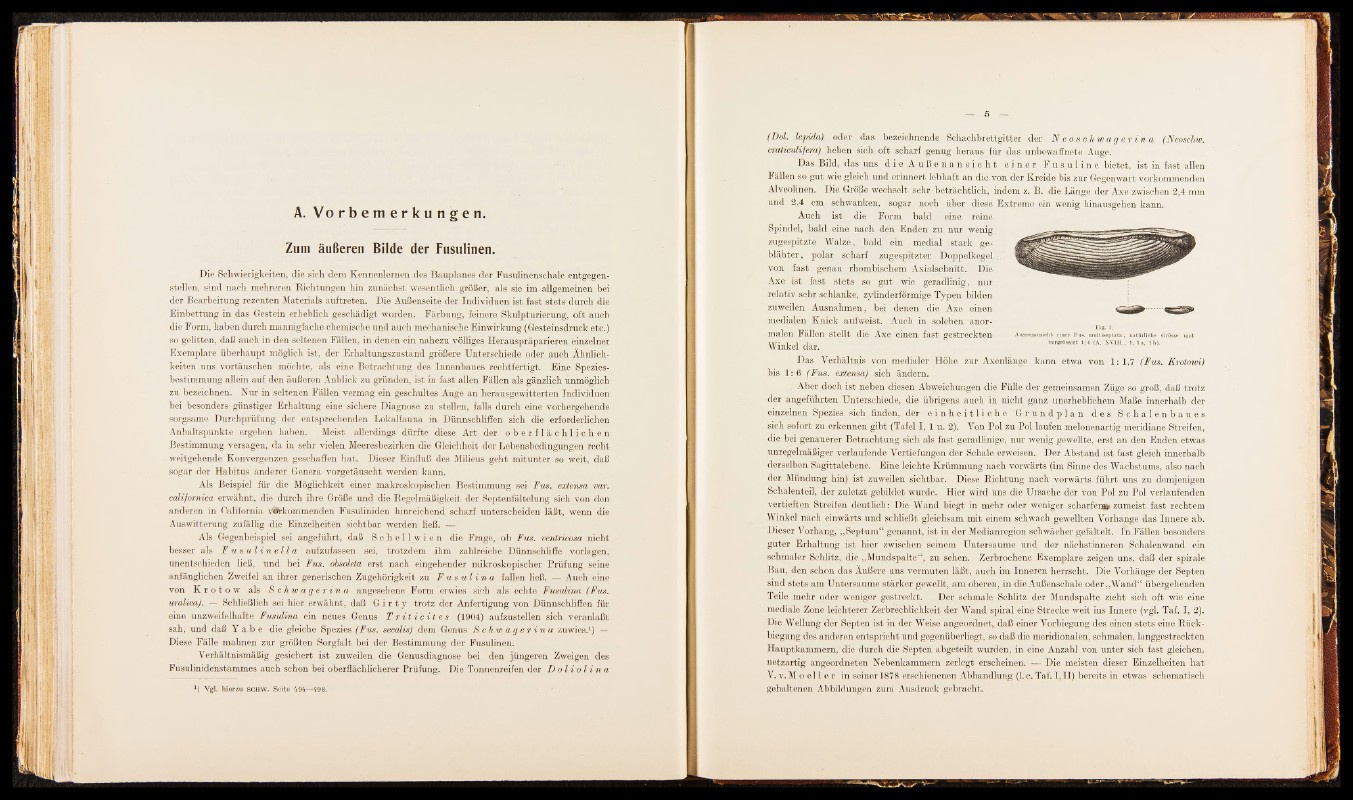
A. V o r b e m e r k u n g e n .
Zum äußeren Bilde der Fusulinen.
Die Schwierigkeiten, die sich dem Kennenlernen des Bauplanes der Fusulinenschale entgegenstellen,
sind nach mehreren Richtungen hin zunächst wesentlich größer, als sie im allgemeinen bei
der Bearbeitung rezenten Materials auftreten. Die Außenseite der Individuen is t fast stets durch die
Einbettung in das Gestein erheblich geschädigt worden. Färbung, feinere Skulpturierung, oft auch
die Form, haben durch mannigfache chemische u nd auch mechanische Einwirkung (Gesteinsdrnck etc.)
so gelitten, daß auch in den seltenen Fällen, in denen ein nahezu völliges Herauspräparieren einzelner
Exemplare überhaupt möglich ist, der Erhaltungszustand größere Unterschiede oder auch Ähnlichkeiten
uns vortäuschen möchte, als eine Betrachtung des Innenbaues rechtfertigt. Eine Speziesbestimmung
allein auf den äußeren Anblick zu gründen, is t in fast allen Fällen als gänzlich unmöglich
zu bezeichnen. Nur in seltenen Fällen vermag ein geschultes Auge an herausgewitterten Individuen
bei besonders günstiger Erhaltung eine sichere Diagnose zu stellen, falls durch eine vorhergehende
sorgsame Durchprüfung der entsprechenden Lokalfauna in Dünnschliffen sich die erforderlichen
Anhaltspunkte ergeben haben. Meist allerdings dürfte diese Art der o b e r f l ä c h l i c h e n
Bestimmung versagen, da in sehr vielen Meeresbezirken die Gleichheit der Lebensbedingungen recht
weitgehende Konvergenzen geschaffen hat. Dieser Einfluß des Milieus geht mitunter so weit, daß
sogar der Habitus anderer Genera vorgetäuscht werden kann.
Als Beispiel für die Möglichkeit einer makroskopischen Bestimmung sei Fus. extensa var.
californica erwähnt, die durch ihre Größe und die Regelmäßigkeit der Septenfältelung sich von den
anderen in California verkommenden Fusuliniden hinreichend scharf unterscheiden läßt, wenn die
Auswitterung zufällig die Einzelheiten sichtbar werden ließ. —
Als Gegenbeispiel sei angeführt, daß S c h e l l w i e n die Frage, ob Fus. ventricosa nicht
besser als F u s u l i n e i l a aufzufassen sei, trotzdem ihm zahlreiche Dünnschliffe Vorlagen,
unentschieden ließ, und bei Fus. obsoleta erst nach eingehender mikroskopischer Prüfung seine
anfänglichen Zweifel an ihrer generischen Zugehörigkeit zu F u s u l i n a fallen ließ. — Auch eine
von K r o t o w als S c h w a g e r i n a angesehene Form erwies sich als echte Fusulina (Fus.
uralica). — Schließlich sei hier erwähnt, daß G i r t y trotz der Anfertigung von Dünnschliffen für
eine unzweifelhafte Fusulina ein neues Genus T r i t i c i t e s (1904) aufzustellen sich veranlaßt
sah, und daß Y a b e die gleiche Spezies (Fus. secalis) dem Genus S c h w a g e r i n a zuwies.1) fefe
Diese Fälle mahnen zur größten Sorgfalt bei der Bestimmung der Fusulinen.
Verhältnismäßig gesichert is t zuweilen die Genusdiagnose bei den jüngeren Zweigen des
Fusulinidenstammes auch schon bei oberflächlicherer Prüfung. Die Tonnenreifen der D o l i o l i n a
x) Vgl. hierzu SCHW. Seite 494—498.
— 5 p | g j p
(Dol. lepida) oder das bezeichnende Schachbrettgitter der N e o s c h w a g e r i n a (Neoschw.
craticulifera) heben sich oft scharf genug heraus für das unbewaffnete Auge.
Das Bild, das uns d i e A u ß e n a n s i c h t e i n e r F u s u l i n e bietet, ist in fast allen
Fällen so gut wie gleich und erinnert lebhaft an die von der Kreide bis zur Gegenwart vorkommenden
Alveolinen. Die Größe wechselt sehr beträchtlich, indem z. B. die Länge der Axe zwischen 2,4 mm
und 2,4 cm schwanken, sogar noch über diese Extreme ein wenig hinausgehen kann.
Auch is t die Form bald eine reine
Spindel, bald eine nach den Enden zu nur wenig
zugespitzte Walze, bald ein medial s tark geblähter
, polar scharf zugespitzter Doppelkegel
von fa st genau rhombischem Axialschnitt. Die-
Axe ist fast stets so g u t wie geradlinig, nur
relativ sehr schlanke, zylinderförmige Typen bilden
zuweilen Ausnahmen, bei denen die Axe einen -----
medialen Knick auf weist. Auch in solchen anor- j
malen Fällen stellt die Axe einen fast gestreckten Aussenansicht einer Fus. multiseptata, natürliche Grösse und
h t - i - i - i vergrössert 1:6 (A. XVIIL, l, la , lb ). Winkel dar.
Das Verhältnis von medialer Höhe zur Axenlänge kann etwa von 1: 1,7 (Fus. Krotowi)
bis 1 :6 (Fus. extensa) sich ändern.
Aber doch ist neben diesen Abweichungen die Fülle der gemeinsamen Züge so groß, daß trotz
der angeführten Unterschiede, die übrigens auch in nicht ganz unerheblichem Maße innerhalb der
einzelnen Spezies sich finden, der e i n h e i t l i c h e G r u n d p l a n d e s S c h a l e n b a u e s
sich sofort zu erkennen gibt (Tafel I, 1 u. 2). Von Pol zu Pol laufen melonenartig meridiane Streifen,
die bei genauerer Betrachtung sich als fast geradlinige, nur wenig gewellte, erst an den Enden etwas
unregelmäßiger verlaufende Vertiefungen der Schale erweisen. Der Abstand ist fast gleich innerhalb
derselben Sagittalebene. Eine leichte Krümmung nach vorwärts (im Sinne des Wachstums, also nach
der Mündung hin) ist zuweilen sichtbar. Diese Richtung nach vorwärts führt uns zu demjenigen
Schalenteil, der zuletzt gebildet wurde. Hier wird uns die Ursache der von Pol zu Pol verlaufenden
vertieften Streifen deutlich: Die Wand biegt in mehr oder weniger scharfem^ zumeist fast rechtem
Winkel nach einwärts und schließt gleichsam mit einem schwach gewellten Vorhänge das Innere ab.
Dieser Vorhang, „Septum“ genannt, is t in der Medianregion schwächer gefältelt. In Fällen besonders
guter Erhaltung ist hier zwischen seinem Untersaume und der nächstinneren Schalenwand ein
schmaler Schlitz, die „Mundspalte“ , zu sehen. Zerbrochene Exemplare zeigen uns, daß der spirale
Bau, den schon das Äußere uns vermuten läßt, auch im Inneren herrscht. Die Vorhänge der Septen
sind stets am Untersaume stärker gewellt, am oberen, in die Außenschale oder „Wand“ übergehenden
Teile mehr oder weniger gestreckt. Der schmale Schlitz der Mundspalte zieht sich oft wie eine
mediale Zone leichterer Zerbrechlichkeit der Wand spiral eine Strecke weit ins Innere (vgl. Taf. I, 2).
Die Wellung der Septen ist in der Weise angeordnet, daß einer Vorbiegung des einen stets eine Rückbiegung
des anderen entspricht und gegenüberliegt, so daß die meridionalen, schmalen, langgestreckten
Hauptkammern, die durch die Septen abgeteilt wurden, in eine Anzahl von unter sich fast gleichen,
netzartig angeordneten Nebenkammern zerlegt erscheinen,^!-- Die meisten dieser Einzelheiten h a t
V. v. M o e l 1 e r in seiner 1878 erschienenen Abhandlung (1. c. Taf. I, II) bereits in etwas schematisch
gehaltenen Abbildungen zum Ausdruck gebracht.