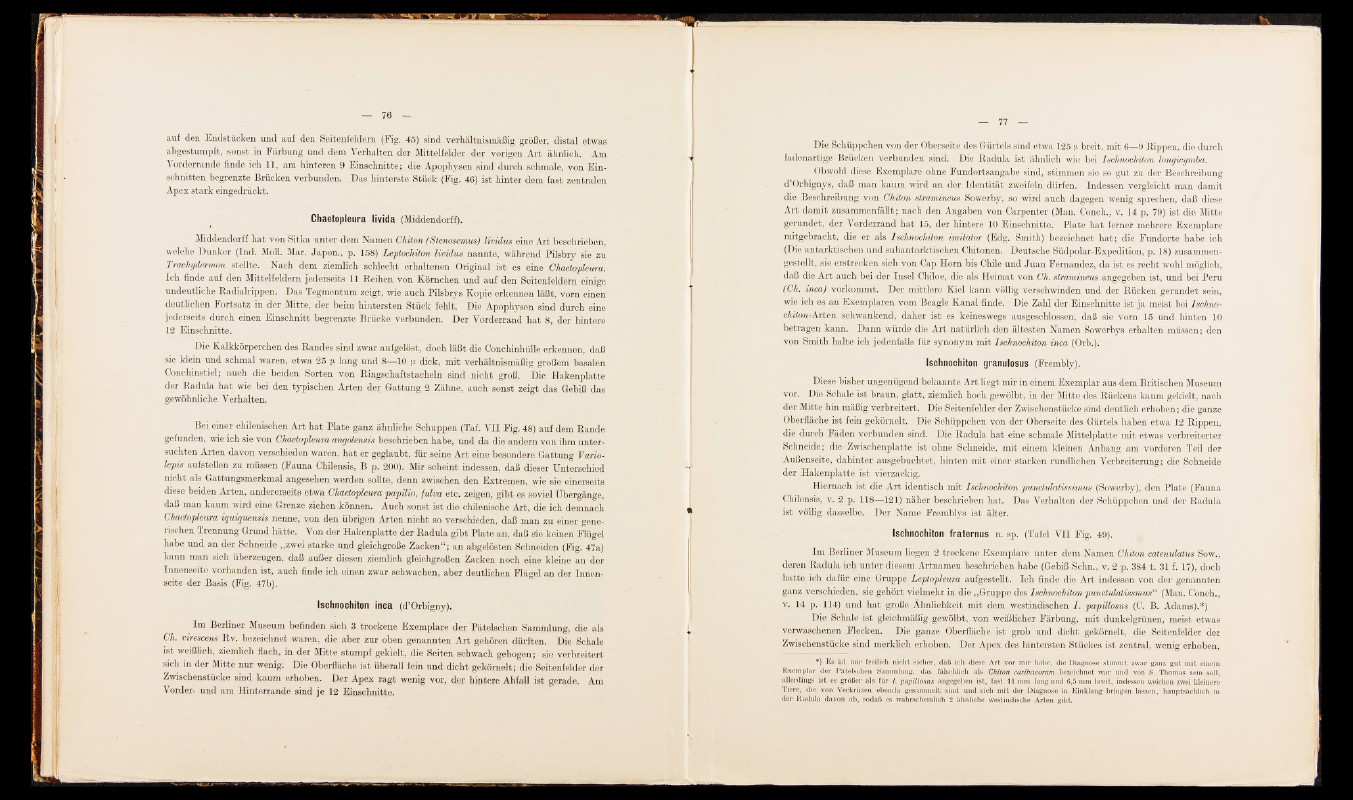
auf den Endstücken und auf den Seitenfeldern (Fig. 45) sind verhältnismäßig größer, distal etwas
abgestumpft, sonst i n Färbung und dem Verhalten der Mittelfelder der vorigen Art ähnlich Am
Vorderrande finde ich 11, am hinteren 9 Einschnitte; die Apophysen sind durch schmale, von Einschnitten
begrenzte Brücken verbunden. Das hinterste Stück (Fig. 46) ist hinter dem fast zentralen
Apex s tark eingedrückt.
Chaetopleura livida (Middendorff).
Middendorff h a t von Sitka unter dem Namen Chiton (Stenosemus) lividus eine A rt beschrieben,
welche Dunker (Ind. Moll. Mar. Japon., p. 158) Leptochiton lividus nannte, während Pilsbry sie zu
Trachydermon stellte. Nach dem ziemlich schlecht erhaltenen Original ist es eine Chaetopleura.
Ich finde auf den Mittelfeldern jederseits 11 Reihen von Körnchen nnd auf den Seitenfeldem einige
undeutliche Radialrippen. Das Tegmentum zeigt, wie auch Pilshrys Kopie erkennen läßt, vorn einen
deutlichen Fortsatz in der Mitte, def hejm hintersten Stück fe h lt.''D ie Apophysen sind durch eine
jederseits durch einen Einschnitt begrenzte Brücke verbunden. Der Vorderrand h a t 8, der hintere
12 Einschnitte.
Die Kalkkörperchen des Randes sind zwar aufgelöst, doch läß t die Conchinhülle erkennen, daß
sie klein und schmal waren, etwa 25 p lang und 8— 10 p dick, mit verhältnismäßig großem basalen
Conchinstiel; auch die beiden Sorten von Ringschaftstacheln sind nicht groß. Die Hakenplaijk
der Radula h a t wie hei den typischen Arten der Gattung 2 Zähne, auch sonst zeigt das Gehiß das
gewöhnliche Verhalten.
Bei einer chilenischen Art h a t Plate ganz ähnliche Schuppen (Taf. VII Fig. 48) auf dem R ande
gefunden, wie ich sie von Chaetopleura angolensis beschrieben habe, und da die ändern von ihm u ntersuchten
Arten davon verschieden waren, h a t er geglaubt, für seine Art eine besondere Gattung Vario-
lepis aufstellen zu müssen (Fauna Chilensis, B p. 200). Mir scheint indessen, daß dieser Unterschied
nicht als Gattungsmerkmal angesehen werden sollte, denn zwischen den Extremen, wie sie einerseits
diese beiden Arten, andererseits etwa Chaetopleura papüio, fulva etc. zeigen, gibt es soviel Übergänge,
daß man kaum wird eine Grenze ziehen können. Auch sonst is t die chilenische Art, die ich demnach
Chaetopleura iquiquensis nenne, von den übrigen Arten nicht so verschieden, daß man zu einer generischen
Trennung Grund hätte. Von der Hakenplatte der Radula gibt Plate an, daß sie keinen Flügel
habe und an der Schneide „zwei starke und gleichgroße Zacken“ ; an abgelösten Schneiden (Fig. 47a)
kann man sich überzeugen, daß außer diesen ziemlich gleichgroßen Zacken noch eine kleine an der
Innenseite vorhanden ist, auch finde ich einen zwar schwachen, aber deutlichen Flügel an der Innenseite
der Basis (Fig. 47b).
Ischnochiton inca (d’Orbigny).
Im Berliner Museum befinden sich 3 trockene Exemplare der Pätelschen Sammlung, die als
Ch. virescens Rv. bezeichnet waren, die aber zur oben genannten Art gehören dürften. Die Schale
is t weißlich, ziemlich flach, in der Mitte stumpf gekielt, die Seiten schwach gebogen; sie verbreitert
sich in der Mitte nur wenig. Die Oberfläche ist überall fein und dicht gekörnelt; die Seitenfelder der
Zwischenstücke sind kaum erhoben. Der Apex rag t wenig vor, der hintere Abfall ist gerade. Am
Vorder- und am Hinterrande sind je 12 Einschnitte.
Die Schüppchen von der Oberseite des Gürtels sind etwa 125 |x breit, mit 6—9 Rippen, die durch
fadenartige Brücken verbunden sind. Die Radula ist ähnlich wie bei Ischnochiton longicymba.
Obwohl diese Exemplare ohne Fundortsangabe sind, stimmen sie so gut zu der Beschreibung
d’Orbignys, daß man kaum wird an der Id e n titä t zweifeln dürfen. Indessen vergleicht man damit
die Beschreibung von Chiton stramineus Sowerby, so wird auch dagegen wenig sprechen, daß diese
Art damit zusammenfällt; nach den Angaben von Carpenter (Man. Conch., v. 14 p . 79) ist die Mitte
gerundet, der Vorderrand h a t 15, der hintere 10 Einschnitte. Plate h a t ferner mehrere Exemplare
mitgebracht, die er als Ischnochiton imitator (Edg. Smith) bezeichnet h a t; die Fundorte habe ich
(Die antarktischen und subantarktischen Chitonen. Deutsche Südpolar-Expedition, p. 18) zusammengestellt,
sie erstrecken sich von Cap Horn bis Chile und Ju an Fernandez, da ist es recht wohl möglich,
daß die A rt auch bei der Insel Chiloe, die als Heimat von Ch. stramineus angegeben ist, und bei Peru
(Ch. inca) vorkommt. Der mittlere Kiel kann völlig verschwinden und der Rücken gerundet sein,
wie ich es an Exemplaren vom Beagle Kanal finde. Die Zahl der Einschnitte ist ja meist bei Ischno-
chiton-Aiten schwankend, daher ist es keineswegs ausgeschlossen, daß sie vorn 15 und hinten 10
betragen kann. Dann würde die Art natürlich den ältesten Namen Sowerbys erhalten müssen; den
von Smith halte ich jedenfalls für synonym mit Ischnochiton inca (Orb.).
Ischnochiton granulosus (Frembly).
Diese bisher ungenügend bekannte Art liegt m ir in einem Exemplar aus dem Britischen Museum
vor. Die Schale ist braun, glatt, ziemlich hoch gewölbt, in der Mitte des Rückens kaum gekielt, nach
der Mitte h in mäßig verbreitert. Die Seitenfelder der Zwischenstücke sind d eutlich erhoben; die ganze
Oberfläche ist fein gekörnelt. Die Schüppchen von der Oberseite des Gürtels haben etwa 12 Rippen,
die durch Fäden verbunden sind. Die Radula h a t eine schmale Mittelplatte mit etwas verbreiterter
Schneide; die • Zwischenplatte ist ohne Schneide, mit einem kleinen Anhang am vorderen Teil der
Außenseite, dahinter ausgebuchtet, hinten mit einer starken rundlichen Verbreiterung; die Schneide
der Hakenplatte is t vierzackig.
Hiernach ist die Art identisch mit Ischnochiton punctidatissimus (Sowerby), den Plate (Fauna
Chilensis, v. 2 p. 118—121) näher beschrieben hat. Das Verhalten der Schüppchen und der Radula
ist völlig dasselbe. Der Name Fremblys ist älter.
Ischnochiton fraternus n. sp. (Tafel VII Fig. 49).
Im Berliner Museum liegen 2 trockene Exemplare unter dein Namen Chiton catenulatus Sow.,
deren Radula ich unter diesem Artnamen beschrieben habe (Gebiß Schn., v. 2 p. 384 t. 31 f. 17), doch
h a tte ich dafür eine Gruppe Leptopleura aufgestellt. Ich finde die Art indessen von der genannten
ganz verschieden, sie gehört vielmehr in die „Gruppe des Ischnochiton punctulatissmus“ (Man. Conch.,
v. 14 p. 114) und h a t große Ähnlichkeit mit dem westindischen I . papiUosus (C. B. Adams).*)
Die Schale ist gleichmäßig gewölbt, von weißlicher Färbung, mit dunkelgrünen, meist etwas
verwaschenen Flecken. Die ganze Oberfläche ist grob und dicht gekörnelt, die Seitenfelder der
Zwischenstücke sind merklich erhoben. Der Apex des hintersten Stückes ist zentral, wenig erhoben,
*) Es ist mir freilich nicht sicher, daß ich diese Art vor mir habe, die Diagnose stimmt zwar ganz gut mit einem
Exemplar der Pätelschen Sammlung, das fälschlich als Chiton caribaeorum bezeichnet war und von S. Thomas sein soll,
allerdings ist es größer als für I. papillosus angegeben ist, fast 11 mm lang und 6,5 mm breit, indessen weichen zwei kleinere
Tiere, die von Verkrüzen ebenda gesammelt sind und sich mit der Diagnose in Einklang bringen lassen, hauptsächlich in
der Radula davon ab, sodaß es wahrscheinlich 2 ähnliche Westindische Arten gibt.