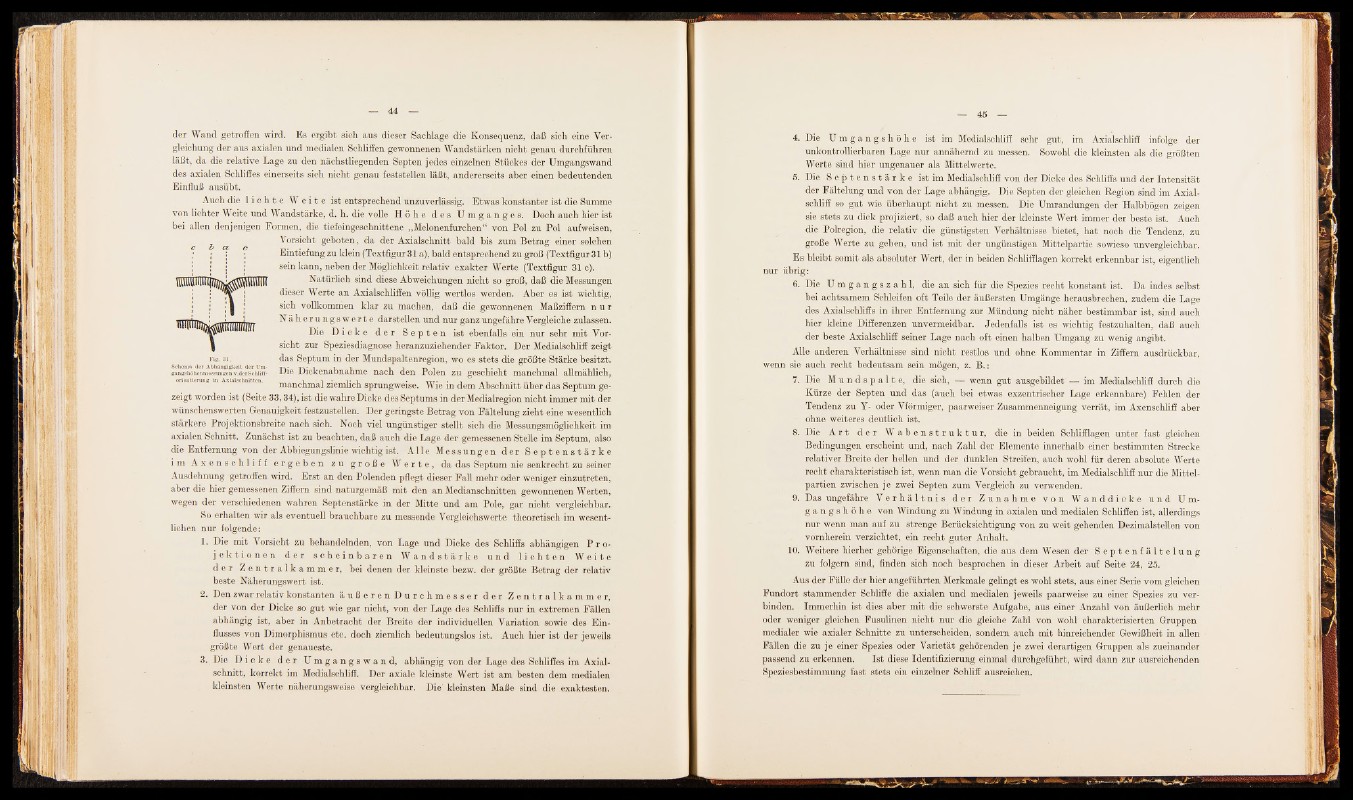
der Wand getroffen wird. Es ergibt sieb aus dieser Sachlage die Konsequenz, daß sich eine Vergleichung
der aus axialen und medialen Schliffen gewonnenen Wandstärken nicht genau durchführen
läßt, da die relative Lage zu den nächsthegenden Septen jedes einzelnen Stückes der Umgangswand
des axialen Schliffes einerseits sich nicht genau feststellen läßt, andererseits aber einen bedeutenden
Einfluß ausübt.
Auch die l i c h t e W e i t e is t entsprechend unzuverlässig. Etwas konstanter is t die Summe
von lichter Weite und Wandstärke, d. h. die volle H ö h e d e s U m g a n g e s . Doch auch hier ist
bei allen denjenigen Formen, die tiefeingeschnittene „Melonenfurchen“ von Pol zu Pol aufweisen,
Vorsicht geboten, da der Axialschnitt bald bis zum Betrag einer solchen
Eintiefung zu klein (Textfigur 31 a), bald entsprechend zu groß (Textfigur 31 b)
sein kann, neben der Möglichkeit relativ exakter Werte (Textfigur 31 c).
Natürlich sind diese Abweichungen nicht so groß, daß die Messungen
dieser Werte an Axialschliffen völlig wertlos werden. Aber es is t wichtig,
sich vollkommen klar zu machen, daß die gewonnenen Maßziffern n u r
N ä h e r u n g s w e r t e darstellen und n ur ganz ungefähre Vergleiche zulassen.
Die D i c k e d e r S e p t e n is t ebenfalls ein nur sehr mit Vorsicht
zur Speziesdiagnose heranzuziehender Faktor. Der Medialschliff zeigt
das Septum in der Mundspaltenregion, wo es stets die größte Stärke besitzt.
Die Dickenabnahme nach den Polen zu geschieht manchmal allmählich,
manchmal ziemlich sprungweise. Wie in dem A bschnitt über das Septum gezeigt
c b a, c
gangshöhentnessungen v.derSchliff-
worden is t (Seite 33,34), is t die wahre Dicke des Septums in der Medialregion n icht immer mit, der
wünschenswerten Genauigkeit festzustellen. Der geringste Betrag von Fältelung zieht eine wesentlich
stärkere Projektionsbreite nach sich. Noch viel ungünstiger stellt sich die Messungsmöglichkeit im
axialen Schnitt. Zunächst is t zu beachten, daß auch die Lage der gemessenen Stelle im Septum, also
die Entfernung von der Abbiegungslinie wichtig ist. Al l e M es s u n g e n d e r S e p t e n s t ä r k e
i m A x e n s c h l i f f e r g e b e n z u g r o ß e W e r t e , da das Septum nie senkrecht zu seiner
Ausdehnung getroffen wird. E rst an den Polenden pflegt dieser Fall mehr oder weniger einzutreten,
aber die hier gemessenen Ziffern sind naturgemäß mit den an Medianschnitten gewonnenen Werten,
wegen der verschiedenen wahren Septenstärke in der Mitte und am Pole, gar nicht vergleichbar.
So erhalten wir als eventuell brauchbare zu messende Vergleichswerte theoretisch im wesentlichen
nur folgende:
1. Die mit Vorsicht zu behandelnden, von Lage und Dicke des Schliffs abhängigen P r o j
e k t i o n e n d e r s c h e i n b a r e n W a n d s t ä r k e u n d l i c h t e n W e i t e
d e r Z e n t r a l k a m m e r , bei denen der kleinste bezw. der größte Betrag der relativ
beste Näherungswert ist.
2. Den zwar relativ konstanten ä u ß e r e n D u r c h m e s s e r d e r Z e n t r a l k a m m e r ,
der von der Dicke so gut wie gar nicht, von der Lage des Schliffs nur in extremen Fällen
abhängig ist, aber in Anbetracht der Breite der individuellen Variation sowie des Einflusses
von Dimorphismus etc. doch ziemlich bedeutungslos ist. Auch hier ist der jeweils
größte Wert der genaueste.
3. Die D i c k e d e r U m g a n g s w a n d , abhängig von der Lage des Schliffes im Axialschnitt,
korrekt im Medialschliff. Der axiale kleinste Wert ist am besten dem medialen
kleinsten Werte näherungsweise vergleichbar. Die' kleinsten Maße sind die exaktesten.
4. Die U m g a n g s h ö h e ist im Medialschliff sehr gut, im Axialschliff infolge der
unkontrollierbaren Lage nur annähernd zu messen. Sowohl die kleinsten als die größten
Werte sind hier ungenauer als Mittelwerte.
5. Die S e p t e n s t ä r k e ist im Medialschliff von der Dicke des Schliffs und der Intensitä t
der Fältelung und von der Lage abhängig. Die Septen der gleichen Region sind im Axialschliff
so gut wie überhaupt nicht zu messen. Die Umrandungen der Halbbögen zeigen
sie stets zu dick projiziert, so daß auch hier der kleinste Wert immer der beste ist. Auch
die Polregion, die relativ die günstigsten Verhältnisse bietet, h a t noch die Tendenz, zu
große Werte zu geben, und ist mit der ungünstigen Mittelpartie sowieso unvergleichbar.
Es bleibt somit als absoluter Wert, der in beiden Schliff lagen korrekt erkennbar ist, eigentlich
nur übrig:
6. Die U m g a n g s z a h l , die an sich für die Spezies recht konstant ist. Da indes selbst
bei achtsamem Schleifen oft Teile der äußersten Umgänge herausbrechen, zudem die Lage
des Axialschliffs in ihrer Entfernung zur Mündung nicht näher bestimmbar ist, sind auch
hier kleine Differenzen unvermeidbar. Jedenfalls ist es wichtig festzuhalten, daß auch
der beste Axialschliff seiner Lage nach oft einen halben Umgang zu wenig angibt.
Alle anderen Verhältnisse sind nicht restlos und ohne Kommentar in Ziffern ausdrückbar,
wenn sie auch recht bedeutsam sein mögen, z. B.:
7. Die M u n d s p a l t e , die sich, wenn gut ausgebildet" — im Medialschliff durch die
Kürze der Septen und das (auch bei etwas exzentrischer Lage erkennbare) Fehlen der
Tendenz zu Y- oder Vförmiger, paarweiser Zusammenneigung verrät, im Axenschliff aber
ohne weiteres deutlich ist.
8. Die A r t d e r W a b e n s t r u k t u r , die in beiden Schlifflagen unter fast gleichen
Bedingungen erscheint und, nach Zahl der Elemente innerhalb einer bestimmten Strecke
relativer Breite der hellen und der dunklen Streifen, auch wohl für deren absolute Werte
recht charakteristisch ist, wenn man die Vorsicht gebraucht, im Medialschliff nur die Mittelpartien
zwischen je zwei Septen zum Vergleich zu verwenden.
9. Das ungefähre V e r h ä l t n i s d e r Z u n a h m e v o n W a n d d i c k e u n d U m g
a n g s h ö h e von Windung zu Windung in axialen und medialen Schliffen ist, allerdings
nur wenn man auf zu strenge Berücksichtigung von zu weit gehenden Dezimalstellen von
vornherein verzichtet, ein recht guter Anhalt.
10. Weitere hierher gehörige Eigenschaften, die aus dem Wesen der S e p t e n f ä l t e l u n g
zu folgern sind, finden sich noch besprochen in dieser Arbeit auf Seite 24, 25.
Aus der Fülle der hier angeführten Merkmale gelingt es wohl stets, aus einer Serie vom gleichen
Fundort stammender Schliffe die axialen und medialen jeweils paarweise zu einer Spezies zu verbinden.
Immerhin ist dies aber mit die schwerste Aufgabe, aus einer Anzahl von äußerlich mehr
oder weniger gleichen Fusulinen nicht nur die gleiche Zahl von wohl charakterisierten Gruppen
medialer wie axialer Schnitte zu unterscheiden, sondern auch mit hinreichender Gewißheit in allen
Fällen die zu je einer Spezies oder Varietät gehörenden je zwei derartigen Gruppen als zueinander
passend zu erkennen. Is t diese Identifizierung einmal durchgeführt, wird dann zur ausreichenden
Speziesbestimmung fast stets ein einzelner Schliff ausreichen.