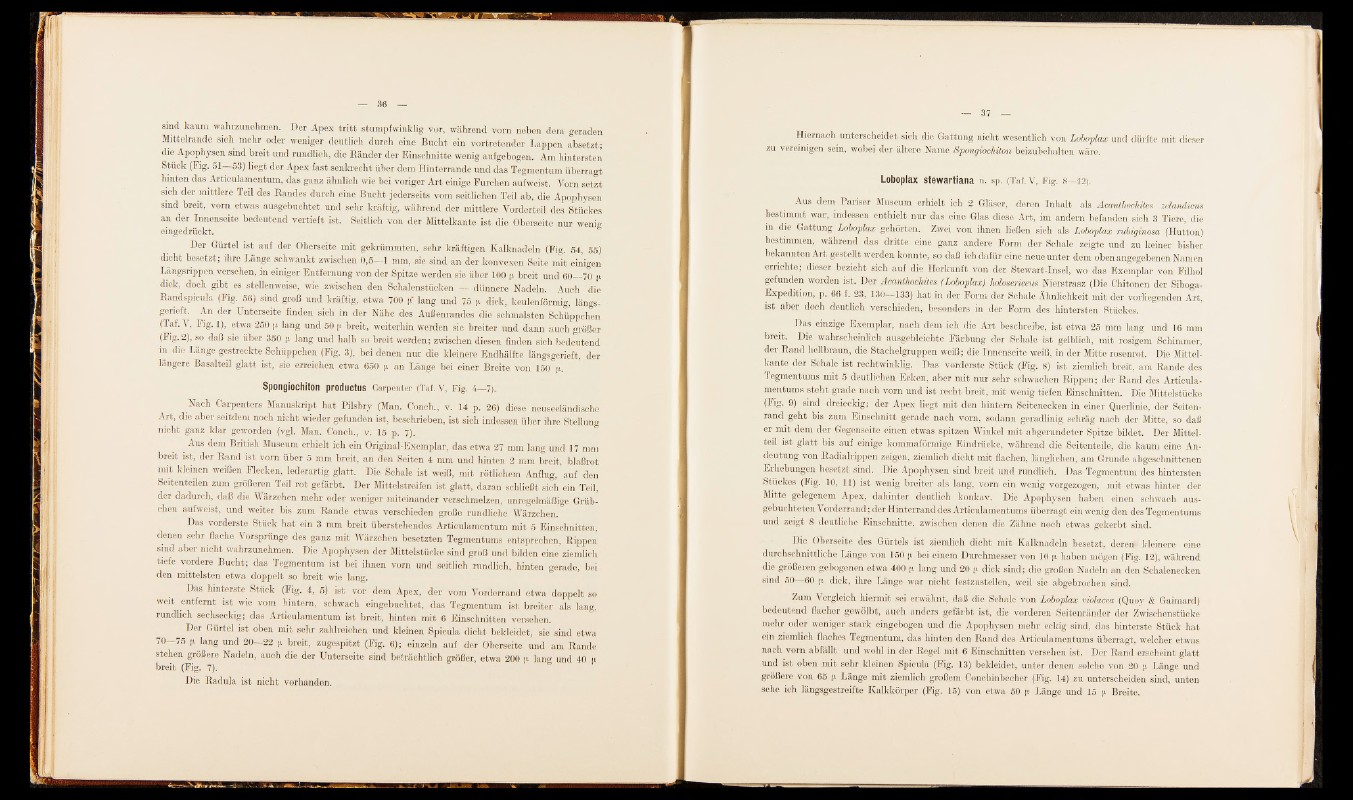
sind kaum wahrzunehmen. Der Apex tr i t t stumpfwinklig vor, während vorn neben dem geraden
Mittelrande sieh mehr oder weniger deutlich durch eine B u ch t'e in .v o rtre ten d e r Lappen absetzt;
die Apophysen sind breit und rundlich, die Ränder der Einschnitte wenig aufgebogen. Am hintersten
Stück (Fig. 51—53) liegt der Apex fast senkrecht über dem Hinterrande u nd das Tegmentum überragt
hinten das Articulamentum, das ganz ähnlich, wie bei voriger Art einige Furchen aufweist. Vorn setzt
sich der mattiere Teil des Randes durch eine Bucht jederseits vom seitlichen Teil ab, die Apophysen
sind breit, vorn etwas ausgebuchtet un d sehr kräftig, während der mittlere Vorderteil desjStückes
an der Innenseite bedeutend vertieft ist. Seitlich von der Mittelkante is t die Oberseite nur wenig
eingedrückt.
Der Gürtel ist auf des. Oberseite mit gekrümmten, sehr kräftigen Kalknadeln (Fig. 54, 55)
dicht besetzt; ihre Länge schwankt zwischen 0,5—1 mm, sie sind an der konvexen Seite mit einigen
Langsnppen versehen,'in einiger Entfernung von der Spitze werden sie über 100 |t breit und 60—70 p
dick, doch gibt es stellenweise, wie zwischen den Schalenstücken I - dünnere Nadeln. Auch die
Randspioula (Fig. 56) sind groß und kräftig, etwa 700 p" lang und 75 p dick, keulenförmig, längs-
gerieft. An der Unterseite finden sich in der Nähe des Außenrandes'die schmälsten Schüppchen
(Taf. V, Fig. 1), etwa 250 p lang und 50 p breit, weiterhin werden sie breiter und dann auch größer
(Fig.2), so daß sie über 350 p lang und halb so breit werden; zwischen diesen finden sich bedeutend
m die Länge gestreckte Schüppchen (Fig. 3), bei denen nur die Heinere Endhälfte längsgerieft, der
längere Basalteil g la tt ist, sie erreichen etwa 650 p an Länge bei einer Breite von 150 p. ■ '
Spongiochiton productUS Carpenter (Taf. V, Fig. 4® ) .
Nach Carpenters Manuskript h a t Pilsbry (Man. Couch., v. 14 p. 26) diese neuseeländische
Art, die aber seitdem noch nicht wieder gefunden ist, beschrieben, ist sich indessen über ihre Stellung
nicht ganz klar geworden (vgl. Man. Conch., v. 15 p. 7).
Aus dem British Museum erhielt ich ein Original-Exemplar, das etwa 27 mm lang und 17 mni:
breit ist, der Rand ist vom über 5 mm breit, a n den Beiten 4 mm und hinten 2 mm breit, blaßrot
mit Heinen weißen Flecken, lederartig glatt. Die Schale is t weiß, mit rötlichem Anflug, auf den
Seitenteilen zum größeren Teil ro t gefärbt. Der Mittelstreifen ist glatt, daran schließt sich ein Teil,
der dadurch, daß die Wärzchen mehr oder weniger miteinander verschmelzen, unregelmäßige Grübchen
aufweist, und weiter'bis zum Rande etwas verschieden große rundliche Wärzchen.
Das vorderste Stück h a t ein 3 mm bre it überstehendes Articulamentum mit 5 Einschnitten,
denen sehr flache Vorsprünge des ganz mit Wärzchen besetzten Tegmentums entsprechen, Rippen
sind aber nicht wahrzunehmen. Die Apophysen der Mittelstücke sind groß und bilden eine ziemlich
tiefe vordere Bucht; das Tegmentum is t bei ihnen vorn und seitlich rundlich, hinten gerade, bei
den mittelsten etwa doppelt so bre it wie lang.
Das hinterste Stück (Fig. 4, 5) ist vor dem Apex, der vom Vorderrand etwa doppelt so
weit entfernt is t wie vom hintern, schwach eingebuchtet, das Tegmentum is t breiter als lang,
rundlich sechseckig; das Articulamentum ist breit, hinten m it 6 Einschnitten versehen.
Der Gürtel is t oben mit sehr zahlreichen und kleinen Spicula dicht beHeidet, sie sind etwa
70—75 p lang und 20—22 p breit, zugespitzt (Fig. 6); einzeln auf der Oberseite imd am Rande
stehen größere Nadeln, auch die der Unterseite sind beträchtlich größer, etwa 200 p lang und 40 p
b reit (Fig. 7).
Die Radula is t nickt vorhanden.
Hiernach unterscheidet sich die Gattung nicht wesentlich von Loboplax und dürfte mit dieser
zu vereinigen sein, wobei der ältere Name SpongweMton beizubehalten wäre.
Loboplax stewartiana n.’% , (Taf. V, Fig. H - J 2).
Aus dem Pariser Museum erhielt ich 2 Gläser, deren In h a lt als Äcanlhochiles zdandieus
bestimmt war, indessen enthielt nur das eine Glas diese Art, im ändern befanden sich 3 Tiere, die
in die Gattung Loboplax gehörten. Zwei von ihnen ließen sich als Loboplax rubiginosa (Hutton)
bestimmen,-während das d ritte eine ganz andere Form der Schale zeigte und zu keiner bisher
bekannten Art gestellt werden konnffilso daß ich dafür eine neue unter dem oben angegebenen Namen
errichte; dieser bezieht sich auf die Herkunft von der Stewart-Insel, wo das Exemplar von Filho]
gefunden worden ist. Der Acanthacliites (Loboplax) holosenceus Nierstrasz (Die Chitonen der Siboga-
Expedition, p. 66 f. 23, 13§|-133) h a t in der Form der Schale Ähnlichkeit mit der vorliegenden Art,
a f c aber doch deutlich verschieden, besonders in der Form des hintersten Stückes.
B is . einzige, Exemplar, nach dem ich die Art beschreibe, ist etwa 25 mm lang und 16 mm
breit, Die wahrscheinlich ausgebleichte Färbung der Schale is t gelblich, mit. rosigem Schimmer,
dör-Rand hellbraun, die Stachelgruppen weiß;iffe Innenseite weiß, in der Mitte rosenrot. Die Mittel-
-kante der Schale ist rechtwinklig. Das Vorderste Stück (Fig. 8) ist ziemlich breit, am Rande des
Tegmentums mit 5 deutlichen Ecken, aber mit nur sehr schwachen Rippen; der Rand des Articula-
mentums steh t grade nach vorn und is t recht breit, mit wenig tiefen Einschnitten. Die Mittelstücke
(Fig. 9) sind dreieckig; der Apex liegt mit den hintern Seitenecken in einer Querlinie, der Seitenrand
geht bis? zum Einschnitt gerade nach vom, sodann geradlinig schräg -nach der Mitte, so daß
er m ft d sui der Gegenseite: einen etwas spitzen Winkel mit abgerundeter Spitze bildet. Der Mittelteil
ist g la tt bis auf einige kommaförmige Eindrücke, während die S e ite n l^ H die* k aum eine Andeutung
von Radialrippen zeigen, ziemlich dicht mit flachen, länglichen, am Grunde abgeschnittenen
Erhebungen besetzt sind. Die Apophysen sind bre it und rundlich. Das Tegmentum des hintersten
Stückes (Fig. 10, 11) ist wenig breiter als iang, vorn ein wenig; yorgezOge-ü, mit etwäs hinter der
Mitte gelegenem Apex, dahinter deutlich konkav. Die Apophysen haben einen schwach ausgebuchteten
Vorderrand; der Hinterrand des Articulamentums überragt ein wenig den des Tegmentums
und zeigt 8 deutliche Einschnitte, zwischen denen die Zähne noch etwas gekerbt sind.
Die Oberseite des Gürtels is t ziemlich dicht mit Kalknadeln besetzt, derer® kleinere eine
durchschnittliche Länge von 150 p bei einem Durchmesser von 10 p haben mögen (Fig. 12), während
die größeren gebogenen etwa 400 p lang und 20 p dick sind; die großen Nadeln an den Schalenecken
sind 50 60 p dick, ihre Länge war nicht festzustellen, weil sie abgebrochen sind.
Zum Vergleich hiermit'hei erwähnt, daß die Schale von Loboplax ’milama (Quov & Gaimard)
bedeutend flacher gewölbt;, auch anders gefärbt ist, die vorderen Seitenränder der Zwischenstücke
mehr oder weniger stark eingebogen und die Apophysen mehr eckig sind, das hinterste Stück h a t
ein ziemlich flaches Tegmentum, das hinten den Rand des Articulamentums überragt, welcher etwas
nach vorn abfällt und wohl in der Regel mit 6 Einschnitten versehen ist. Der Rand erscheint glatt
und ist oben mit sehr kleinen Spicula (Fig. 13) bekleidet, unter denen solche von 20 p Länge und
größere v on 65 p Länge mit ziemlich großem Conchinbecher (Fig. 14) zu unterscheiden sind, unten
sehe ich längsgestreifte Kalkkörper (Fig. 15) von etwa 50 p Länge und 15 p Breite.