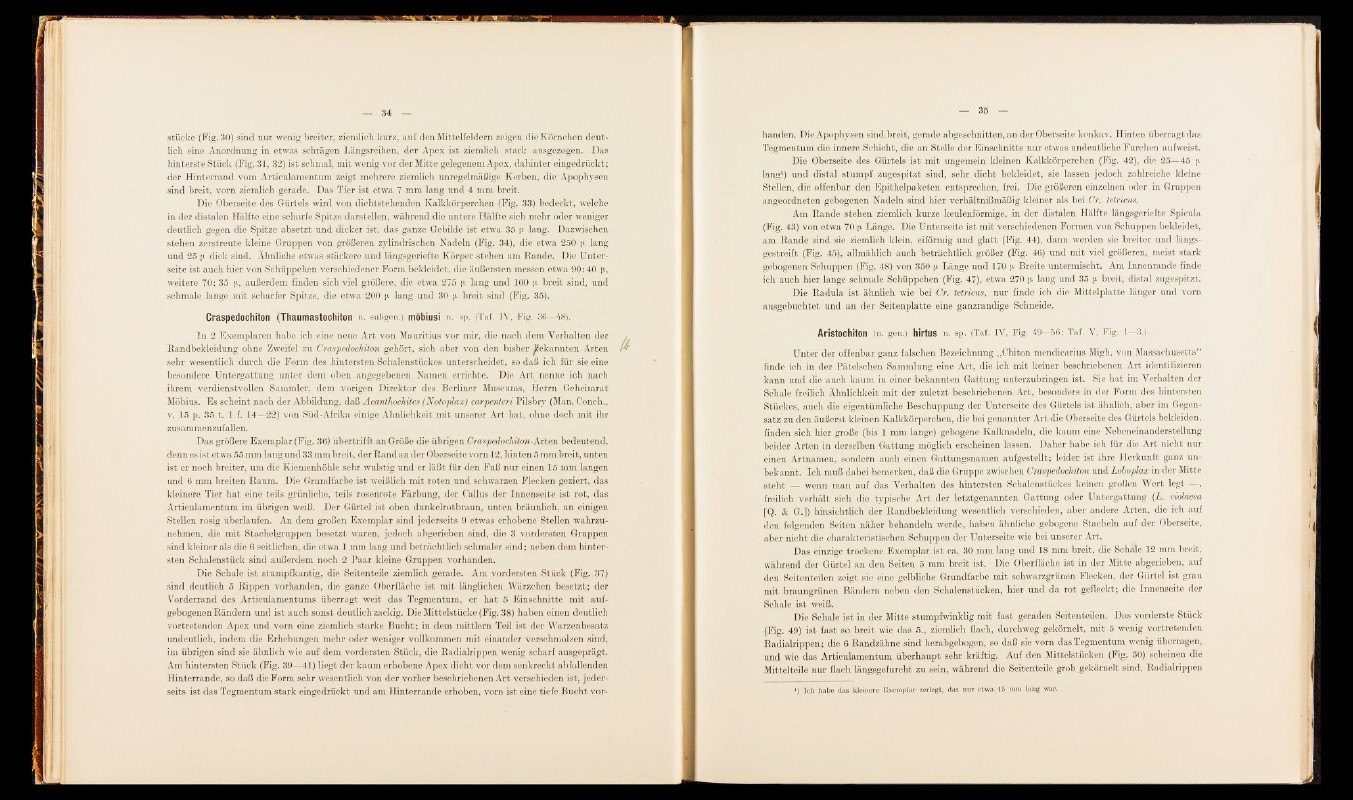
stücke (Fig. 30) sind nur wenig breiter, ziemlich kurz, auf den Mittelfeldern zeigen die Körnchen deutlich
eine Anordnung in etwas schrägen Längsreihen, der Apex ist ziemlich stark ausgezogen. Das
hinterste Stück (Fig. 31, 32) is t schmal, mit wenig vor d er Mitte gelegenem Apex, dahinter eingedrückt;
der Hinterrand vom Articulamentum zeigt mehrere ziemlich unregelmäßige Kerben, die Apophysen
sind breit, vorn ziemlich gerade. Das Tier is t etwa 7 mm lang und 4 mm breit.
Die Oberseite des Gürtels wird von dichtstehenden Kalkkörperchen (Fig. 33) bedeckt, welche
in der distalen Hälfte eine scharfe Spitze darstellen, während die untere Hälfte sich mehr oder weniger
deutlich gegen die Spitze absetzt und dicker ist, das ganze Gebilde ist etwa 35 fx lang. Dazwischen
stehen zerstreute kleine Gruppen von größeren zylindrischen Nadeln (Fig. 34), die etwa 250 fx lang
und 25 |x dick sind. Ähnliche etwas stärkere und längsgeriefte Körper stehen am Rande. Die Unterseite
is t auch hier von Schüppchen verschiedener Form bekleidet, die äußersten messen etwa 90:40 |x,
weitere 70: 35 |x, außerdem finden sich viel größere, die etwa 275 fx lang und 100 |x breit sind, und
schmale lange mit scharfer Spitze, die etwa 200 jx lang und 30 fx breit sind (Fig. 35).
Craspedochiton (Thaumastochiton n. subgen.) möbiusi n. sp. (Taf. IV, Fig. 36—48).
In 2 Exemplaren habe ich eine neue Art von Mauritius vor mir, die nach dem Verhalten der
Randbekleidung ohne Zweifel zu Craspedochiton gehört, sich aber von den bisher gekannten Arten
sehr wesentlich durch die Form des hintersten Schalenstückes unterscheidet, so daß ich für sie eine
besondere Untergattung unter dem oben angegebenen Namen errichte. Die Art nenne ich nach
ihrem verdienstvollen Sammler, dem vorigen Direktor des Berliner Museums, Herrn Geheimrat
Möbius. Es scheint nach der Abbildung, daß Acanthochites (Notoplax) carpenteri Pilsbry (Man. Conch.,
v. 15 p. 35 t. 1 f. 14—22) von Süd-Afrika einige Ähnlichkeit mit unserer Art hat, ohne doch mit ihr
zusammenzufallen.
Das größere Exemplar (Fig. 36) übertrifft an Größe die übrigen Craspedochiton-Arten bedeutend,
denn es ist etwa 55 mm lang und 33 mm breit, der Rand an der Oberseite vorn 12, hinten 5 mm breit, unten
ist er noch breiter, um die Kiemenhöhle sehr wulstig und er läßt für den Fuß nur einen 15 mm langen
und 6 mm breiten Raum. Die Grundfarbe ist weißlich mit roten und schwarzen Flecken geziert, das
kleinere Tier h a t eine teils grünliche, teils rosenrote Färbung, der Callus der Innenseite ist rot, das
Articulamentum im übrigen weiß. Der Gürtel is t oben dunkelrotbraun, unten bräunlich, an einigen
Stellen rosig überlaufen. An dem großen Exemplar sind jederseits 9 etwas erhobene Stellen wahrzunehmen,
die mit Stachelgruppen besetzt waren, jedoch abgerieben sind, die 3 vordersten Gruppen
sind kleiner als die 6 seitlichen, die etwa 1 mm lang und beträchtlich schmaler sind; neben dem hintersten
Schalenstück sind außerdem noch 2 Paar kleine Gruppen vorhanden.
Die Schale is t stumpfkantig, die Seitenteile ziemlich gerade. Am vordersten Stück (Fig. 37)
sind deutlich 5 Rippen vorhanden, die ganze Oberfläche ist mit länglichen Wärzchen besetzt; der
Vorderrand des Articulamentums überragt weit das Tegmentum, er h a t 5 Einschnitte mit aufgebogenen
Rändern und ist auch sonst deutlich zackig. Die Mittelstücke (Fig. 38) haben einen deutlich
vortretenden Apex und vorn eine ziemlich starke Bucht; in dem mittlern Teil ist der Warzenbesatz
undeutlich, indem die Erhebungen mehr oder weniger vollkommen mit einander verschmolzen sind,
im übrigen sind sie ähnlich wie auf dem vordersten Stück, die Radialrippen'wenig scharf ausgeprägt.
Am hintersten Stück (Fig. 39—41) liegt der kaum erhobene Apex dicht vor dem senkrecht abfallenden
Hinterrande, so daß die Form sehr wesentlich von der vorher beschriebenen Art verschieden ist, jederseits
ist das Tegmentum s tark eingedrückt und am H interrande erhoben, vorn ist eine tiefe Bucht v orhanden.
Die Apophysen sind.breit, gerade abgeschnitten, an der Oberseite konkav. Hinten überragt das
Tegmentum die innere Schicht, die an Stelle der Einschnitte nur etwas undeutliche Furchen aufweist.
Die Oberseite des Gürtels ist mit ungemein kleinen Kalkkörperchen (Fig. 42), die 25—45 jx
lang1) und distal stumpf zugespitzt sind, sehr dicht bekleidet, sie lassen jedoch zahlreiche kleine
Stellen, die offenbar den Epithelpaketen entsprechen, frei. Die größeren einzelnen oder in Gruppen
angeordneten gebogenen Nadeln sind hier verhältnißmäßig kleiner als bei Cr. tetricus.
Am Rande stehen ziemlich kurze keulenförmige, in der distalen Hälfte längsgeriefte Spicula
(Fig. 43) von etwa 70 (x Länge. Die Unterseite ist mit verschiedenen Formen von Schuppen bekleidet,
am Rande sind sie ziemlich klein, eiförmig und gla tt (Fig. 44), dann werden sie breiter und längsgestreift
(Fig. 45), allmählich auch beträchtlich größer (Fig. 46) und mit viel größeren, meist stark
gebogenen Schuppen (Fig. 48) von 350 [x Länge und 170 |x Breite untermischt. Am Innenrande finde
ich auch hier lange schmale Schüppchen (Fig. 47), etwa 270 |x lang und 35 |x breit, distal zugespitzt.
Die Radula ist ähnlich wie bei Cr. tetricus, nur finde ich die Mittelplatte länger und vorn
ausgebuchtet und an der Seitenplatte eine ganzrandige Schneide.
Aristochiton (n. gen.) hirtus n. sp. (Taf. IV, Fig. 49—56; Taf. V, Fig. 1—3.)
Unter der offenbar ganz falschen Bezeichnung „Chiton mendicarius Migh. von Massachusetts“
finde ich in der Pätelschen Sammlung eine Art, die ich mit keiner beschriebenen Art identifizieren
kann und die auch kaum in einer bekannten Gattung unterzubringen ist. Sie h a t im Verhalten der
Schale freilich Ähnlichkeit mit der zuletzt beschriebenen Art, besonders in der Form des hintersten
Stückes, auch die eigentümliche Beschuppung der Unterseite des Gürtels ist ähnlich, aber im Gegensatz
zu den äußerst kleinen Kalkkörperchen, die bei genannter A rt die Oberseite des Gürtels bekleiden,
finden sich hier große (bis 1 mm lange) gebogene Kalknadeln, die kaum eine Nebeneinanderstellung
beider Arten in derselben Gattung möglich erscheinen lassen. Daher habe ich für die Art nicht nur
einen Artnamen, sondern auch einen Gattungsnamen aufgestellt; leider ist ihre Herkunft ganz un bekannt.
Ich m uß dabei bemerken, daß die Gruppe zwischen Craspedochiton und Loboplax in der Mitte
steh t —- wenn man auf das Verhalten des hintersten Schalenstückes keinen großen Wert legt —,
freilich verhält sich die typische Art der letztgenannten Gattung oder Untergattung {L. violacea
[Q. & G.]) hinsichtlich der Randbekleidung wesentlich verschieden, aber andere Arten, die ich auf
den folgenden Seiten näher behandeln werde, haben ähnliche gebogene Stacheln auf der Oberseite,
aber nicht die charakteristischen Schuppen der Unterseite wie bei unserer Art.
Das einzige trockene Exemplar ist ca. 30 mm lang und 18 mm breit, die Schale 12 mm breit,
während der Gürtel an den Seiten 5 mm bre it ist. Die Oberfläche ist in der Mitte abgerieben, auf
den Seitenteilen zeigt sie eine gelbliche Grundfarbe mit schwarzgrünen Flecken, der Gürtel ist grau
mit braungrünen Bändern neben den Schalenstücken, hier und da ro t gefleckt; die Innenseite der
Schale is t weiß.
Die Schale ist in der Mitte stumpfwinklig mit fast geraden Seitenteilen. Das vorderste Stück
(Fig. 49) ist fast so bre it wie das 5., ziemlich flach, durchweg gekörnelt, mit 5 wenig vortretenden
Radialrippen; die 6 Randzähne sind herabgebogen, so daß sie vorn das Tegmentum wenig überragen,
und wie das Articulamentum überhaupt sehr kräftig. Auf den Mittelstücken (Fig. 50) scheinen die
Mittelteile nur flach längsgefurcht zu sein, während die Seitenteile grob gekörnelt sind, Radialrippen
!) Ich habe das kleinere Exemplar zerlegt, das nur etwa 15 mm lang war.