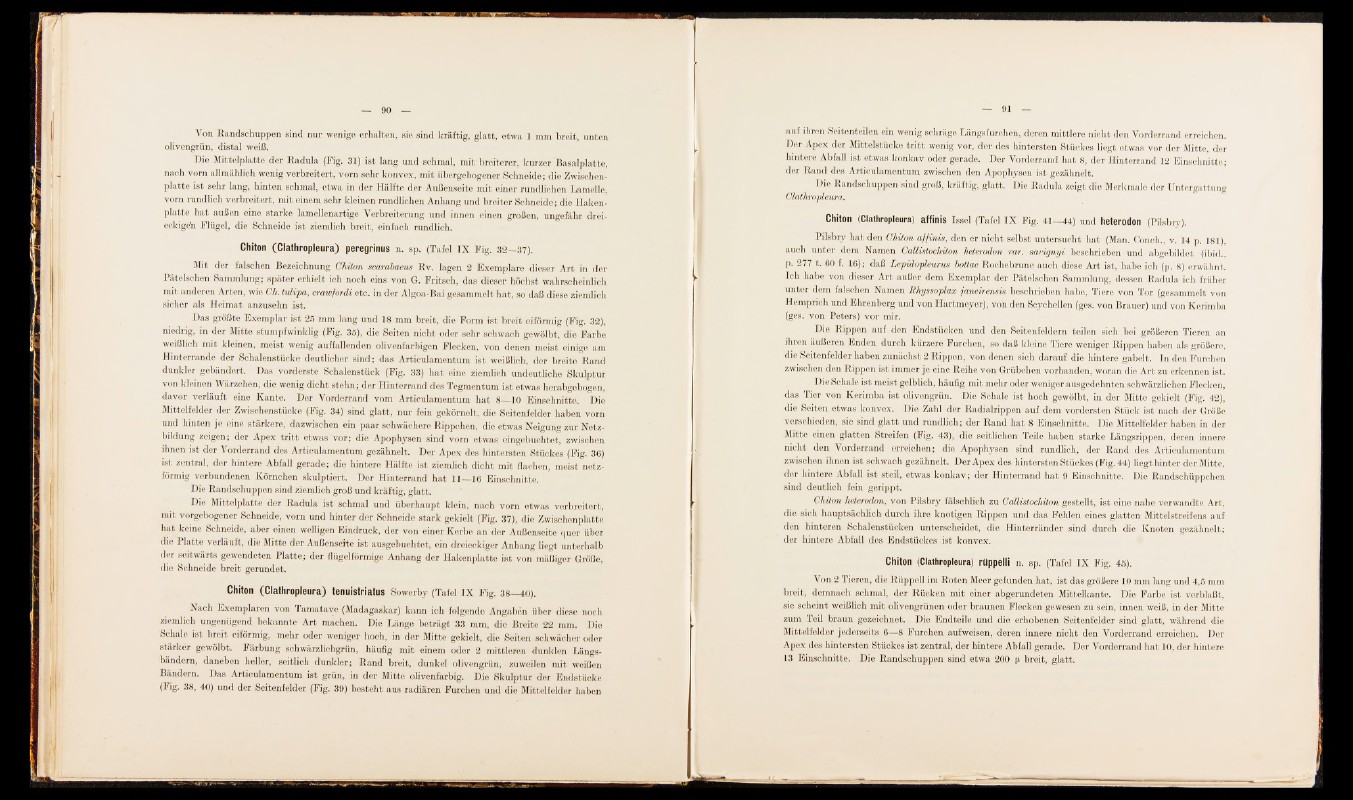
Von Randschuppen sind nur wenige erhalten, sie sind kräftig, glatt, etwa 1 mm breit, unten
olivengrün, distal weiß.
Die Mittelplatte der Radula (Fig. 31) ist lang und schmal, mit breiterer, kurzer Basalplatte,
nach vorn allmählich wenig verbreitert, vorn sehr konvex, mit übergebogener Schneide; die Zwischenp
la tte ist sehr lang, hinten schmal, etwa in der Hälfte der Außenseite mit einer rundlichen Lamelle,
vorn rundlich verbreitert, mit einem sehr kleinen rundlichen Anhang und breiter Schneide; die Hakenp
la tte h a t außen eine starke lamellenartige Verbreiterung und innen einen großen, ungefähr drei-
eckige’n Flügel, die Schneide ist ziemlich breit, einfach rundlich.
Chiton (Clathropleura) peregrinus n. sp. (Tafel IX Fig. 32—37).
Mit der falschen Bezeichnung Chiton scarabaeus Rv. lagen 2 Exemplare dieser Art in der
Pätelschen Sammlung; später erhielt ich noch eins von 6 . Fritsch, das dieser höchst wahrscheinlich
mit anderen Arten, wie Ch. tulipa, crawfordi etc. in der A lgoa-Bai gesammelt h a t, so daß diese ziemlich
sicher als Heimat anzusehn ist.
Das größte Exemplar ist 25 mm lang und 18 mm breit, die Form is t breit eiförmig (Fig. 32),
niedrig, in der Mitte stumpfwinklig (Fig. 35), die Seiten nicht oder sehr schwach gewölbt, die Farbe
weißlich mit kleinen, meist wenig auffallenden olivenfarbigen Flecken, von denen meist einige am
Hinterrande der Schalenstücke deutlicher sind; das Articulamentum ist weißlich, der breite Band
dunkler gebändert. Das vorderste Schalenstück (Fig. 33) h a t eine ziemlich undeutliche Skulptur
von kleinen Wärzchen, die wenig dicht stehn; der Hinterrand des Tegmentum ist etwas herabgebogen,
davor verläuft eine Kante. Der Vorderrand vom Articulamentum h a t 8—10 Einschnitte. Die
Mittelfelder der Zwischenstücke (Fig. 34) sind glatt, nur fein gekömelt, die Seitenfelder haben vorn
und hinten je eine stärkere, dazwischen ein paar schwächere Rippchen, die etwas Neigung zur Netzbildung
zeigen; der Apex tr i t t etwas vor; die Apophysen sind vorn etwas eingebuchtet, zwischen
ihnen ist der Vorderrand des Articulamentum gezähnelt. Der Apex des hintersten Stückes (Fig. 36)
ist zentral, der hintere Abfall gerade; die hintere Hälfte is t ziemlich dicht mit flachen, meist netzförmig
verbundenen Körnchen skulptiert. Der Hinterrand h a t 11—16 Einschnitte.
Die R andschuppen sind ziemlich groß und kräftig, glatt.
Die Mittelplatte der Radula ist schmal und überhaupt klein, nach vorn etwas verbreitert,
mit vorgebogener Schneide, vorn und hinter der Schneide s tark gekielt (Fig. 37), die Zwischenplatte
h a t keine Schneide, aber einen welligen Eindruck, der von einer Kerbe an der Außenseite quer über
die Pla tte verläuft, die Mitte der Außenseite ist ausgebuchtet, ein dreieckiger Anhang liegt unterhalb
der seitwärts gewendeten P la tte ; der flügelförmige Anhang der Hakenplatte ist von mäßiger Größe,
die Schneide breit gerundet.
Chiton (Clathropleura) tenuistriatus Sowerby (Tafel IX Fig. 38—40).
Nach Exemplaren von Tamatave (Madagaskar) kann ich folgende Angaben über diese noch
ziemlich ungenügend bekannte Art machen. Die Länge b eträgt 33 mm, die Breite 22 mm. Die
Schale ist bre it eiförmig, mehr oder weniger hoch, in der Mitte gekielt, die Seiten schwächer oder
stärker gewölbt. Färbung schwärzlichgrün, häufig mit einem oder 2 mittleren dunklen Längsbändern,
daneben heller, seitlich dunkler; Rand breit, dunkel olivengrün, zuweilen mit weißen
Bändern. Das Articulamentum ist grün, in der Mitte olivenfarbig. Die Skulptur der Endstücke
(Fig. 38, 40) und der Seitenfelder (Fig. 39) besteht aus radiären Furchen und die Mittelfelder haben
auf ihren Seitenteilen ein wenig schräge Längsfurchen, deren mittlere nicht den Vorderrand erreichen.
Der Apex der Mittelstücke tr i t t wenig vor, der des hintersten Stückes liegt etwas vor der Mitte, der
hintere Abfall ist etwas konkav oder gerade. Der Vorderrand h a t 8, der Hinterrand 12 Einschnitte;
der Rand des Articulamentum zwischen den Apophysen ist gezähnelt.
Die Randschuppen sind groß, kräftig, glatt. Die Radula zeigt die Merkmale der Untergattung
Clathropleura.
Chiton (Clathropleura) affin is Issel (Tafel IX Fig. 41—44) und heterodon (Pilsbry).
Pilsbry h a t den Chiton affinis, den er nicht selbst untersucht h a t (Man. Conch., v. 14 p. 181),
auch unter dem Namen Callistochiton heterodon var. savignyi beschrieben und abgebildet (ibid.,
p. 277 t. 60 f. 16); daß Lepidopleurus bottae Rochebrune auch diese Art ist, habe ich (p. 8) erwähnt.
Ich habe von dieser Art außer dem Exemplar der Pätelschen Sammlung, dessen Radula ich früher
unter dem falschen Namen Rhyssoplax janeirensis beschrieben habe, Tiere von Tor (gesammelt von
Hemprich und Ehrenberg und von H artmeyer), von den Seychellen (ges. von Brauer) und von K erimba
(ges. von Peters) vor mir.
Die Rippen auf den Endstücken und den Seitenfeldern teilen sich bei größeren Tieren an
ihren äußeren Enden durch kürzere Furchen, so daß kleine Tiere weniger Rippen haben als größere,
die Seitenfelder h aben zunächst 2 R ippen, von denen sich darauf die hintere gabelt. In den Furchen
zwischen den Rippen ist immer je eine Reihe von Grübchen vorhanden, woran die Art zu erkennen ist.
Die Schale ist meist gelblich, häufig mit mehr oder weniger ausgedehnten schwärzlichen Flecken,
das Tier von Kerimba ist olivengrün. Die Schale ist hoch gewölbt, in der Mitte gekielt (Fig. 42),
die Seiten etwas konvex. Die Zahl der Radialrippen auf dem vordersten Stück ist nach der Größe
verschieden, sie sind g la tt und rundlich; der Rand h a t 8 Einschnitte. Die Mittelfelder haben in der
Mitte einen glatten Streifen (Fig. 43), die seitlichen Teile haben starke Längsrippen, deren innere
nicht den Vorderrand erreichen; die Apophysen sind rundlich, der Rand des Articulamentum
zwischen ihnen ist schwach gezähnelt. Der Apex des hintersten Stückes (Fig. 44) liegt hinter der Mitte,
der hintere Abfall ist steil, etwas konkav; der Hinterrand h a t 9 Einschnitte. Die Randschüppchen
sind deutlich fein gerippt.
Chiton heterodon, von Pilsbry fälschlich zu Callistochiton gestellt, ist eine nahe verwandte Art,
die sich hauptsächlich durch ihre knotigen Rippen und das Fehlen eines glatten Mittelstreifens auf
den hinteren Schalenstücken unterscheidet, die Hinterränder sind durch die Knoten gezähnelt;
der hintere Abfall des Endstückes ist konvex.
Chiton (Clathropleura) rüppelli n. sp. (Tafel IX Fig. 45).
Von 2 Tieren, die Riippell im R oten Meer gefunden hat, ist das größere 10 mm lang und 4,5 mm
breit, demnach schmal, der Rücken mit einer abgerundeten Mittelkante. Die Farbe ist verblaßt,
sie scheint weißlich mit olivengrünen oder braunen Flecken gewesen zu sein, innen weiß, in der Mitte
zum Teil braun gezeichnet. Die Endteile und die erhobenen Seitenfelder sind glatt, während die
Mittelfelder jederseits 6—8 Furchen auf weisen, deren innere nicht den Vorderrand erreichen. Der
Apex des hintersten Stückes ist zentral, der h intere Abfall gerade. Der Vorderrand h a t 10, der hintere
13 Einschnitte. Die Randschuppen sind etwa 200 p. breit, glatt.