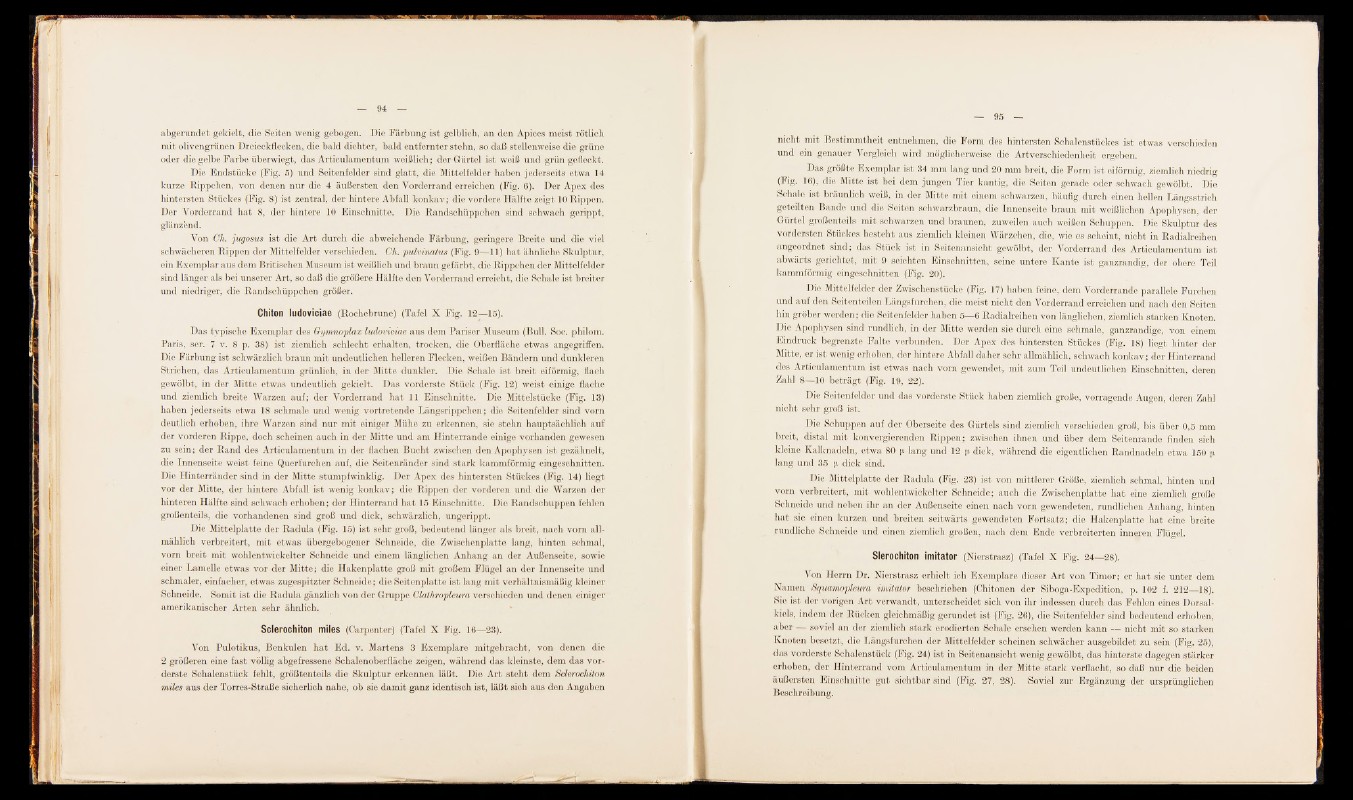
abgerundet gekielt, die Seiten wenig gebogen. Die Färbung ist gelblich, an den Apices meist rötlich
m it olivengrünen Dreieckflecken, die bald d ichter, bald entfernter stehn, so daß stellenweise die grüne
oder die gelbe F arbe überwiegt, das Articulamentum weißlich; der Gürtel is t weiß und grün gefleckt.
Die Endstücke (Fig. 5) und Seitenfelder sind glatt, die Mittelfelder haben jederseits etwa 14
kurze Rippchen, von denen nur die 4 äußersten den Vorderrand erreichen (Fig. 6). Der Apex des
hintersten Stückes (Fig. 8) ist zentral, der hintere Abfall konkav; die vordere Hälfte zeigt 10 Rippen.
Der Vorderrand h a t 8, der hintere 10 Einschnitte. Die Randschüppchen sind schwach gerippt,
glänzend.
Von Ch. jugosus ist die Art durch die abweichende Färbung, geringere Breite und die viel
schwächeren Rippen der Mittelfelder verschieden. Ch. pulvinatus (Fig. 9—11) h a t ähnliche Skulptur,
ein Exemplar aus dem B ritischen Museum ist weißlich und b raun gefärbt, die R ippchen der M ittelfelder
sind länger als bei unserer Art, so daß die größere Hälfte den Vorderrand erreicht, die Schale ist b reiter
und niedriger, die Randschüppchen größer.
Chiton ludoviciae (Rochebrune) (Tafel X Fig. 12—15).
Das typische Exemplar des Gymnoplax ludoviciae aus dem Pariser Museum (Bull. Soc. philom.
Paris, ser. 7 v. 8 p. 38) ist ziemlich schlecht erhalten, trocken, die Oberfläche etwas angegriffen.
Die Färbung ist schwärzlich braun mit undeutlichen helleren Flecken, weißen Bändern und dunkleren
Strichen, das Articulamentum grünlich, in der Mitte dunkler. Die Schale is t bre it eiförmig, flach
gewölbt, in der Mitte etwas undeutlich gekielt. Das vorderste Stück (Fig. 12) weist einige flache
und ziemlich breite Warzen auf; der Vorderrand h a t 11 Einschnitte. Die Mittelstücke (Fig. 13)
haben jederseits etwa 18 schmale und wenig vortretende Längsrippchen; die Seitenfelder sind vorn
deutlich erhoben, ihre Warzen sind nur mit einiger Mühe zu erkennen, sie stehn hauptsächlich auf
der vorderen Rippe, doch scheinen auch in der Mitte und am Hinterrande einige vorhanden gewesen
zu sein; der Rand des Articulamentum in der flachen Bucht zwischen den Apophysen ist gezähnelt,
die Innenseite weist feine Querfurchen auf, die Seitenränder sind s tark kammförmig eingeschnitten.
Die Hinterränder sind in der Mitte stumpfwinklig. Der Apex des hintersten Stückes (Fig. 14) liegt
vor der Mitte, der hintere Abfall ist wenig konkav; die Rippen der vorderen und die Warzen der
hinteren Hälfte sind schwach erhoben; der Hinterrand h a t 15 Einschnitte. Die Randschuppen fehlen
großenteils, die vorhandenen sind groß und dick, schwärzlich, ungerippt.
Die Mittelplatte der Radula (Fig. 15) is t sehr groß, bedeutend länger als breit, nach vorn allmählich
verbreitert, mit etwas übergebogener Schneide, die Zwischenplatte lang, hinten schmal,
vorn bre it mit wohlentwickelter Schneide und einem länglichen Anhang an der Außenseite, sowie
einer Lamelle etwas vor der Mitte; die H akenplatte groß mit großem Flügel an der Innenseite und
schmaler, einfacher, etwas zugespitzter Schneide; die Seitenplatte ist lang mit verhältnismäßig kleiner
Schneide. Somit ist die Radula gänzlich von der Gruppe Clathropleura verschieden und denen einiger
amerikanischer Arten sehr ähnlich.
Sclerochiton miles (Carpenter) (Tafel X Fig. 16—23).
Von Pulotikus, Benkulen h a t Ed. v. Martens 3 Exemplare mitgebracht, von denen die
2 größeren eine fa st völlig abgefressene Schalenoberfläche zeigen, während das kleinste, dem das vorderste
Schalenstück fehlt, größtenteils die Skulptur erkennen läßt. Die Art steh t dem Sclerochiton
miles aus der Torres-Straße sicherlich nahe, ob sie damit ganz identisch ist, läß t sich aus den Angaben
nicht mit Bestimmtheit entnehmen, die Form des hintersten Schalenstückes ist etwas verschieden
und ein genauer Vergleich wird möglicherweise die Artverschiedenheit ergeben.
Das größte Exemplar ist 34 mm lang und 20 mm breit, die Form ist eiförmig, ziemlich niedrig
(Fig. 16), die Mitte ist bei dem jungen Tier kantig, die Seiten gerade oder schwach gewölbt. Die
Schale ist bräunlich weiß, in der Mitte mit einem schwarzen, häufig, durch einen hellen Längsstrich
geteilten Bande und die Seiten schwarzbraun, die Innenseite braun mit weißlichen Apophysen, der
Gürtel großenteils mit schwarzen und braunen, zuweilen auch weißen Schuppen. Die Skulptur des
vordersten Stückes besteht aus ziemlich kleinen Wärzchen, die, wie es scheint, nicht in Radialreihen
angeordnet sind; das Stück ist in Seitenansicht gewölbt, der Vorderrand des Articulamentum ist
abwärts gerichtet, mit 9 seichten Einschnitten, seine untere Kante ist ganzrandig, der obere Teil
kammförmig eingeschnitten (Fig. 20).
Die Mittelfelder der Zwischenstücke (Fig. 17) haben feine, dem Vorderrande parallele Furchen
und auf den Seitenteilen Längsfurchen, die meist n icht den Vorderrand erreichen und nach den Seiten
hin gröber werden; die Seitenfelder haben 5—6 Radialreihen von länglichen, ziemlich starken Knoten.
Die Apophysen sind rundlich, in der Mitte werden sie durch eine schmale, ganzrandige, von einem
Eindruck begrenzte Falte verbunden. Der Apex des hintersten Stückes (Fig. 18) liegt hinter der
Mitte, er ist wenig erhoben, der hintere Abfall d aher sehr allmählich, schwach konkav; der Hinterrand
des Articulamentum ist etwas nach vorn gewendet, mit zum Teil undeutlichen Einschnitten, deren
Zahl 8—10 b e träg t (Fig. 19, 22).
Die Seitenfelder und das vorderste Stück haben ziemlich große, vorragende Augen, deren Zahl
nicht sehr groß ist.
Die Schuppen auf der Oberseite des Gürtels sind ziemlich verschieden groß, bis über 0,5 mm
breit, distal mit konvergierenden Rippen; zwischen ihnen und über dem Seitenrande finden sich
kleine Kalknadeln, etwa 80 ¡a lang und 12 n dick, während die eigentlichen Randnadeln etwa 150 |a
lang und 35 ja dick sind.
Die Mittelplatte der Radula (Fig. 23) ist von mittlerer Größe, ziemlich schmal, hinten und
vorn verbreitert, mit wohlentwickelter Schneide; auch die Zwischenplatte h a t eine ziemlich große
Schneide und neben ihr an der Außenseite einen nach vorn gewendeten, rundlichen Anhang, hinten
h a t sie einen kurzen und breiten seitwärts gewendeten Fortsatz; die Hakenplatte h a t eine breite
rundliche Schneide und einen ziemlich großen, nach dem Ende verbreiterten inneren Flügel.
Slerochiton imitator (Nierstrasz) (Tafel X Fig. 24—28).
Von Herrn Dr. Nierstrasz erhielt ich Exemplare dieser Art von Timor; er h a t sie unter dem
Namen Sguamopleura imitator beschrieben (Chitonen der Siboga-Expedition, p. 102 f. 212—18).
Sie ist der vorigen Art verwandt, unterscheidet sich von ihr indessen durch das Fehlen eines Dorsalkiels,
indem der Rücken gleichmäßig gerundet ist (Fig. 26), die Seitenfelder sind bedeutend erhoben,
aber — soviel an der ziemlich s tark erodierten Schale ersehen werden kann — nicht mit so stärken
Knoten besetzt, die Längsfurchen der Mittelfelder scheinen schwächer ausgebildet zu sein (Fig. 25),
das vorderste Schalenstück (Fig. 24) ist in Seitenansicht wenig gewölbt, das hinterste dagegen stärker
erhoben, der Hinterrand vom Articulamentum in der Mitte s tark verflacht, so daß nur die beiden
äußersten Einschnitte g u t sichtbar sind (Fig. 27, 28). Soviel zur Ergänzung der ursprünglichen
Beschreibung.