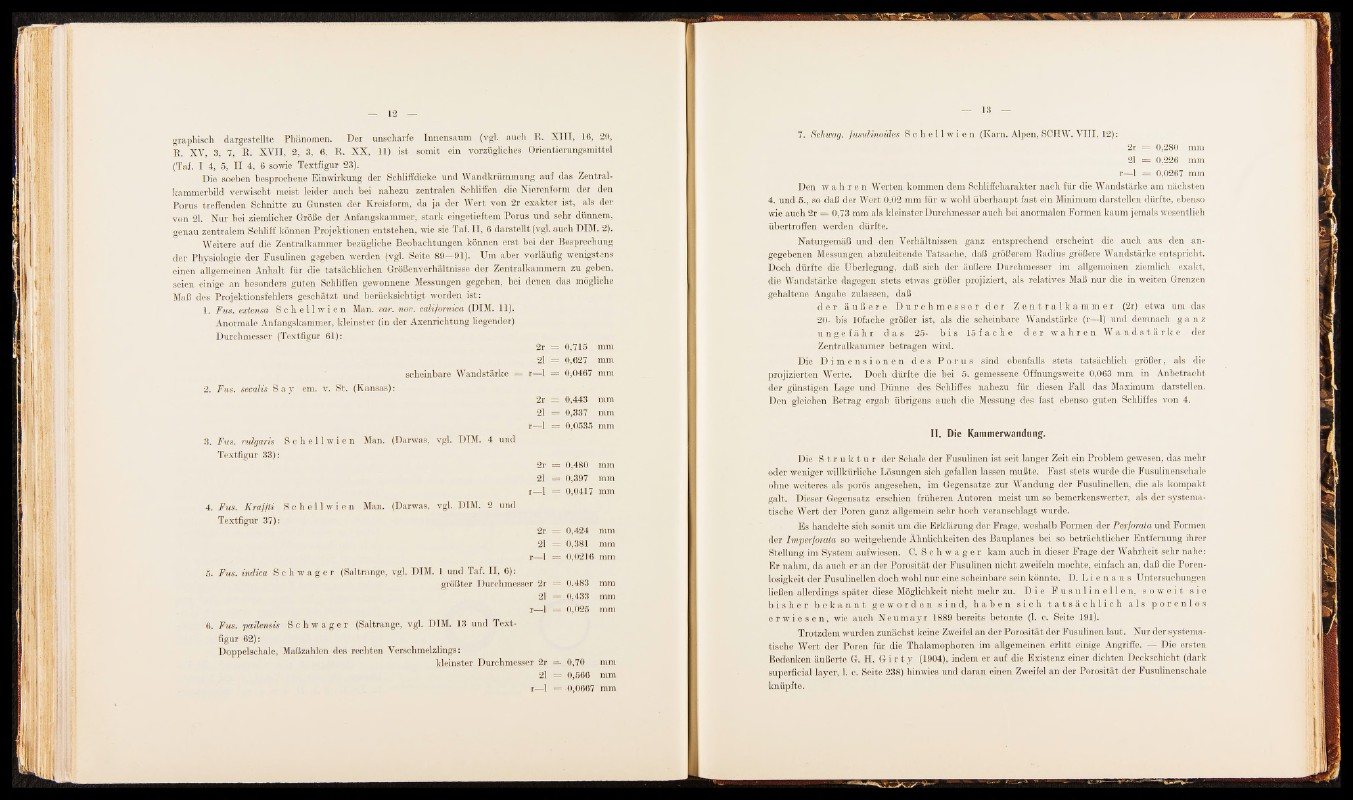
Graphisch dargestellte Phänomen. Der unscharfe Innensaum (vgl. auch R. X III, 16, 20,
R. XV, 3, 7, R. XVII, 2, 3, 6, R. XX, 11) ist somit ein vorzügliches Orientierungsmittel
(Taf. I 4, 5, I I 4, 6 sowie Textfigur 23).
Die soeben besprochene Einwirkung der Schliff dicke und Wandkrümmung auf das Zentralkammerbild
verwischt meist leider auch bei nahezu zentralen Schliffen die Nierenform der den
Porus treffenden Schnitte zu Gunsten der Kreisform, da ja der Wert von 2r exakter ist, als der
von 21. Nur bei ziemlicher Größe der Anfangskammer, s tark eingetieftem Porus und sehr dünnem,
genau zentralem Schliff können Projektionen entstehen, wie sie Taf. I I, 6 darstellt (vgl. auch DIM. 2).
Weitere auf die Zentralkammer bezügliche Beobachtungen können erst bei der Besprechung
der Physiologie der Fusulinen gegeben werden (vgl. Seite 89—91). Um aber vorläufig wenigstens
einen allgemeinen Anhalt für die tatsächlichen Größenverhältnisse der Zentralkammern zu geben,
seien einige an besonders guten Schliffen gewonnene Messungen gegeben, bei denen das mögliche
Maß des Projektionsfehlers geschätzt und berücksichtigt worden ist:
1. Fus. extenso, S c h e l l w i e n Man. var. nov. californica (DIM. 11).
Anormale Anfangskammer, kleinster (in der Axenrichtung liegender)
Durchmesser (Textfigur 61):
2r = 0,715 mm
21 = 0,627 mm
scheinbare Wandstärke == r—1 = 0,0467 mm
2. Fus. secalis S a y em. v. St. (Kansas):
2r = 0,443 mm
21 I 0,337 mm
r—1 = 0,0535 mm
3. Fus. vulgaris S c h e l l w i e n Man. (Darwas, vgl. DIM. 4 und
Textfigur 33):
2r = 0,480 mm
21 = 0,397 mm
r—1 ■== 0,0417 mm
4. Fus. Kraffli S c h e l l w i e n Man. (Darwas, vgl. DIM. 2 und
Textfigur 37):
2r = 0,424 Am
21 = 0,381 mm
r—1 = 0,0216 mm
5. Fus. indica S c h w a g e r (Saltrange, vgl. DIM. 1 und Taf. II, 6):
größter Durchmesser 2r = 0,483 mm
21 ==._0,433 mm
r—1 = 0,025 mm
6. Fus. 'paüensis S c h w a g e r (Saltrange, vgl. DIM. 13 und Textfigur
62):
Doppelschale, Maßzahlen des rechten Verschmelzlings:
kleinster Durchmesser 2r —. 0,70 mm
21 = 0,566 mm
r—1 — 0,0667 mm
7. Schwag. jusulinoides S c h e l l w i e n (Karn. Alpen, SCHW. VIII, 12):
2r =. 0,280 mm
21 =^0,226 mm
r—||B |j0 ,0 2 6 7 mm
Den w a h r e n Werten kommen dem Schliffcharakter nach für die Wandstärke am nächsten
4. und 5., so daß der Wert 0,02 mm für w wohl überhaupt fa st ein Minimum darstellen dürfte, ebenso
wie auch 2r H o ,7 3 mm als kleinster Durchmesser auch bei anormalen Formen kaum jemals wesentlich
übertroffen werden dürfte.
Naturgemäß und den Verhältnissen ganz entsprechend erscheint die auch aus den angegebenen
Messungen abzuleitende Tatsache, daß größerem Radius größere Wandstärke entspricht.
Doch dürfte die Überlegung, daß sich der äußere Durchmesser im allgemeinen ziemlich exakt,
die Wandstärke dagegen stets etwas größer projiziert, als relatives Maß nur die in weiten Grenzen
gehaltene Angabe zulassen, daß
d e r ä u ß e r e D u r c h m e s s e r d e r Z e n t r a l k a m m e r (2r) etwa um das
20- bis lOfache größer ist, als die scheinbare Wandstärke (r—1) und demnach g a n z
u n g e f ä h r d a s 25- b i s 15 f a c h e d e r w a h r e n W a n d s t ä r k e der
Zentralkammer betragen wird.
Die D i m e n s i o n e n d e s P o r u s sind ebenfalls stets tatsächlich größer, als die
projizierten Werte. Doch dürfte die bei 5. gemessene öffnungsweite 0,063 mm in Anbetracht
der günstigen Lage und Dünne des Schliffes nahezu für diesen Fall das Maximum darstellen.
Den gleichen Betrag ergab übrigens auch die Messung des fast ebenso guten Schliffes von 4.
II. Die Kammerwandung.
Die S t r u k t u r der Schale der Fusulinen ist seit langer Zeit ein Problem gewesen, das mehr
oder weniger willkürliche Lösungen sich gefallen lassen mußte. F a st stets wurde die Fusulinensehale
ohne weiteres als porös angesehen, im Gegensätze zur Wandung der Fusulinellen, die als kompakt
galt. Dieser Gegensatz erschien früheren Autoren meist um so bemerkenswerter, als der systematische
Wert der Poren ganz allgemein sehr hoch veranschlagt wurde.
Es handelte sich somit um die Erklärung der Frage, weshalb Formen der Perforata und Formen
der Imperforata so weitgehende Ähnlichkeiten des Bauplanes bei so beträchtlicher Entfernung ihrer
Stellung im System auf wiesen. C. S c h w a g e r kam auch in dieser Frage der Wahrheit sehr nahe:
E r nahm, da auch er an der Porosität der Fusulinen nicht zweifeln mochte, einfach an, daß die Poren-
losigkeit der Fusulinellen doch wohl nur eine scheinbare sein könnte. D. L i e n a u s Untersuchungen
ließen allerdings später diese Möglichkeit nicht mehr zu. D i e F u s u l i n e I l e n , s o w e i t s i e
b i s h e r b e k a n n t g e w o r d e n s i n d , h a b e n s i c h t a t s ä c h l i c h a l s p o r e n l o s
e r w i e s e n , wie auch N e u m a y r 1889 bereits betonte (1. c. Seite 191).
Trotzdem wurden zunächst keine Zweifel an der Porosität der Fusulinen laut. Nur der systematische
Wert der Poren für die Thalamophoren im allgemeinen erlitt einige Angriffe. — Die ersten
Bedenken äußerte G. H. G i r t y (1904), indem er auf die Existenz einer dichten Deckschicht (dark
superficial layer, 1. c. Seite 238) hinwies und daran einen Zweifel an der Porosität der Fusulinensehale
knüpfte.