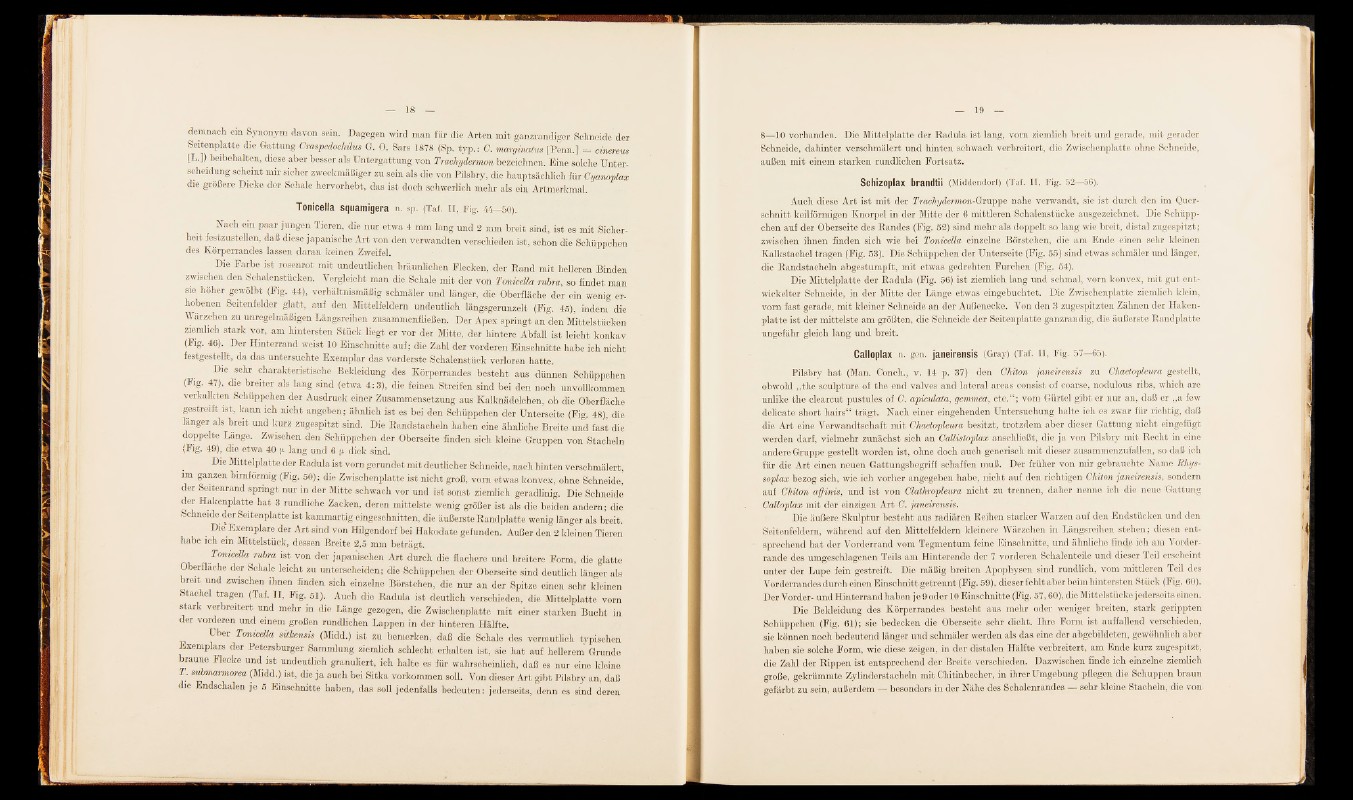
demnach ein Synonym davon sein. Dagegen wird man für die Arten mit ganzi-andiger Schneide der
Seitenplatte die Gattung Cmspedocküus G. 0 . Sara 1878 (Sp. ty p .: 0 . marginatus [ P e n n . ] * cinerem
g L . ] ) beibehalten, diese aber besser als, Untergattung von Trachydermon bezeichnen. Eine solche U nte rscheidung
scheint mir sicher zweckmäßiger zu sein, als die von Pilsbry, die hauptsächlich für Cyanoplax
die größere Dicke der Schale hervorhebt, das ist doch schwerlich mehr als ein Artmerkmal.
Tonicella squamigera n. sp. (Taf. II, Fig. 44- SO)..’
Nach ein p a ar jungen Tieren, die nur etwa 4 mm lang und 2 mm bre it sind, is t es mit Sicherheit
festzustellen, daß diese japanische Art von den v erwandten verschiedenist, schon die Schüppchen
des Körperrandes lassen daran keinen Zweifel.
Die Farbe is t rosenrot m it undeutlichen bräunlichen Flecken, der Band m it helleren Binden
zwischen den Schalenstücken. Vergleicht man die Schale mit der von Tonicella rubra, so findet man
sie höher gewölbt (Fig. 44), verhältnismäßig schmäler und länger, die Oberfläche der ein wenig erhobenen
Seitenfelder glatt, auf den Mittelfeldern undeutlich längsgerunzelt (Fig. 45), indem die
Wärzchen zu unregelmäßigen Längsreihen zusammenfließen. Der Apex springt an den Mittelstücken
ziemlich stark vor, am hintersten Stück liegt er vor der Mitte, der hintere Abfall ist leicht konkav
(Fig. 46). Der Hinterrand weist 10 Einschnitte auf; die Zahl der vorderen Einschnitte habe ich nicht
festgestellt, da das untersuchte Exemplar das vorderste Schalenstück verloren hatte. ,
Die sehr charakteristische Bekleidung des Körperrandes besteht aus dünnen Schüppchen
(Fig. 47), die breiter als lang sind (etwa 4:3), die feinen Streifen sind bei den noch unvollkömmen
verkalkten Schüppchen der Ausdruck einer Zusammensetzung aus'Kalknädelchen, ob die Oberfläche
gestreift ist, kann ich nicht angeben; ähnlich is t es bei den Schüppchen der Unterseite (Fig. 48), die
länger als breit und kurz zugespitzt sind. Die Bandstacheln haben eine ähnliche Breite Und fa st die
doppelte Lange. Zwischen den Schüppchen der Oberseite finden sich kleine; Gruppen von Stacheln
(Fig. 49), die etwa 40 p lang und 6 p dick sind.
Die Mittelplatte der Eadula ist vorn gerundet mit deutlicher Schneide, nach hinten verschmälert;
im ganzen bimförmig (Fig. 50); die Zwischenplatte ist nicht groß, vom etwas konvex, ohne Schneide,
der Seitenrand springt nur in der Mitte schwach vor und is t sonst ziemlich geradlinig. Die Schneide
der Hakenplatte h a t 3 rundliche Zacken, deren mittelste wenig größer ist als die beiden ändern; die
Schneide der Seltenplatte ist k ammartig eingeschnitten, die äußerste Randplatte wenig länger als breit.
Die Exemplare der A rt sind von Hilgendorf bei Hakodate gefunden. Außer den 2 kleinen Tieren
habe ich ein Mittelstück, dessen Breite 2,5 mm beträgt.
Tomcella rubra is t von der japanischen Art durch die flachere und breitere Form, die glatte
Oberfläche der Schale leicht zu unterscheiden; die Schüppchen der Oberseite sind deutlich länger als
bre it und zwischen ihnen finden sich einzelne Börstchen, die n u r an der Spitze einen sehr kleinen
Stachel tragen (Taf. II, Fig. 51). Auch die E adula is t deutlich verschieden, die Mittelplatte vorn
stark verbreitert und mehr m die Länge gezogen, die Zwischenplatte mit einer starken Bucht in
der vorderen und einem großen rundlichen Lappen in der hinteren Hälfte.
Über Tonicella sitkensis (Midd.) is t zu bemerken, daß die Schale des vermutlich typischen
Exemplars der Petersburger Sammlung ziemlich schlecht erhalten ist, sie h a t auf hellerem Grunde
braune Flecke und is t undeutlich granuliert, ich halte es für wahrscheinlich, daß es nur eine kleine
T. submamorea (Midd.) ist, die ja auch bei Sitka Vorkommen soll. Von dieser Art g ibt Pilsbry an, daß
die Endschalen je 5 Einschnitte haben, das soll jedenfalls bedeuten: jederseits, denn es sind deren
8—10 vorhanden. Die Mittelplatte der Radula ist lang, vorn ziemlich breit und gerade, mit gerader
Schneide, dahinter verschmälert und hinten schwach verbreitert, die Zwischenplatte ohne Schneide,
außen mit einem starken rundlichen Fortsatz.
Schizoplax brandtii (Middendorf) (Taf. II, Fig. 52—56).
Auch diese Art is t mit der Trachydermon-Gruppe nahe verwandt, sie ist durch den im Querschnitt
keilförmigen Knorpel in der Mitte der 6 mittleren Schalenstücke ausgezeichnet. Die Schüppchen
auf der Oberseite des Randes (Fig. 52) sind mehr als doppelt so lang wie breit, distal zugespitzt;
zwischen ihnen finden sich wie bei Tonicella einzelne Börstchen, die am Ende einen sehr kleinen
Kalkstachel tragen (Fig. 53). Die Schüppchen der U nterseite (Fig. 55) sind etwas schmäler und länger,
die Randstacheln abgestumpft, mit etwas gedrehten Furchen (Fig. 54).
Die Mittelplatte der Radula (Fig. 56) ist ziemlich, lang und schmal, vorn konvex, mit gut en twickelter
Schneide, in der Mitte der Länge etwas eingebuchtet. Die Zwischenplatte ziemlich klein,
vorn fast gerade, mit kleiner Schneide an der Außenecke. Von den 3 zugespitzten Zähnen der Hakenplatte
ist der mittelste am größten, die Schneide der Seitenplatte ganzrandig, die äußerste Randplatte
ungefähr gleich lang und breit.
Calloplax n. gen. janeirensis (Gray) (Taf. II, Fig. 57—65).
Pilsbry h a t (Man. Conch., v. 14 p. 37) den Chiton janeirensis zu Chaetopleura gestellt,
obwohl „ th e sculpture of th e end valves and lateral areas consist of coarse, nodulous ribs, which are
unlike th e clearcut pustules of C. apiculata, gemmea, etc.“ ; vom Gürtel gibt er nur an, daß er ,,a few
delicate short hairs“ trägt. Nach einer eingehenden Untersuchung halte ich es zwar für richtig, daß
die Art eine Verwandtschaft mit Chaetopleura besitzt, trotzdem aber dieser Gattung nicht eingefügt
werden darf, vip.1mp.hr zunächst sich an Callistoplax anschließt, die ja von Pilsbry mit Recht in eine
andere Gruppe gestellt worden ist, ohne doch auch generisch, mit dieser zusammenzufallen, so daß ich
für die Art einen neuen Gattungsbegriff schaffen muß. Der früher von mir gebrauchte Name Rhys-
soplax bezog sich, wie ich vorher angegeben habe, nicht auf den richtigen Chiton janeirensis, sondern
auf Chiton affinis, und is t von Clathropleura nicht zu trennen, daher nenne ich die neue 'Gattung
Calloplax mit der einzigen Art C. janeirensis.
Die äußere Skulptur besteht aus radiären Reihen starker Warzen auf den Endstücken und den
Seitenfeldern, während auf den Mittelfeldern kleinere Wärzchen in Längsreihen stehen; diesen entsprechend
h a t der Vorderrand vom Tegmentum feine Einschnitte, und ähnliche find.e ich am Vorderrande
des umgeschlagenen Teils am Hinterende der 7 vorderen Schalenteile und dieser Teil erscheint
unter der Lupe fein gestreift. Die mäßig breiten Apophysen sind rundlich, vom mittleren Teil des
Vorderrandes durch einen Einschnitt getrennt (Fig. 59), dieser fehlt aber beim hintersten Stück (Fig. 60).
Der Vorder- und Hinterrand haben je 9 oder 10 Einschnitte (Fig. 57,60), die Mittelstücke jederseits einen.
Die Bekleidung des Körperrandes besteht aus mehr oder weniger breiten, stark gerippten
Schüppchen (Fig. 61); sie bedecken die Oberseite sehr dicht. Ihre Form is t auffallend verschieden,
sie können noch bedeutend länger und schmäler werden als das eine der abgebildeten, gewöhnlich aber
haben sie solche Form, wie. diese zeigen, in der distalen Hälfte verbreitert, am Ende kurz zugespitzt,
die Zahl der Rippen ist entsprechend der Breite verschieden. Dazwischen finde ich einzelne ziemlich
große, gekrümmte Zylinderstacheln mit Chitinbecher, in ihrer Umgebung pflegen die Schuppen braun
gefärbt zu sein, außerdem — besonders in der Nähe des Schalenrandes — sehr kleine Stacheln, die von