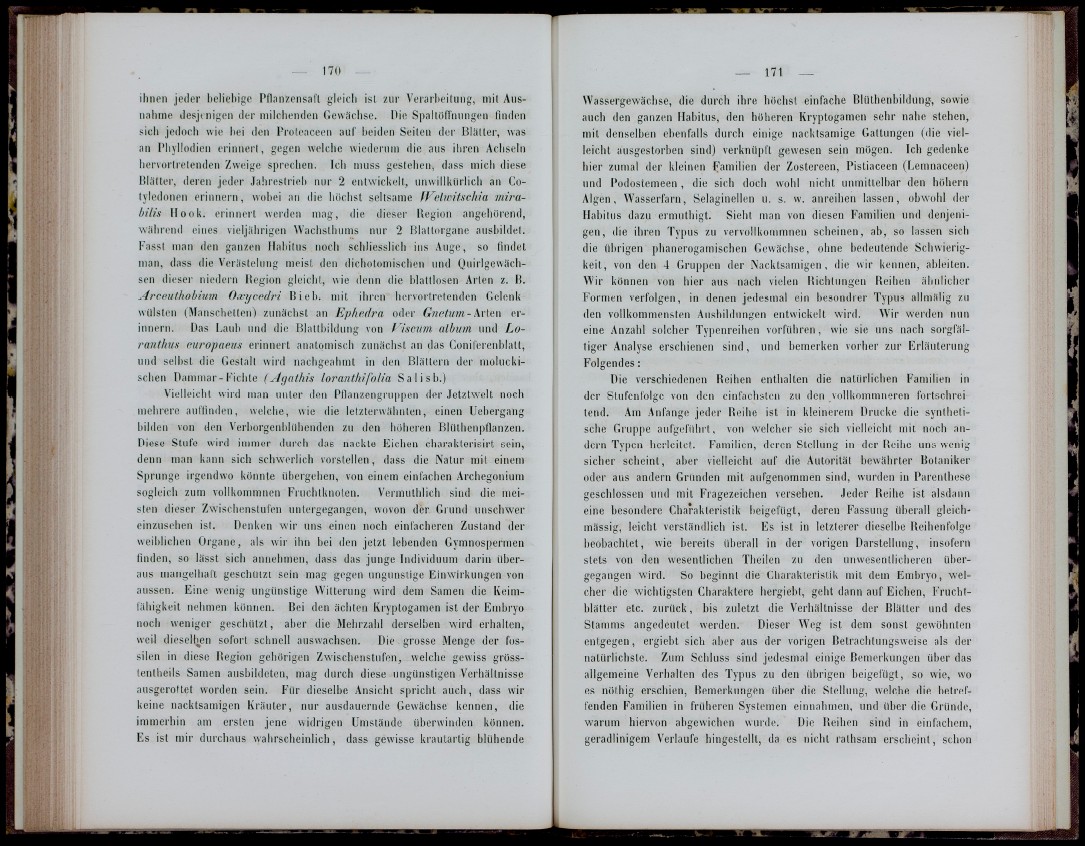
170 171
ihnen jeder beliebige Pilonzensafl gleicb isl zur Verarl>eitung, mit Äiisnnhme
desjenigen der milchenden Gewächse. Die Spalloilnnngen finden
sich jedoch wie I)ei den Proteaceen auf beiden Seiten der Blätter, was
an Phyüodien erinnert, gegen welche wiederum die ans ihren Achseln
hervorlretenden Zweige sprechen. Ich muss gestelien, dass mich diese
Blatter, deren jeder Jahreslrieh nur 2 entwickelt^ unwillkürlich an Cotyledonen
erinnern, wobei an die hijchst seltsame ff^elwitsckia mirahi'Hs
I look. erinnert werden mag, die dieser Region angehörend,
wahrend eines vieljahrigen Wachsthums nur 2 Blaltorgane ausbildel.
Fassl man den ganzen Habitus noch schh'esslich ins Auge, so findet
man, dass die Verästelung meist den dichotomischen und Quirlgewächsen
dieser niedern Hegion gleicht, wie denn die blattlosen Arten z. B.
Arceuthobiiiin Oxycedri B i e b. mit ihren hervortretenden Gelenkwülsten
(Manschetten) zunächst an Ephedra oder Giietiim- kvi^w erinnern.
Das Laub und die Blattbildung von Viscum album und Loraiithus
eiiropaeus erinnert anatomisch zunächst an das Coniferenblatt,
und selbst die Gestall wird nachgeahmt in den Blättern der moluckischen
Danunar-Fichte {Agathis loranthlfolia Salisb.)
Vielleicht wird man unter den Pilanzengruppen der Jetztwelt noch
mehrere auffintlen, welche, wie die letzterwähnten, einen Uebergang
bilden von den Verborgenblühenden zu den höheren Blüthenpflanzen.
Diese Stufe wird immer durch das nackte Eichen charakterisirt sein,
denn man kann sich schwerlich vorstellen, dass die Natur mit einem
Sprunge irgendwo könnte übergehen, von einem einfachen Archegonium
sogleich zum vollkommnen FruchtknoLen, Vermuthlich sind die meisten
dieser Zwischenstufen untergegangen, wovon der Grund unschw^er
einzusehen ist. Denken wir uns einen noch einfacheren Zustand der
weiblichen Organe, als wir ihn bei den jetzt lebenden Gymnospermen
finden, so lässt sich annehmen, dass das junge Individuum darin überaus
mangelhaft geschützt sein mag gegen ungünstige Einwirkungen von
aussen. Eine wenig ungünstige Witterung wird dem Samen die Keimfähigkeit
nehmen können. Bei den ächten Kryptogamen ist der Embryo
noch weniger geschützt, aber die Mehrzahl derselben wird erhalten,
weil diesell^en sofort schnell auswachsen. Die grosse Menge der fossilen
in diese Region gehörigen Zwischenstufen, welche gewiss grösstentheils
Samen ausbildeten, mag durch diese ungünstigen Verhältnisse
ausgerottet worden sein. Für dieselbe Ansicht spricht auch, dass wir
keine nacktsamigen Kräuter, nur ausdauernde Gewächse kennen, die
immerhin am ersten jene widrigen Umstände überwinden können.
Es ist mir durchaus wahrscheinlich, dass gewisse kraulartig blühende
Wassergewächse, die durch ihre höchst einfache Blüthenbildung, sowie
auch den ganzen Habitus, den höheren Kryptogamen sehr nahe stehen,
mit denselben ebenfalls durch einige nacktsamige Gattungen (die vielleicht
ausgestorben sind) verknüpft gewesen sein mögen. Ich gedenke
hier zumal der kleinen Familien der Zostereen, Pistiaceen (Lemnaceen)
und Podoslemeen , die sich doch wohl nicht unmittelbar den höhern
Algen, Wasserfarn, Selaginellen u. s. w. anreihen lassen, obw^ohl der
Habitus dazu ermuthigt. Sieht man von diesen FamiUen und denjenigen,
die ihren Typus zu vervollkommnen scheinen, ab, so lassen sich
die übrigen phanerogamischen Gewächse, ohne bedeutende Schwierigk
e i t , von den 4 Gruppen der Nacktsamigen, die wir kennen, ableiten.
Wir können von hier aus nach vielen Bichtungen Reihen älnilicher
Formen verfolgen, in denen jedesmal ein besondrer Typus allmälig zu
den vollkommensten Ausbildungen entwickelt wird. Wir werden nun
eine Anzahl solcher Typenreihen vorführen, wie sie uns nach sorgfältiger
Analyse erschienen sind, und bemerken vorher zur Erläuterung
Folgendes:
Die verschiedenen Reihen enthalten die natürlichen Familien in
der Stufenfolge von den einfachsten zu den vollkommneren fortschreitend.
Am Anfange jeder Reihe ist in kleinerem Drucke die syntlietische
Gruppe aufgeführt, von welcher sie sich vielleicht mit noch andern
Typen herleitet. Familien, deren Stellung in der Reihe uns wenig
sicher scheint, aber vielleicht auf die Autorität bewährter Botaniker
oder aus andern Gründen mit aufgenommen sind, wurden in Parenthese
geschlossen und mit Fragezeichen versehen. Jeder Reihe ist alsdann
eine besondere Charakteristik beigefügt, deren Fassung überall gleichmassig,
leicht verständlich ist. Es ist in letzterer dieselbe Reihenfolge
beobachtet, wie bereits überall in der vorigen Darstellung, insofern
stets von den wesentlichen Theilen zu den unwesentlicheren übergegangen
wird. So beginnt die CharakLerisLik mit dem Embryo, welcher
die wichtigsten Charaktere hergiebt, geht dann auf Eichen, Fruchtblätter
etc. zurück, bis zuletzt die Verhältnisse der Rlätter und des
Stamms angedeutet werden. Dieser Weg ist dem sonst gewöhnten
entgegen, ergiebt sich aber aus der vorigen Betrachtungsweise als der
natürlichste. Zum Schluss sind jedesmal einige Bemerkungen über das
allgemeine Verhalten des Typus zu den übrigen beigefügt, so wie, wo
es nöthig erschien, Bemerkungen über die Stellung, welche die betreffenden
Familien in früheren Systemen einnahmen, und über die Gründe,
w a r um hiervon abgewichen wurde. Die Reihen sind in einfachem,
geradlinigem Verlaufe hingestellt, da es nicht rathsam erscheint, schon