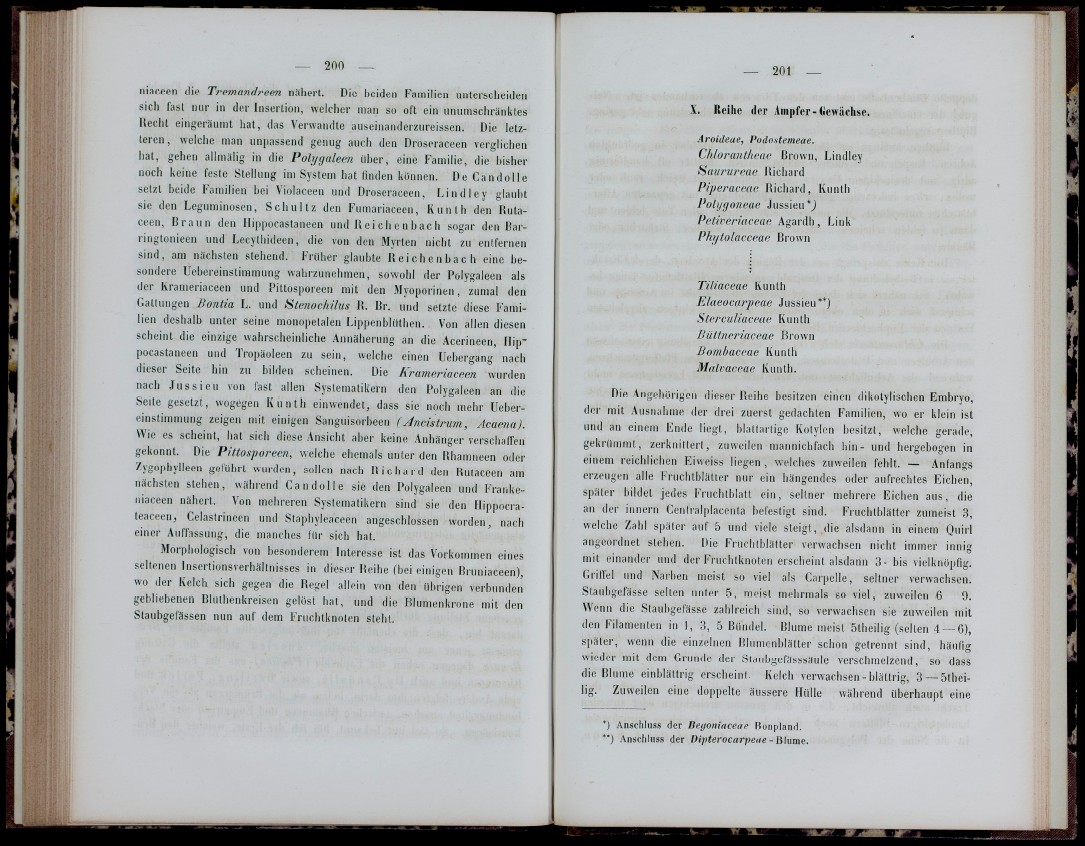
— 200
niaceen die Treinandreen niiliert. Die beiden Familien unterscheiden
sich fast nur in der Insertion, welcher man so oft ein unumschränktes
Recht eingeräumt hat, das Verwandte auseinanderzureissen. Die letzteren,
welche man unpassend genug auch den Droseraceen verglichen
hat, gehen allmälig in die Polygaleen über, eine Familie, die bisher
noch keine feste Stellung im System hat finden können. De Candolle
setzt beide Familien bei Violaceen und Droseraceen, Lindley glaubt
sie den Leguminosen, Schultz den Fumariaceen, Kunth den Rutaceen,
Rraun den Ilippocastaneen und Rei ch e n b a c h sogar den Barringtonieen
und Lecythideen, die von den Myrten nicht zu entfernen
sind, am nächsten stehend. Früher glaubte R e i c h e n b a c h eine besondere
Uebereinstimmung wahrzunehmen, sowohl der Polygaleen als
der Krameriaceen und Pittosporeen mit den Myoporinen, zumal den
Gattungen Bontia L. und Htenochüus R. Br. und setzte diese Familien
deshalb unter seine monopetalen Lippenblüthen. Von allen diesen
scheint die einzige wahrscheinliche Annäherung an die Acerineen, Ilippocastaneen
und Tropäoleen zu sein, welche einen Uebergang' nach
dieser Seite hin zu bilden scheinen. Die Krameriaceen wurden
nach Jussieu von fast allen Systematikern den Polygaleen an die
Seite gesetzt, wogegen Kunt h einwendet, dass sie noch mehr Uebereinstimmung
zeigen mit einigen Sanguisorbeen (Ancistrum, Acaena).
Wie es scheint, hat sich diese Ansicht aber keine Anhänger verschaffen
gekonnt. Die Pittosporeen, welche ehemals unter den Rhamneen oder
Zygophylleen geführt wurden, sollen nach Richar d den Rutaceen am
nächsten stehen, während Candol le sie den Polygaleen und Frankeiiiaceen
nähert,. Von mehreren Systematikern sind sie den tlippocrateaceen,
Celastrineen und Staphyleaceen angeschlossen worden, nach
einer Auffassung, die manches für sich hat.
Morphologisch von besonderem Interesse ist das Vorkommen eines
seltenen Insertionsverhältnisses in dieser Reihe (bei einigen Bruniaceen),
wo der Kelch sich gegen die Regel allein von den übrigen verbunden
gebliebenen Blüthenkreisen gelöst hat, und die Blumenkrone mit den
Staubgefässen nun auf dem Fruchtknoten steht.
201
X. Reihe der Ampfer-Gewächse.
Aroideae, Podostemeae.
Chlorantheae Brown, Lindley
Saurureae Richard
Piperaceae Richard, Kunth
Polygoneae Jussieu
Petiveriaceae Agardh, Link
Phytolacceae Brown
Tiliaceae Kunth
Elaeocarpeae Jussieu**)
Sterculiaceae Kunth
Büttneriaceae Brown
Bomhaceae Kunth
Malvaceae Kunth.
Die Angehörigen dieser Reihe besitzen einen dikotylischen Embryo,
der mit Ausnahme der drei zuerst gedachten Familien, wo er klein ist
und an einem Ende liegt, blattartige Kotylen besitzt, welche gerade,
gekrümmt, zerknittert, zuweilen mannichfach hin- und hergebogen in
einem reichlichen Eiweiss liegen , welches zuweilen fehlt. — Anfangs
erzeugen alle Fruchtblätter nur ein hängendes oder aufrechtes Eichen,
später bildet jedes Fruchtblatt ein, seltner mehrere Eichen aus, die
an der innern Ceniralplacenta befestigt sind. Fruchtblätter zumeist 3,
welche Zahl später auf 5 und viele steigt, die alsdann in einem Quirl
angeordnet stehen. Die Fruchtblätter verwachsen nicht immer innig
mit einander und der Fruchtknoten erscheint alsdann 3- bis vielknöpfig.
Griffel und Narben meist so viel als Carpelle, seltner verwachsen.
Staubgefässe selten unter 5, meist mehrmals so viel, zuweilen 6 — 9,
Wenn die Staubgefässe zahlreich sind, so verwachsen sie zuweilen mit
den Filamenten in 1, 3, 5 Bündel. Blume meist ötheilig (selten 4 —G),
später, wenn die einzelnen Blumenblätter schon getrennt sind, häufig
wieder mit dem Grunde der Staubgefässsäule verschmelzend, so dass
die Blume einblättrig erscheint. Kelch verwachsen-blättrig, 3--5theilig.
Zuweilen eine doppelte äussere Hülle während überhaupt eine
*) Anschluss der Begoniaceae Bonpland.
') Anschluss der Dipterocarpeae -&\nmG.
R