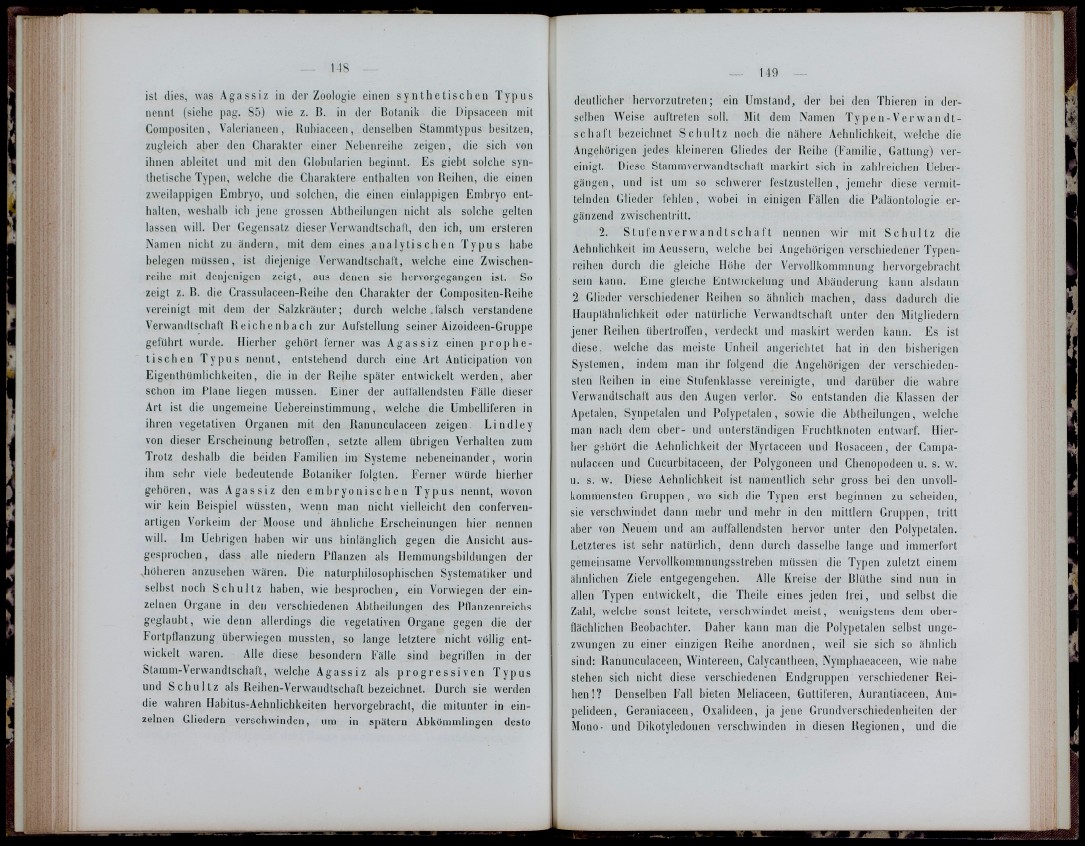
I 4 J
- 1-18 -
ist (lies, was Agassi z in der Zoologie einen s y n t h e t i s c h e n Typus
nennt (siehe pag. 85) wie z. B. in der Botanik die Dipsaceen mit
Coinpositen, Valerianeen , Biihiaceen , denselben Stamnitypus besitzen,
zugleich aber den Charakter einer Nebenreihe zeigen, die sich von
ihnen ableitet und mit den Globularien beginnt. Es giebt solche synthetische
Typen, welche die Charaktere enthallen von Reihen, die einen
zweilappigen Embryo, und solchen, die einen einlappigen Embryo enthalten,
weshalb ich jene grossen Abtheilungen nicht als solche gelten
lassen will. Der Gegensatz dieser Verwandlschalt, den ich, nm ersleren
Namen nicht zu andern, mit dem eines ana l y t i s c h en Typus habe
belegen n)üssen, ist diejenige Verwandtschaft, welche eine Zwischenreihe
mit denjenigen zeigt, aus denen sie hervorgegangen ist. So
zeigt z. B. die Crassulaceen-Reihe den Charakter der Compositen-Reihe
vereinigt mit dem der Salzkräuter; durch welche .falsch verstandene
Verwandtschaft R e i chenba c h zur Aufstellung seiner Aizoideen-Gruppe
geführt wurde. Hierher gebort ferner was A g a s s i z einen prophet
i s c h e n Typus nennt, entstehend durch eine Art Anticipation von
Eigenthümlichkeiten, die in der Reihe später entwickelt werden, aber
schon im Plane liegen müssen. Einer der auffallendsten Fälle dieser
Art ist die ungemeine Uehereinstimmung, welche die Umbelliferen in
ihren vegetativen Organen mit den Ranunculaceen zeigen, Lindley
von dieser Erscheinung betroffen, setzte allem übrigen Verhalten zum
Trotz deshalb die beiden Familien im Systeme nebeneinander, worin
ihm sehr viele bedeutende Botaniker iblgten> Ferner würde hierher
g e h ö r e n , was Aga s s i z den emb r y o n i s c h e n Typus nennt, wovon
wir kein Beispiel wüssten, wenn man nicht vielleicht den confervenartigen
Vorkeim der Moose und ähnliche Erscheinungen hier nennen
will. Im Uebrigen haben wir uns hinlänglich gegen die Ansicht ausg
e s p r o c h e n , dass alle niedern Pflanzen als Ilemmungsbildungen der
höheren anzusehen wären. Die naturphilosophischen Systematiker und
selbst noch Schul t z haben, wie besprochen, ein Vorwiegen der einzelnen
Organe in den verschiedenen Abtheilungen des Pflanzenreichs
g e g l a u b t , wie denn allerdings die vegetativen Organe gegen die der
Fortpflanzung überwiegen mussten, so lange letztere nicht völlig entwickelt
waren. Alle diese besondern Fälle sind begriflen in der
Stamm-Verwandtschaft, welche Agas s i z als p r o g r e s s i v e n Typus
und S chni t z als Reihen-Verwaudtschaft bezeichnet. Durch sie werden
die wahren Habitus-Aehnlichkeiten hervorgebracht, die mitunter in einzelnen
Gliedern verschwinden, um in spätem Abkömmlingen desto
149 -
deutlicher hervorzutreten; ein Umstand^, der bei den Thieren in derselben
Weise auftreten soll. Mit dem Namen Ty p e n - V e r w a n d t -
s c h a f l bezeichnet Schul t z noch die nähere Aehnlichkeit, welche die
Angehörigen jedes kleineren Gliedes der Reihe (Familie, Gattung) vereinigt.
Diese Stammverwandtschaft markirt sich in zahlreichen Uebergängen,
und ist um so schwerer festzustellen, jemehr diese vermittelnden
Glieder fehlen, wobei in einigen Fällen die Paläontologie ergänzend
zwischentritt.
2. Stufenverwandtschaft nennen wir mit Schul t z die
Aehnlichkeit im Aeussern, welche bei Angehörigen verschiedener Typenreihen
durch die gleiche Höhe der Vervollkommnung hervoi'gebracht
sein kann. Eine gleiche Entwicklung und Abänderung kann alsdann
2 Glieder verschiedener Reihen so ähnlich machen, dass dadurch die
Hauptähnlichkeit oder natürliche Verwandtschaft unter den Mitgliedern
j e n e r Reihen übertroffen, verdeckt und maskirt werden kann. Es ist
diese, welche das meiste Unheil angerichtet hat in den bisherigen
Systemen, indem man ihr folgend die Angehörigen der verschiedensten
Reihen in eine Stufenklasse vereinigte, und darüber die wahre
Verwandtschaft aus den Augen verlor. So entstanden die Klassen der
Apetalen, Synpetalen und Polypelalen , sowie die Abtheilungen, welche
man nach dem ober- und unterständigen Fruchtknoten entwarf. Hierher
gehört die Aehnlichkeit der Myrtaceen und Rosaceen, der Campanulaceen
und Cucurbitaceen, der Polygoneen und Chenopodeen u. s. w.
u. s. w. Diese Aehnlichkeit ist namentlich sehr gross bei den unvollkommensten
Gruppen, wo sich die Typen erst beginnen zu scheiden,
sie verschwindet dann mehr und mehr in den mittlem Gruppen, tritt
aber von Neuem und am auffallendsten hervor unter den Polypetalen.
Letzteres ist sehr natürlich, denn durch dasselbe lange und immerfort
gemeinsame Vervollkommnungsstreben müssen die Typen zuletzt einem
ähnlichen Ziele entgegengehen. Alle Kreise der Blüthe sind nun in
allen Typen entwickelt, die Theile eines jeden frei, und selbst die
Zahl^ welche sonst leitete, verschwindet meist, wenigstens dem oberflächlichen
Beobachter. Daher kann man die Polypetalen selbst ungezwungen
zu einer einzigen Reihe anordnen, weil sie sich so ähnlich
sind: Ranunculaceen, Wintereen, Calycantheen, Nymphaeaceen, wie nahe
stehen sich nicht diese verschiedenen Endgruppen verschiedener Reih
e n ! ? Denselben Fall bieten Meliaceen, Guttiferen, Aurantiaceen, Ampelideen,
Geraniaceen, Oxalideen, ja jene Grundverschiedenheiten der
Mono- und Dikotyledonen verschwinden in diesen Regionen, und die
«