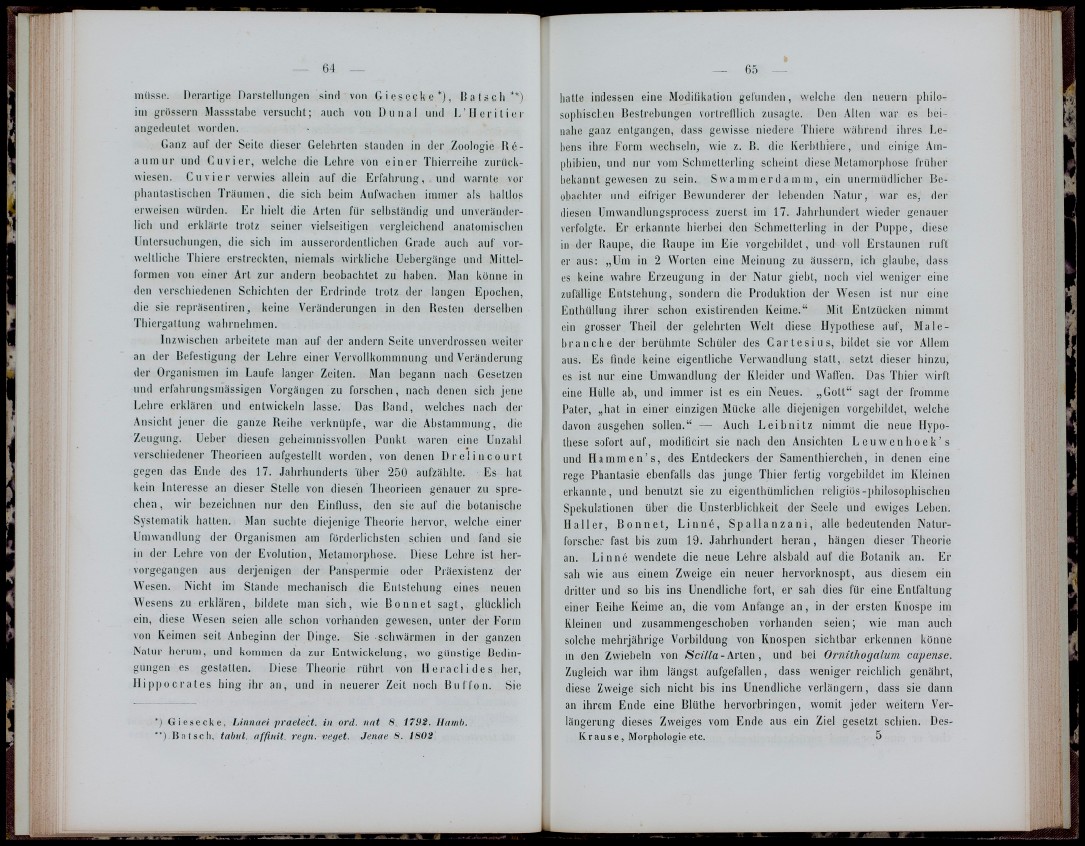
6 4 — 6 5
luiisse. Derartige Darslelluiigen sind von Gicsecke*) , Halscli*'^)
im grössern Massstabc versucht; auch von Duna l und J / I I c r i t i e r
angedeulet worden.
Ganz auf der Seite dieser Gelehrten standen in der Zoologie R6-
a u m u r und Cuvier, welche die Lehre von einer Thierreihe zurückwiesen.
Cuvier verwies allein auf die Erfahrung, und warnte vor
p h a n t a s t i s c h en Traumen, die sich beim Aufwachen immer als haltlos
erweisen würden. Er hielt die Arten für selbständig und unveränderlich
und erklärte trotz seiner vielseitigen vergleichend anatomischen
Untersuchungen, die sich im ausserordentlichen Grade auch auf vorweltliche
Tliiere erstreckten, niemals wirkliche Uebergänge und Mitlelformen
von einer Art zur andern beobachtet zu haben. Man könne in
den verschiedenen Schichten der Erdrinde trotz der langen Epochen,
die sie repräsentii'en ^ keine Veränderungen in den Resten derselben
Thiergaltung wahrnehmen.
Inzwischen arbeitete man auf der andern Seile unverdrossen weiter
an der Befestigung der Lehre einer Vervollkommnung und Veränderung
der Organismen im Laufe langer Zeiten. Man begann nach Gesetzen
und erfahrungsmässigen Vorgängen zu forschen, nach denen sich jene
Lehre erklären und entwickeln lasse. Das Band, welches nach der
Ansicht jener die ganze Reihe verknüpfe, war die Abstammung, die
Zeugung, üeber diesen geheimnissvollen Punkt waren eine Unzahl
verschiedener Tlieorieen aufgestellt worden, von denen Drelincourt
gegen das Ende des 17. Jahrhunderts über 250 aufzählte. Es hat
kein Interesse an dieser Stelle von diesen Iheorieen genauer zu sprec
h e n , wir bezeichnen nur den Einfluss, den sie auf die botanische
Systematik hallen. Man suchte diejenige Theorie hervor, welche einer
Umwandhing der Organismen am förderlichsten schien und fand sie
in der Lehre von der Evolution, Metamorphose. Diese Lehre ist hervorgegangen
aus derjenigen der Panspermie oder Präexistenz der
Wesen. Nicht im Stande mechanisch die Entstehung eines neuen
Wesens zu erklären, bildete man sich, wie Bonne t sagt, glücklich
ein, diese Wesen seien alle schon vorhanden gewesen, unter der Form
von Keimen seit Anbeginn der Dinge. Sie -schwärmen in der ganzen
Natur herum, und kommen da zur Entwickelung, wo günstige Bedingungen
es gestatten. Diese Theorie rührt von Heracl ides her,
I I i p ] ) o c r a t e s hing ihr an, und in neuerer Zeil noch Buffon. Sie
*) G i e s e c k e , Linnaei praelect. in ord, nat 8. 1792. Hamb.
Bnisch, tabvl. affinit. regn, veget, Jeiiae S. 1802
hatte indessen eine Modifikation gefunden, welche den neuern philosophischen
Bestrebungen vortrefilich zusagte. Den Alten w^ar es beinahe
ganz entgangen, dass gewisse niedere Thiere wähi'end ihres Lebens
ihre Form wechseln^ wie z. B. die Kerbthiere, und einige Amphibien,
und nur vom Schmetterling scheint diese Metamorphose früher
bekannt gewesen zu sein. Swammerdamm, ein unermüdlicher Beobachter
und eifriger Bewunderer der lebenden Natur, war es^ der
diesen Umwandlungsprocess zuerst im 17. Jahrhundert wieder genauer
verfolgte. Er erkannte hierbei den Schmetterling in der Puppe^ diese
in der Baupe, die Raupe im Eie vorgebildet, und voll Erstaunen ruft
er aus: „Um in 2 Worten eine Meinung zu äussern, ich glaube, dass
es keine wahre Erzeugung in der Natur giebt, noch viel weniger eine
zufällige Entstehung, sondern die Produktion der Wesen ist nur eine
Enthüllung ihrer schon existirenden Keime." Mit Entzücken nimmt
ein grosser Theil der gelehrten Welt diese Hypothese auf, Maleb
r a n c h e der berühmte Schüler des C a r t e s ius , bildet sie vor Allem
aus. Es finde keine eigentliche Verwandlung statt,, setzt dieser hinzu,
es ist nur eine Umwandlung der Kleider und Waffen. Das Thier wirft
eine Hülle ab, und immer ist es ein Neues. 55Gott" sagt der fromme
Pater, „hat in einer einzigen Mücke alle diejenigen vorgebildet, welche
davon ausgehen sollen." — Auch Leibnilz nimmt die neue Hypothese
sofort auf, modißcirt sie nach den Ansichten Leuwenhoek's
und H amme n ' s , des Entdeckers der Samenthierchen, in denen eine
rege Phantasie ebenfalls das junge Thier fertig vorgebildet im Kleinen
e r k a n n t e , und benutzt sie zu eigenthümlichen religiös-philosophischen
Spekulationen über die Unsterblichkeit der Seele und ewiges Leben.
H a l l e r , Bonnet^ Linné, Spallanzani, alle bedeutenden Naturforscher
fast bis zum 19. Jahrhundert heran, hängen dieser Theorie
an. Linné wendete die neue Lehre alsbald auf die Botanik an. Er
sah wie aus einem Zweige ein neuer hervorknospt, aus diesem ein
dritter und so bis ins Unendliche fort, er sah dies für eine Entfaltung
einer Reihe Keime an, die vom Anfange an, in der ersten Knospe im
Kleinen und zusammengeschoben vorhanden seien ; wie man auch
solche mehrjährige Vorbildung von Knospen sichtbar erkennen könne
in den Zwiebeln von Arten , und bei Ornithogalum capense.
Zugleich war ihm längst aufgefallen, dass weniger reichlich genährt,
diese Zweige sich nicht bis ins Unendliche verlängern, dass sie dann
an ihrem Ende eine Blüthe hervorbringen, womit jeder weitern Verlängerung
dieses Zweiges vom Ende aus ein Ziel gesetzt schien. Des-
K r a u s e , Morphologie etc. 5
ê
^ ^-...^.S-» v.l. .
il;