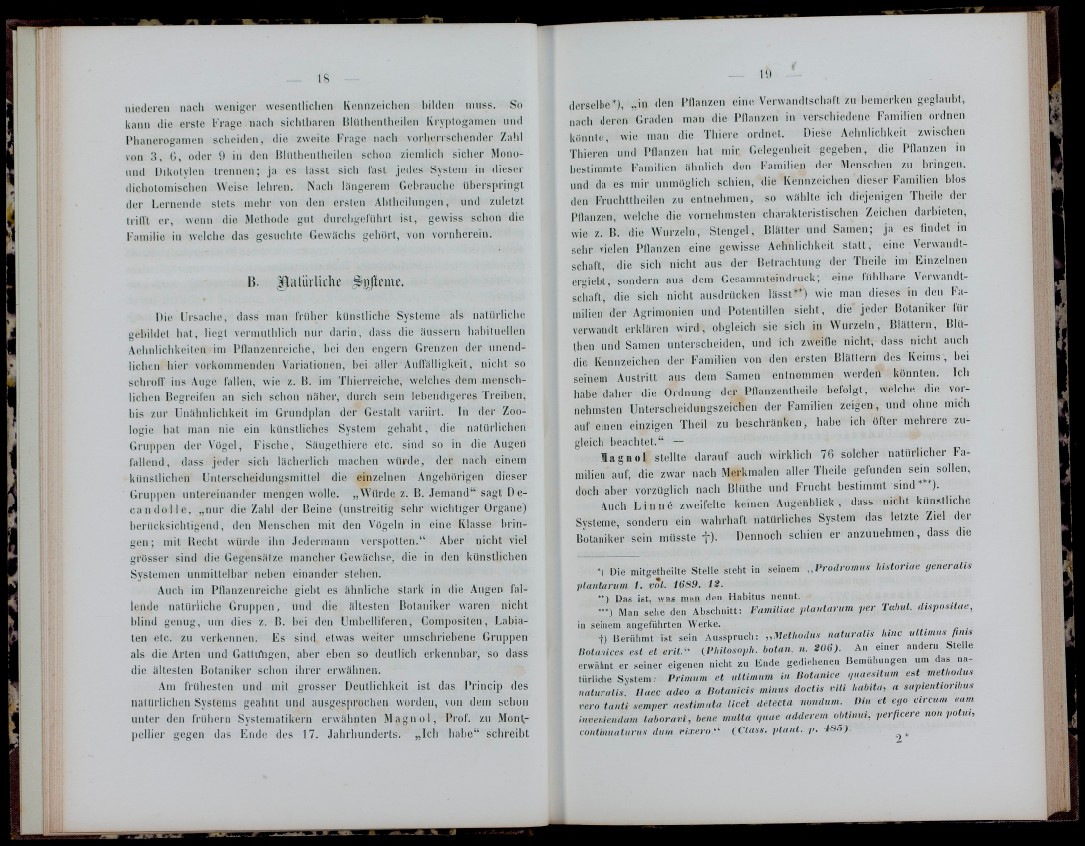
18 19
niederen nach weniger wesenllichen Kennzeichen biUlen ¡nnss. So
kann die erste Frage nach sichtbaren Blülhenlheihin Kryptoganien nnd
P h a n e r o g a m e n scheiden, die zweite Frage nacli voi'hei'rschender Zahl
von 3 , 0 , oder 9 in den BUithentheilen schon zienihch siclier Mononnd
Dikotylen trennen; ja es liisst sich last jeihis System in dieser
(hcholonuschen Weise lehren. Nach längerem Gebranche überspringt
der Lernende stets mehr von den ersten Abtheilungen, und zuletzt
trilTt er, wenn die Methode gut durchgefiilirt ist, gewiss schon die
Familie in w^elche das gesuchte Gewächs gebort, von vornherein.
H. flaiiirliclii ^nfimfi.
Die Ursache, dass man früher künstliche Systeme als naturliche
o-ebüdet hat, lie^t vermuthlich nur darin, dass die anssei'n habituellen
Aelinliclikeiten im Pllanzenreiclie, bei den engern Grenzen der unendlichen
hier vorkommenden Variationen, bei aller Auffälligkeit, nicht so
schrofi' ins Auge fallen, wie z. B. im Thierreiche, welches dem menschlichen
Begreifen an sich schon näher, durch sein lebendigeres Treiben,
bis zur ünähnlichkeit im Grundplan der Gestalt variirt. In der Zoologie
hat man nie ein künstliches System gehabt, die natürlichen
Gruppen der Vogel, Fische, Säugethiere etc. sind so in die Augeil
f a l l e n d , dass jeder sich lächerlich machen würde, der nach einem
k ü n s t l i c h e n Unterscheidungsmittel die einzelnen Angehörigen dieser
Gruppen untereinander mengen wolle. „Würde z. B. Jemand" sagt Dec
a n d o l l e , „nur die Zahl der Beine (unstreitig sehr wichtiger Organe)
b e r ü c k s i c h t i g e n d , den Menschen mit den Vogehi in eine Klasse bring
e n ; mit Recht würde ihn Jedermann verspotten." Aber nicht viel
g r o s s e r sind die Gegensätze mancher Gewächse, die in den künstlichen
Systemen unmittelbar neben einander stehen.
Auch im Pflanzenreiche giebt es ähnliche stark in die Augen fallende
natürliche Gruppen, und die ältesten Botaniker waren nicht
blind genug, um dies z. B. bei den Umbelliferen, Compositen, Labiat
en etc. zu vei'kennen. Es sind etwas weiter umschriebene Gruppen
als die Arten und Gattu"ngen, aber eben so deutlich erkennbar, so dass
die ältesten Botaniker schon ihrer erwähnen.
Am frühesten und mit grosser Deutlichkeit ist das Brincip des
n a t ü r l i c h e n Systems geahnt und ausgesprochen worden, von dem schon
u n t e r den früiiero Systematikern erwähnten Magnol , Prof. zu Montpelliei'
gegen das Ende des 17. Jahrhunderts. „Ich habe" schreibt
derselbe*), „in den Pflanzen eine Verwandtschaft zu bemerken geglaubt,
nach deren Graden man die Pflanzen in verschiedene Familien ordnen
k ö n n t e , wie man die Thiere ordnet. Diese Aehnlichkeit zwischen
Tliieren und Pflanzen hat mir Gelegenheit gegeben, die Pflanzen in
bestimmte Familien ähnlich den Familien der Menschen zu bringen,
nnd da es mir unmöglich schien, die Kennzeichen dieser Familien blos
den Fruchttheilen zu entnehmen, so wählte ich diejenigen Theile der
Pflanzen, welche die vornehmsten charakteristischen Zeichen darbieten,
wie z. B. die Wurzeln, Stengel, Blätter und Samen; ja es findet in
sehr vielen Pflanzen eine gewisse Aehnlichkeit statt, eine Verwandts
c h a f t , die sich nicht aus der Betrachtung der Theile im Einzelnen
ergiebt, sondern aus dem Gesammteindruck; eine fühlbare Verwandts
c h a f t , die sich nicht ausdrücken lässt**) wie man dieses in den Familien
der Agrimonien und Potentinen sieiit, die jeder Botaniker für
verwandt erklären wird, obgleich sie sich in Wurzeln, Blättern, Blüthen
und Samen unterscheiden, und ich zweifle nicht, dass nicht auch
die Kennzeichen der Familien von den ersten Blättern des Keims, bei
seinem Austritt aus dem Samen entnommen werden könnten. Ich
habe daher die Ordnung der Pflanzentheile befolgt, welche die vornehmsten
Unterscheidungszeichen der Familien zeigen, und ohne mich
auf einen einzigen Theil zu beschränken, habe ich öfter mehrere zugleich
beachtet." —
l a g i i o l stellte darauf auch wirklich 76 solcher natürlicher Familien
auf, die zwar nach Merkmalen aller Theile gefunden sein sollen,
doch aber vorzüglich nach Blüthe und Frucht bestimmt sind**').
Auch L i n n é zweifelte keinen Augenblick, dass nicht künstliche
Systeme, sondern ein wahrhaft natürliches System das letzte Ziel der
Botaniker sein müsste t)- Dennoch schien er anzunehmen, dass die
m
Die mitgetheilte Stelle steht in seinem „Prodrornus hiHorice generalis
piantarlim L vol. 1689. 12.
*") Das ist, was man den Habitus nennt.
Man sehe den Abschnitt: Familiae plantarmn ver T M . dispnsitae,
in seinem angeführten Werke.
t ) Berühmt ist sein Ausspruch: „IVIethodus naturalis hinc nltimns fims
Botanices est et erit.^^ (.Philosoph, botan. n. 206). An einer andern Stelle
erwähnt er seiner eigenen nicht zu Ende gediehenen Bemühungen um das natürliche
System : Prinmrn et ultimum in Botanice quaesitum est methodus
naturalis. Haec adeo a ßotanicis minus doctis vili habita, a sapientiorihus
vero tanti semper aestimata licet detecta nondum. Diu et ec,o circum eam
inveniendam laboravi, bene multa quae adderem obtinui, perficere non potm,
continuaturus dum pixero'' (Class, plant, p, 4S.5). ^^
rtXl